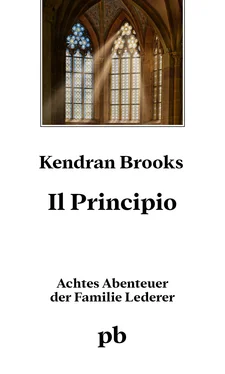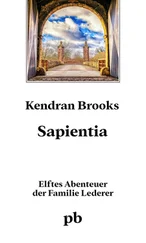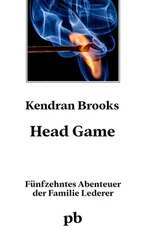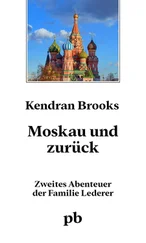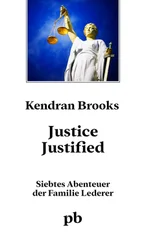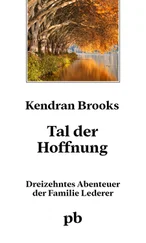Jules Lederer spielte ausgelassen mit seiner Tochter Alina im Garten. Er war der Torwart, sie die Artistin im Penaltyschießen. Das Tor bestand aus der Gartenbank und der Schubkarre als Torpfosten, dazwischen lag ein Abstand von gut drei Metern. Und selbst die regelkonformen elf Meter waren zu mickrigen vier zusammengeschrumpft. Der noch feuchte Rasen hinderte die beiden allerdings am hohen, körperlichen Einsatz. Alina holte kaum Anlauf und Jules hütete sich, nach einem zu gut platzierten Plastikball zu hechten, ließ sich lieber das eine oder andere Mal von seiner Tochter schlagen. Höhere sportliche Ambitionen von Vater und Tochter wurden zudem auch noch von ihren anhaltenden Lachanfällen behindert. Alina wie Jules konnten hinterher kaum erklären, was eigentlich der Anlass für ihre ausgelassene Fröhlichkeit gewesen war. Gut, der eine Ball, hart getreten von Alina, spritzte von der Ecke der Gartenbank direkt an die Stirn von Jules, hinterließ auf ihr einen dreckigen Schmier und in seinem Gesicht einen äußerst verblüfften Ausdruck. Alina hatte losgeprustet und Jules stimmte wenig später ein.
»Du … wolltest dich … doch … nicht … im Schlamm … wälzen, ... Papa ...«, stieß die Kleine zwischen ihren Lachattacken hervor. Ihr Gelächter drang durch das offene Fenster in die Küche, wo Alabima Vorbereitungen fürs Mittagessen traf, die frischen Scampi vom Markt in Lausanne am Küchentisch sitzend ausnahm, sie dazu aufschnitt und den Darm umsichtig entfernte. Den Kohlrabi hatte sie zuvor schon geschält und in kleine Würfel geschnitten. Er köchelte munter in einer Pfanne auf dem Herd vor sich hin. Weich gekochter Kohlrabi an einer würzigen Frischkäse-Kräuter-Soße, dazu gegrillte Scampi, nur mit einer Prise Meersalz und ein wenig schwarzem Pfeffer abgeschmeckt. Einfach und schmackhaft, leicht und bekömmlich.
Alabima stand auf und warf einen Blick hinaus in den Garten, sah Jules direkt ins Gesicht und wie er gespielt grimmig den nächsten Torschuss seiner Tochter einforderte. Und sie betrachtete Alina von hinten, wie sie vor lauter Lachen neben den Ball in die Luft trat und vom Schwung getrieben ausglitt und auf ihrem Hosenboden landete, mitten in den Match hinein, den ihre Sportschuhe durch das Treten auf nassem Rasen zuvor angerichtet hatten.
»He, ihr beiden«, rief sie ihnen laut zu, »Laurel und Hardy sind wohl auferstanden? In einer halben Stunde gibt’s Mittagessen. Kommt rechtzeitig rein, ihr Schmutzfinken, und wascht euch gründlich.«
Beide winkten ihr fröhlich zu, Jules lächelnd, Alina sich immer noch vor Lachen kugelnd.
Alabima setzte sich wieder und nahm die letzten beiden Scampi aus, legte sie neben die anderen aufs Tablett, betrachtete ihre Hände mit den feingliedrigen Fingern und den nur halblangen Nägeln, die nach einer Maniküre verlangten. Die Äthiopierin sandte ein stilles Dankgebet gen Himmel. Wie hatte sich Jules doch in den letzten Wochen verändert, war aus seiner Erstarrung erwacht, erschien ihr wieder lockerer, gelöster, hatte auch seine über viele Monate anhaltenden nächtlichen Angstattacken abgelegt, lag meistens ruhig neben ihr im Bett, war auch so zärtlich zu ihr wie kaum je zuvor. Sie liebten sich fast jeden Tag, inniger und vertrauter als früher, sanfter und einfühlsamer. Ja, Alabima war eine überaus glückliche Ehefrau und Mutter. All die dunklen Wolken der letzten beiden Jahre schienen endgültig verflogen, hatten sich wie der Regenschauer von letzter Nacht gelegt, ließen die Zukunft in einem strahlenden Licht erscheinen. Vergessen war auch ihr Abenteuer in Hongkong und all die Gefahren, in der sie mit ihrer Tochter damals schwebte. Oder zumindest hatte sie die Gedanken daran erfolgreich verdrängen können.
Auch Dr. Grey, die Psychologin aus Lausanne, zu der Jules seit mehr als einem Jahr jede Woche für eine Stunde zum Gespräch hinging, hatte die Fortschritte ihres Klienten zufrieden festgestellt, hatte ihn darin bestärkt, auf dem eingeschlagenen Weg mutig weiter zu gehen und nicht zurückzublicken, sondern nur vorwärts zu schauen. Selbst Jules gestand sich ein, dass all das Böse in ihm, das ihn seit Mexiko verfolgt und beständig gequält hatte, seit seiner Aussprache mit Alabima verschwunden schien, ihn zumindest nicht mehr in der Nacht überfiel, ihn nicht länger drangsalierte und vom Leben abschnitt. Und so glaubte auch der Schweizer mittlerweile an eine vollständige Heilung seiner Seele.
Die Äthiopierin stand vom Küchentisch auf und trug das Tablett mit den Scampi hinüber zum Spülbecken, wusch sie gründlich aus und tupfte sie mit Küchenpapier trocken, ging mit ihnen zum Herd, zog eine Bratpfanne aus dem Schrank, stellte sie auf die Platte, drehte am Regler, worauf sich die Gasflamme mit einem »Plopp« entzündete und blaue Flammen nach dem Metallboden zu lechzen begannen. Sie holte die Flasche mit Rapsöl hervor und stellte sie neben dem Herd bereit.
Die Türklingel ging und Alabima warf einen kurzen, prüfenden Blick zur Pfanne mit dem köchelnden Kohlrabi, drehte die Gasflamme etwas niedriger, ging aus dem Küche und auf den Flur und hinüber zum Bildschirm der Überwachungskamera, drückte den Verbindungsknopf, schaute erwartungsvoll auf die Scheibe. Doch als die Aufnahme vom Torbereich an der Hauptstraße angezeigt wurde, stockte ihr das Herz für einen Moment und sie trat erschrocken einen Schritt zurück, hob ihre Arme, hatte ihre Hände zu Fäusten geballt, drückte sie gegen ihre Kehle, konnte kaum glauben, wen sie dort längst erkannt hatte. Ein chinesisches Vollmondgesicht starrte in die Kamera, versuchte ein Lächeln, lieferte jedoch nur ein schräges, verunsichertes Grinsen.
»Hallo?«, meldete sich die Stimme des Mannes klar über den Lautsprecher, »mein Name ist Fu Lingpo. Ist Misses Lederer zu Hause?«
*
Eine neue Flüchtlingsgruppe aus Syrien traf an diesem Nachmittag in Mor Gabriel ein. Das orthodoxe Kloster, im 3. Jahrhundert nach Christus gegründet, war um einige hundert Jahre älter als der heute hier alles beherrschende Islam. Das Kloster leitete aus diesem Umstand heraus auch besondere Rechte für sich ab, sehr zum Missfallen der örtlichen Behörden und der Mehrheit der Bevölkerung. Mor Gabriel gehörte zu den letzten Bastionen des Christentums im tiefsten Süden der Türkei, wurde noch von zwei Dutzend Nonnen und einer Handvoll Mönche bewohnt.
Timotheus, der Erzbischof und Metropolit, empfing die Bürgerkriegsflüchtlinge aus dem Nachbarland persönlich, blickte in viele erwartungsvolle, aber auch in verängstigte oder leere Gesichter, in glücklich angekommene und ratlose vertriebene. Er breitete seine Arme weit aus, empfing die Menschen mit einem warmen » as-sal ā mu ʿalaiku m «, worauf mehrheitlich ein eher schüchtern ausgesprochenes » wa- ʿalaikum us-sal ā m « oder auch nur ernstes Kopfnicken zurückkamen.
Menschen stiegen von den beiden Lastwagen herunter, trugen Bündel und Koffer mit sich, Taschen und auch zusammengeknüllte Plastiksäcke unter ihren Armen. Das war das Wenige, das ihnen der Bürgerkrieg gelassen hatte, ihre letzte Habe, den Rest ihrer Heimat und womöglich ihrer Würde.
Die riesige Klosteranlage beherbergte bereits mehr als einhundert syrische Flüchtlinge. Doch der Platz war längst noch nicht erschöpft, eher noch die Arme und Hände der wenigen Mönche und Nonnen, die hier noch lebten, beteten und arbeiteten, ihre Seele und ihre Jahre ihrem Gott weihten und dereinst glücklich, weil erfüllt, sterben durften. Selbstverständlich packten die geflüchteten Syrer auch mit an, halfen bei der Ernte auf den Gemüsefeldern, in der Küche oder bei der Wäsche. Doch alles musste erst organisiert und überwacht sein, angeleitet und entschieden. Und so übernahmen sich vor allem die älteren Brüder und Schwestern regelmäßig, kämpften bis zu ihrer völligen Erschöpfung, sanken mehr tot als lebendig und oft erst tief in der Nacht auf ihre Matratzen, schliefen den kurzen Schlaf der Gerechten, wurden viel zu früh wieder geweckt, wuschen sich behände und warfen sich die Kleider über, stürzten erneut in die Schlacht, in die sie ihr Gott von einem Tag auf den anderen geführt hatte.
Читать дальше