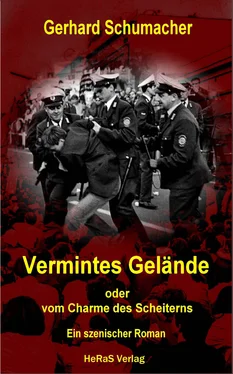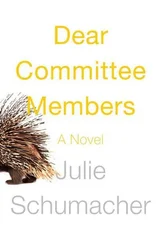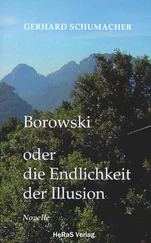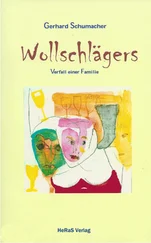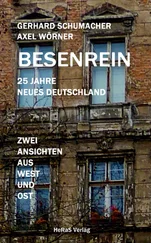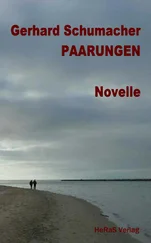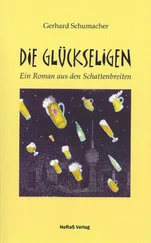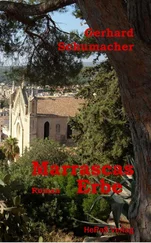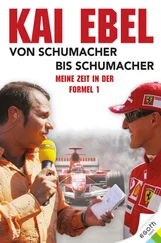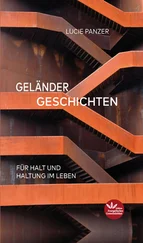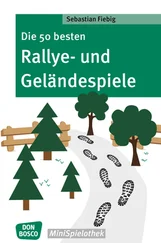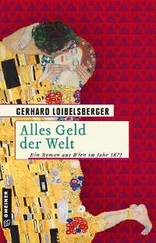Letztendlich war das Plenum im Audimax jederzeit wichtiger als die dreckigen Teller im Spülstein. In diesem Punkt waren wir uns einig, aber auch darüber, dass der Küchenplan eingehalten werden musste. Ein schönes Beispiel gesellschaftlicher Widersprüche, das wir über Stunden diskutierten, während das Geschirr still vor sich hin zu schimmeln drohte.
Aber so waren eben die Zeiten, die uns heute im Blick zurück oft schwer verständlich scheinen. Der ursprünglich wahrscheinlich ironisch gemeinte Spruch, wer zweimal mit der- oder demselben pennt, gehöre schon zum Establishment, hatte durchaus einen ernsten Hintergrund. Was war noch revolutionär (wie auch immer ein jeder für sich diesen Begriff definierte), was war schon etabliert? Auch oder gerade, wenn die Frage uns, den in die Jahre gekommenen vermeintlichen Revolutionären von damals, heute ein müdes, eher verzeihendes Lächeln abringt. Der lange Marsch durch die Institutionen hat uns verschlissen. Endlich sind wir dort angekommen, wo wir nie hinwollten. Das heutige System, nicht weniger schweinisch (ich tue dem Tier Unrecht an), als das damalige, hat uns eingelullt und kokonartig umsponnen. Die Unterschiede zu früher sind marginal und eher dem Goldenen Kalb geschuldet, das wir technischen Fortschritt nennen, denn einer revolutionären Veränderung.
Verzweifelt schaut der Warzendicke nicht nur auf hiesige blitzblank gewienerte Designerküchen, (wenn er denn überhaupt noch zwischen den Gewürzregalen hängen darf), sondern ebenso auf chromglänzende Kochstellen in China. Irgendetwas scheint da aus dem Ruder gelaufen zu sein.
Was hat der Hornung mir für einen Brief, was für eine Anzeige des Todes geschickt, dass ich in zentnerschweres Gedankengut verfalle, Trümmer vertaner Gelegenheiten aus dem Schutt grabe, die ich seit Jahrzehnten erfolgreich verdrängt hatte? War es die Macht des Wortes oder die der Erinnerung, die mich zu derartigen Überlegungen zwang?
Das Krematorium ist ein unförmiges Getüm aus grauem Sichtbeton bar jeden Anflugs irgendeiner Farbe, außer der allseits grauen Grausamkeit, die sich in unnatürlich hohen Räumen gegen den Himmel streckt, die Augen beleidigt und den Geist verletzt. Diese Verbrennungsstätte ist bedrückend und utopisch unwirklich. Unwirtlich ist sie sowieso, man mag nicht länger verbleiben als unbedingt nötig. Kein Bau, der den Hinterbliebenen Trost zu spenden in der Lage wäre, keine Höhle für's Gemüt. Wie schräg muss diese Gesellschaft beschaffen sein, kommt es mir in den Sinn, vorbei am Leben, ein derartiges Monstrum planen und errichten zu lassen? Wie sie mit den Toten umgeht, so behandelt sie die Lebenden. Soylent Green (die überleben wollen. Amerikanischer Film, 1973, Regie: Richard Fleischer) schimmert durch Beton und Farblosigkeit aufdringlich aus dem Hintergrund, an alle die, die überleben wollen, mit besten Wünschen an die Zukunft. Es fröstelt mich.
Vom Parkplatz ging ich durch den alten Eingangsbogen den Kiesweg entlang, der geradewegs auf den Feuerquader zuführt. Etwa nach der Hälfte des Wegs erkannte ich die Gruppe meiner ehemaligen Mitbewohner, die rechts vom Eingang Aufstellung genommen hatten. Ich war, wie so oft, der Letzte; alte Gewohnheiten lassen sich eben nur schwer ablegen.
Unangemessen herzlich für Ort und Anlass fiel unsere Begrüßung aus, wir lachten, verhalten zwar, aber nicht verhalten genug, klopften uns gegenseitig auf die Schultern, schwatzten lauter als geboten, Monika schrillte kurz und heftig auf, auch eine alte Gewohnheit, die sie bis an das Ende ihrer Tage begleiten wird. Andere Trauergäste schauten zu uns hinüber, schwiegen, missbilligten, einige schüttelten die Köpfe oder zogen die Lefzen hoch, so kam es mir jedenfalls vor. Es war kein Verständnis der einen für die anderen, wie sollte es auch?
Wir verabredeten nach dem Totengedenken einen Umtrunk in einer nahen Kneipe.
Die Türen schoben sich beiseite und öffneten den Weg ins ebenfalls graue Innere. Dann standen wir in einem Saal mit hoher Decke, von dort ging es weiter in den Raum der Andacht, in dem die Trauerfeier stattfinden sollte.
Die wir nach fast vierzig Jahren wieder, wenn auch rudimentär, zueinander gefunden hatten, setzten uns in die letzte Reihe, ich an den Mittelgang, der die Bankreihen in einen rechten und einen linken Flügel teilte. An der Stirnseite des Raums der Sarg mit Blumen geschmückt, schräg davor eine Staffelei mit dem Portrait Böhmes. Ernst, annähernd würdevoll, als erahnte er schon beim Fotografen den Bestimmungszweck der Aufnahme, blickte er in die Kamera. Das war nicht der Ralf Böhme, den ich gekannt hatte. Den Mienen meiner ehemaligen Mitbewohner entnahm ich gleichartiges Fühlen.
Als alle saßen, beschallte Klaviermusik vom Band Raum und Insassen, dauerte an und verstummte endlich nach langen Minuten. Allerdings nur, um nach kurzer Pause erneut zu beginnen. Aber irgendwann nach einer gefühlten Ewigkeit kam auch das zweite Stück zu einem Ende. Was war das für eine Musik?
Hinter mir machte sich die Angestellte des Bestattungsinstituts geräuschvoll an der Tür zu schaffen, um verspäteten Trauergästen den Einlass zu verwehren. Vor mir stand ein berufsmäßig trauernder Redner am Pult und erzählte Sequenzen aus dem Leben des Verstorbenen, mit denen er präpariert worden war. Die anderen, wichtigen, konnte er nicht erzählen, denn der Redner und der Beredete kannten einander nicht von Angesicht. Böhme konnte sich nicht einmal mehr wehren gegen die Vergewaltigung seiner selbst. Es war von Beginn der ersten Klänge vom Band an bis zum Auszug im wahrsten Sinne des Wortes ein Trauerspiel, das da vor unseren Augen und Ohren seinen schlecht inszenierten Verlauf nahm.
Mir schauderte und ich war froh, als mich die letzten Töne des Klavierstücks endlich aus der Pflicht entließen und ich dem Aussegnungsraum entfliehen konnte.
In der Kneipe, in der wir zusammenfanden, herrschte eine bedrückende Stimmung unter uns fünf Verbliebenen. Dies war weniger dem Tod Böhmes geschuldet als vielmehr dem Possenspiel, das man aus dem Gedenken an ihn gemacht hatte. Die lockere Fröhlichkeit, mit der wir vor dem Krematorium noch aufgefallen waren, wollte sich nicht mehr einstellen. Auch Bier und Schnaps waren nicht in der Lage, uns die Einsilbigkeit auszutreiben.
Die Lenz traf nach einer knappen Stunde als erste vorsichtige Anstalten zum Aufbruch. Strecker bot seine Begleitung an und auch ich selbst wäre jetzt lieber für mich alleine gewesen.
Hornung hatte die Situation sofort erfasst. Bevor sich unsere Runde, kurz nach dem unerwarteten Wiedersehen, erneut für lange Jahre aufzulösen drohte, ergriff er die Initiative. Seine Fähigkeit, den Stand von Augenblicken zu erfassen, noch bevor sie tatsächlich eingetreten waren und daraus die folgerichtigen Schlüsse zu ziehen, hatte ich schon zu den alten Zeiten an ihm bewundert.
Er sprach aus, was wir anderen lediglich dachten und lud uns zu einem gemeinsamen Wochenende in sein Haus, eine verpflichtende Terminierung wollte er hier und jetzt festlegen, Ausreden verbat er sich (es sollte wohl scherzhaft klingen), holte einen Kalender aus der Tasche, den er auf den Tisch legte.
Anreise Freitagabend, Abreise Sonntag nach dem Frühstück. Wer es wollte, könnte gerne früher kommen oder später abreisen, er selbst sei wohltuend wenigen zeitlichen Zwängen unterlegen und sein Haus groß genug, sich einander, wenn es denn notwendig sein sollte, aus dem Weg zu gehen. Hornung verwies auf die kochtechnischen Fähigkeiten, die er sich im Lauf der Jahre angeeignet hatte und vergaß auch nicht den Hinweis auf einen gut sortierten Weinkeller. Mithin wären die besten Voraussetzungen gegeben, beendete er seine kurze Rede, es gelte also nur noch, sich auf einen Termin zu verständigen.
Was in unseren jungen Jahren quälend langwierige Diskussionen hervorgerufen hätte, gestaltete sich in der Abgeklärtheit des Alters erstaunlich einfach und zügig. Schon nach knappen zehn Minuten einigten wir uns auf ein Treffen in drei Wochen, tranken darauf noch einen Schnaps und schieden dann in der Erwartung des Kommenden.
Читать дальше