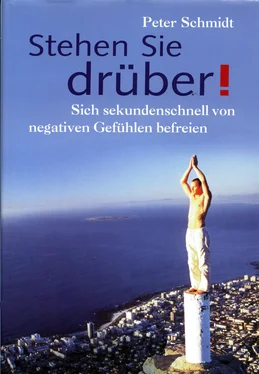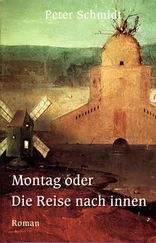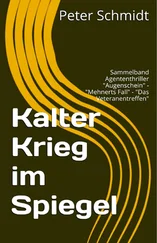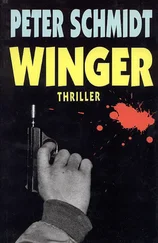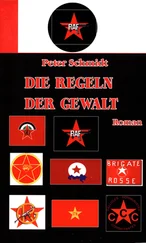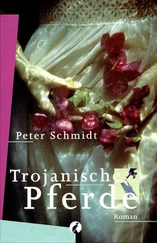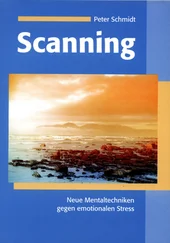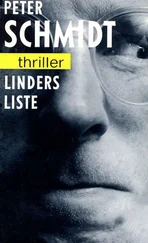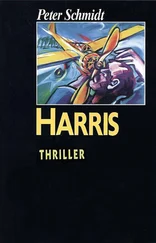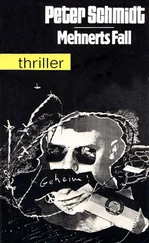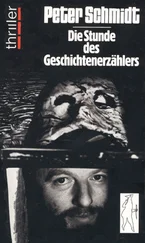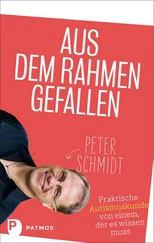Es ist nicht die bloß inhaltliche erfasste „Bedeutung“ des Problems, seine Qualität und Quantität – so als würde man bei einem Krieg davon reden, dass tausend Gefallene ein größerer Verlust sind als einer. Sondern der Intensitätsgrad des Gefühls beruht auch hier wieder in nichts anderem als in der Intensität des Angenehm- und Unangenehmseins:
Wie stark fühlen wir Lust oder Schmerz?
Wie sehr tut es weh?
Wie stark verlockt uns das attraktive Gefühl?
Natürlich wird das Gefühl durch die Situation ausgelöst. Gäbe es nicht den Anlass, z.B. den Grund für unseren Ärger, unsere Spielsucht oder Eifersucht, wäre auch das Gefühl kein Problem. Und der Intensitätsgrad des Gefühls hat oft – wenn auch nicht immer – mit der Qualität und Quantität des Sachverhalts zu tun. Bei tausend Toten sind wir gewöhnlich emotional betroffener als bei einem.
Aber da Menschen mit ganz unterschiedlichen Gefühlen auf dieselbe Situation reagieren, zeigt sich an diesem Beispiel auch deutlich, dass es gar keinen „richtigen“ Intensitätsgrad des Gefühls gibt.
Denn welche Gefühlsstärke sollte als adäquat angesehen werden?
Wiederum nur die, die uns vom eigenen Gefühl her als angemessen erscheint?
Was aber macht unser eigenes Gefühl zum Maßstab für andere Menschen?
Wir halten Gefühle zwar je nachdem für unangemessen oder übertrieben oder bezeichnen jemanden als gefühlskalt, wenn er wenig oder gar keine Gefühle zeigt. Aber dabei orientieren wir uns wohl nur an dem, was üblich ist, was wir gewohnt sind. Und diese Gewohnheit hat unsere eigenen Gefühlsantworten geformt, soweit sie nicht zufällig oder genetisch bedingt sind.
Wäre es z.B. der Brauch, auf jedes kleine Geschenk so überschwänglich wie ein Kind zu reagieren, dann würden wir diese Überschwänglichkeit auch nicht mehr als kindlich, bzw. kindisch ansehen, sondern eben als normal.
Diese Subjektivität des Fühlens zu kennen und sie immer vor Augen zu haben, macht uns „emotional intelligenter“.
Für ein Kind mag das Verlangen, das vom Geschmack einer Süßigkeit ausgeht, so verlockend sein, dass es nicht widerstehen kann und vom Gefühl des Verlangens übermannt wird. Ein Suchtkranker oder ein triebhafter Mensch könnte eine ganz ähnliche Anziehungskraft empfinden. Und die Vorstellung, verzichten zu müssen, kann negative Gefühle unerhörter Intensität hervorrufen – so intensiv, so schmerzhaft, so unlustbetont, dass man glaubt, sie nicht aushalten zu können.
Die Einsicht, dass die Bandbreite der Intensitätsgrade von Gefühlen bei verschiedenen Menschen unterschiedlich ist und das „normale Maß“ eben nicht als „richtig“ aufgefasst werden darf, sondern nur als Gewohnheit, erleichtert sowohl den toleranten Umgang mit anderen Menschen wie auch mit uns selbst.
In der Technik des desensibilisierenden Blicks wird es nun von größter Wichtigkeit sein, zu verstehen, dass das Prinzip der Intensitätsgrade des Angenehm- und Unangenehmsein in allen emotionalen Bereichen identisch ist. Bei Gefühlen , z.B. Körpergefühlen und Wertgefühlen genauso wie bei Emotionen, Affekten, Leidenschaften und Stimmungen.
Emotionen sind nach dem Verständnis vieler Psychologen im Wesentlichen nur „starke“ Gefühle.
Affekte wiederum sind starke Gefühle bzw. Emotionen, von denen wir uns unvermittelt und in Sekundenschnelle „überwältigt“ fühlen, bei denen wir nicht mehr Herr unserer Gefühle zu sein scheinen und uns zu Handlungen – z.B. Gewalttätigkeit – veranlasst sehen, zu denen wir uns bei ruhigem Nachdenken und ohne die Druck des Affekts vielleicht niemals hätten verleiten lassen.
Stimmungen wiederum sind Gefühle, die Kontinuität haben, die viele andere Erfahrungen zu durchfärben scheinen und nicht so deutlich an ein bestimmtes Objekt gebunden sind wie Gefühle und Emotionen, z.B. der Eifersucht.
Der Trauerfall, der die Stimmung der Traurigkeit auslöst, muss uns gar nicht mehr bewusst sein. Eine depressive Stimmung kann grundlos erscheinen.
Bei der Eifersucht, als Gefühl oder Emotion, zeigt sich das Gefühl dagegen mehr punktuell und mit der realen und geistigen Wahrnehmung der Situation verbunden , die Eifersucht auslöst. Es vermindert seine Intensität oder verschwindet, wenn wir nicht mehr daran denken, wohingegen die Stimmung auch ohne konkreten Anlass fortdauert.
Der Kern, das Wesentliche, ist jedoch in allen Bereichen dasselbe wie beim Gefühl. Deshalb macht es Sinn, die psychischen Kategorien Emotion, Affekt, Stimmung als „gefühlshaft“ oder „emotional“ zu bezeichnen (und den effektiven Umgang mit solchen Erlebnissen als „emotional intelligent“). Wir können auch sagen, es sind nur verschiedene Ausdrucksweisen des Gefühls, weil ihnen das entscheidende Wesensmerkmal gemeinsam ist: eben ihr Angenehm- und Unangenehmsein.
Im Leben werden wir über weite Strecken von diesem einen großen Prinzip beherrscht!
Wenn wir das verstanden haben, können wir unsere neue Mentaltechnik universell einsetzen. Dabei verhält es sich so ähnlich wie in der Lebensmittelüberprüfung. Man findet immer nur jene Schadstoffe, nach denen man auch sucht.
Sie können den desensibilisierenden Blick nicht auf das Unangenehmsein einer bestimmten Stimmung fokussieren, wenn Ihnen noch gar nicht klar geworden ist, dass Stimmungen genauso vom Unangenehm- und Angenehmsein abhängen wie Gefühle.
Sie können Ihre Aufmerksamkeit nur schwer auf das Gefühlsmoment im Affekt , z.B. im einer Wut richten, wenn Ihnen nicht klar ist, dass das eigentliche Problem im Unangenehmsein liegt.
Sie können Ihre Aufmerksamkeit kaum auf das Gefühlsmoment einer Emotion fokussieren, wenn Sie nicht wissen, dass Angst vor allem im Unangenehmsein besteht und Lust vor allem im Angenehmsein.
Sobald wir aber diese Generalisierung des Begriffs vorgenommen haben:
Gefühl, Emotion, Affekt, Stimmung sind im Wesentlichen gleich, sie bedeuten Angenehmsein oder Unangenehmsein –
dann lässt sich mental damit arbeiten!
Stellen Sie sich vor, Sie müssten nachts über einen Friedhof gehen. Die Atmosphäre – Einsamkeit, Dunkelheit, Mondsichel, gespenstische Grabsteine, vielleicht sogar der unheilvoll klingende Schrei einer Eule – lässt Sie erschaudern und jagt Ihnen eine Gänsehaut über den Rücken! Sie erliegen hier nicht einem Gefühl – oder dem, was man üblicherweise Gefühl oder Emotion nennt –, sondern einer Stimmung , und zwar einer negativen Stimmung.
Der Faktor aber, der Ihnen dabei zu schaffen macht, ist derselbe wie bei irgendeinem x-beliebigen negativen Gefühl – nämlich der Intensitätsgrad des Unangenehmseins. Sie könnten zwar auch „wohlig erschauern“. Dann treten negative und positive Gefühle gemeinsam auf. Sie fühlen polyphon – mehrstimmig . Und würde dabei die angenehme Gefühlstönung des positiven Gefühls dominieren oder überwiegen, dann wäre dies die richtige Stimmung für einen Kriminalfilm.
Überwiegt jedoch die negative Gefühlstönung, dann werden Sie, ob Sie das nun genau definieren können oder nicht, alles daransetzen, den „Ort des Schreckens“ möglichst schnell zu verlassen, sei es der reale Friedhof oder – weil Sie ja dafür bezahlt haben, meist erst nach einigem Hin und Her – das Kino.
Ähnlich verhält es sich mit der Trauer. Stimmungen unterscheiden sich wie gesagt dadurch von Gefühlen, dass sie länger andauern und unsere Wahrnehmungen wie einen Film unterlegen. Das Gefühl der Trauer kann Tage und Wochen anhalten. Es mag sich verstärken, wenn wir an den Anlass, vielleicht den Tod eines Angehörigen, denken, und sich verringern, wenn wir abgelenkt sind. Aber als Grundstimmung kann es dennoch in unterschiedlichen Graden unsere Wahrnehmung einfärben.
Читать дальше