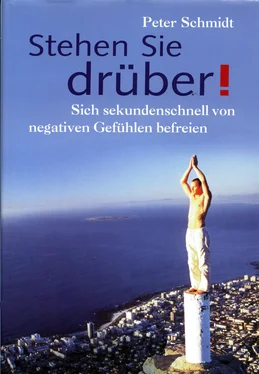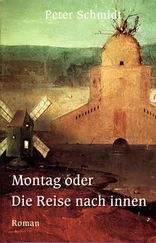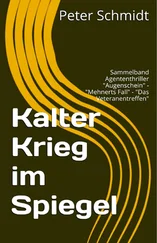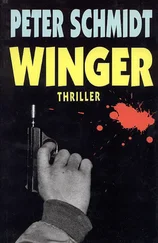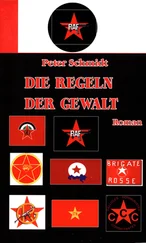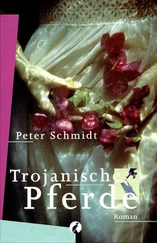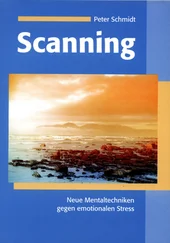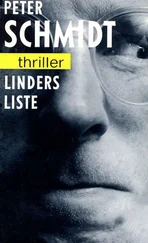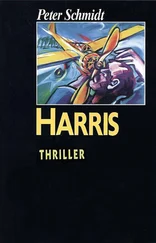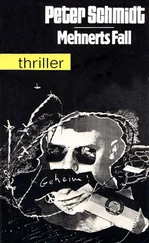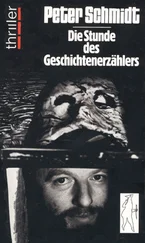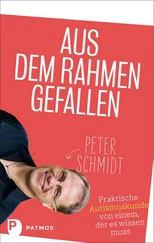Freude, Schönheit, Genuss, Witz, Wohlgeschmack, gute Laune, Anmut, Zufriedenheit, Begeisterung, Glück, Entzücken, Unterhaltung, Erleichterung, Wohlbehagen werden als angenehm erfahren, Kummer, Unwohlsein, Panik, Sodbrennen, Melancholie, Ärger, Eifersucht, Hautjucken, Angst, Befangenheit, Depression, Sorge, Lampenfieber, Unzufriedenheit, Kopfschmerz, schlechte Laune, Wut, Enttäuschung als unangenehm .
Diese Erkenntnis ermöglicht es uns, mit einem einfachen mentalen Programm – fast könnte man sagen, mit einem “Trick“ – alle Probleme gleich zu behandeln und sich so auf überraschend einfache Weise von ihnen zu lösen.
Bleiben wir jedoch zunächst noch beim Prinzip selbst. Das Malheur dieser Entdeckung ist nämlich, dass sie einen ungezügelten Hedonismus zu propagieren scheint. Also die Auffassung, unser höchstes Gut, der Endzweck allen Handelns, sei die psychische und physische Lust. Und das klingt für viele leider nach einer willkommenen, möglicherweise aber auch problematischen, wenn nichts sogar gefährlichen Rechtfertigung unserer so genannten Spaßgesellschaft. Wo bleibt da die Moral? Wo die Begründung objektiver, allgemeingültiger Werte? Und wie steht es um unsere Pflichten?
In der Diskussion, ob Lust und Unlust die wesentlichen Eigenschaften der Gefühle darstellen, wurde bereits Anfang des Jahrhunderts – z. B. von Psychologen wie W. Wundt, F. Krueger und später von P. Lersch – argumentiert, die Definition sei viel zu eng und erfasse nicht das tatsächliche Spektrum der Gefühlsqualitäten:
„Dass dieser Gesichtspunkt zur Banalität wird, wenn wir ihn etwa auf das Phänomen der künstlerischen Ergriffenheit anwenden, liegt auf der Hand. Die künstlerische Ergriffenheit wäre dann ebenso ein Gefühl der Lust wie das Vergnügen am Kartenspiel oder der Genuss eines guten Glases Wein. Andrerseits würden Regungen wie Ärger und Reue in den einen Topf der Unlustgefühle geworfen. Beim religiösen Gefühl aber – ebenso auch bei Gefühlen wie Achtung und Verehrung – wird die Bestimmung nach Lust und Unlust überhaupt unmöglich.“
Wo liegt der Fehler dieses Einwands? Er ignoriert Folgendes:
Wenn wir uns das Moment des Angenehm- oder Unangenehmseins aus den Erfahrungen der künstlerischen Ergriffenheit, des Vergnügens am Kartenspiel, des Genusses eines Glases Wein, des Ärgers, der Reue, des religiösen Gefühls, der Achtung, Verehrung wegdenken, verschwindet die Attraktivität oder Ablehnung dieser Gefühle auf der Stelle.
Ein neutraler Gefühlszustand – d.h. sich weder in einer angenehmen noch unangenehmen Gefühlslage zu befinden, rührt uns emotional nicht an, lässt uns „kalt“, wie es die Alltagssprache ausdrückt. Und dies eben, weil damit auch das wesentliche Charakteristikum der Ergriffenheit, des Vergnügens, der Reue, des Ärgers usw. fehlt.
Ersetzen wir die angenehmen Gefühle durch Unangenehmsein, Unlust, wird daraus sogar Abneigung, Ablehnung, Desinteresse. Ersetzen wir die unangenehmen Gefühle durch angenehme, wird daraus Interesse, Wertschätzung.
Jeder kann dazu für sich selbst die Probe an folgendem einfachem Beispiel machen:
Stellen Sie sich einen großen Lottogewinn vor. Nehmen wir an, Sie seien bis dahin sehr arm gewesen. Und die Vorstellung, mehr Geld ausgeben zu müssen, würde Ihnen großes Unbehagen bereiten. Gründe dafür können Sie aber nicht angeben. Es bereitet Ihnen einfach mehr Vergnügen, spartanisch zu leben. Und umgekehrt empfinden Sie das viele Geld als unangenehm, als Belastung.
Was den Lottogewinn dann zum Unwert oder Wert macht, zur „echten Werterfahrung“ – der nominelle Wert des Geldes oder sein Wert als Mittel für irgendwelche Eventualitäten bleibt dabei unbestritten –, ist eben doch in der Tat das, was sich am Ende der Wertekette als negatives oder positives Fühlen zeigt. Und dieses Fühlen lässt sich bei aller übrigen Verschiedenheit der Gefühle auf den gemeinsamen Nenner des Angenehmseins und Unangenehmseins bringen.
Vorübung 1:
Fokussierung auf negative Gefühle
Setzen Sie sich in einen bequemen Sessel. Am besten geeignet ist ein ruhiger, abgedunkelter Raum. Schließen Sie die Augen und entspannen Sie sich. Dabei sollten Ihre Beine nicht übereinandergeschlagen und die Arme nicht verschränkt sein, weil sonst unnötige Muskelanspannungen entstehen.
Für diese Übung ist es günstiger, wenn Sie nicht zu viel gegessen, keinen Alkohol getrunken und keine Psychopharmaka eingenommen haben.
Lassen Sie etwa eine halbe Minute lang alle Wahrnehmungen zu, gleichgültig, ob es sich um Geräusche oder um Gefühle, Gedanken oder Vorstellungen handelt. Kümmern Sie sich nicht darum. Verfolgen Sie diese Eindrücke nicht weiter, sondern akzeptieren Sie alles so, wie es sich von allein einstellt.
Lassen Sie nun Ihre Aufmerksamkeit durch den Körper wandern und suchen Sie dabei nach unangenehmen Gefühlen. Das könnte z. B. ein Schmerz oder ein Spannungsgefühl sein. Oder eine Stimmung, ein Unbehagen. Vielleicht ist dieses Gefühl auch so subtil, dass Sie es über sein Unangenehmsein hinaus gar nicht genau benennen oder zuordnen können.
Es geht weniger darum, etwas richtig zu benennen, als zu fühlen!
Oder es kommt Ihnen statt körperlicher Gefühle oder Stimmungen irgendein Gedanke in den Sinn, eine unangenehme Erinnerung oder ein Problem? Vielleicht sogar eine Angst? Gleichgültig ob körperlich oder geistig, ob grob oder subtil: Richten Sie einfach nur Ihre Aufmerksamkeit auf den negativen Gefühlsaspekt.
Versuchen Sie dabei von allen anderen Faktoren abzusehen. Es ist nicht wichtig, ob es sich um Ihren Fuß, die Brust oder den Kopf handelt. Es ist nicht wichtig, ob das negative Gefühl stark oder schwach ist. Denken sie nicht weiter darüber nach!
Fragen Sie auch nicht nach Gründen für Ihre Gefühle. Versuchen Sie nicht zu interpretieren oder zu bewerten. Lassen Sie Gedanken, die sich dabei spontan einstellen, einfach als das stehen, was sie sind und kehren Sie dann zum negativen Gefühl zurück.
Verfahren Sie genauso mit Gefühlen, die sich spontan an Gedanken, Vorstellungen oder Erinnerungen äußern. Das mag z. B. eine angstbesetzte Situation sein oder irgendeine Schwäche oder Hemmung. Gleichgültig, welche Situationen Ihnen in den Sinn kommen, die unangenehm sind: Sehen Sie von allem ab, was Ihnen noch dazu einfallen könnte. Lassen Sie etwaige Assoziationen einfach so stehen, wie sie sich von allein ergeben. Kehren Sie zum negativen Gefühlsaspekt zurück.
Strengen Sie sich bei dieser Übung nicht an. Bleiben Sie entspannt. Konzentration würde unter Umständen so starke Muskelanspannungen erzeugen, dass feinere negative Gefühle gar nicht mehr wahrgenommen werden.
Isolieren Sie einfach nur durch Ihre Aufmerksamkeit das Unangenehmsein des Gefühls. Sollte es sich verflüchtigen, dann suchen Sie nach einem anderen negativen Gefühl.
Was Ihnen in dieser Übung demonstriert werden soll, ist, dass negative Gefühle isoliert von ihrer Bedeutung und anderen Wahrnehmungen betrachtet werden können. Dabei lässt sich erkennen, dass es sich immer um das Gleiche handelt. Ob Kopfschmerz, Sorge oder Angst, ob Sodbrennen oder Spannungsgefühle, ob Hitze oder bedrückende Erinnerungen – es geht nur um den Faktor des Unangenehmseins.
Beenden Sie die Übung nach einigen Minuten. Bleiben Sie noch etwa ein bis zwei Minuten mit geschlossenen Augen sitzen, ohne irgendetwas zu tun, ehe Sie wieder die Augen öffnen.
Wozu dient diese Vorübung? Sie haben soeben den ersten und entscheidenden Schritt getan, um den desensibilisierenden Blick einzusetzen! Worin genau diese Technik besteht und worauf ihre frappierende Wirksamkeit beruht, wird in den folgenden Kapiteln gezeigt.
Unsere Alltagssprache drückt meist recht drastisch aus, dass wir unangenehme Gefühle haben: Wir sind „schlecht drauf“, „nicht gut in Schuss“, haben „keine Lust“, können etwas „nicht leiden“, sind „nicht in der Stimmung“, haben „die Nase voll“, uns „läuft die Galle über“. Wir „fühlen uns zum Kotzen“, bekommen „einen dicken Hals“, „haben genug“. Etwas ist „widerlich“, „unerträglich“, „nicht auszuhalten“, ein „Alptraum“, „schockierend“, „ekelhaft“.
Читать дальше