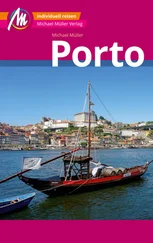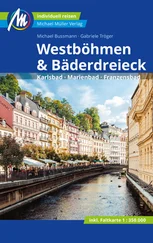Spyros steht neben der Treppe zur Restaurantterrasse, grinst und ruft mir etwas auf Griechisch zu. Ich verstehe es nicht. Einmal, weil ich trotz häufiger Ferienaufenthalte nur wenig Griechisch gelernt habe, zum anderen, weil der Wind die Worte in die entgegengesetzte Richtung weht.
Wahrscheinlich ist es wieder eine seiner Schweinereien, die er mir beigebracht hat. Wenn ich sie gelegentlich anwende, schüttelt er sich vor Lachen.
Spyros ist achtundzwanzig Jahre alt, mittelgroß, kräftig gebaut mit einem ganz leichten Ansatz zum Bauch. Sein dunkles Haar zeigt vereinzelt graue Strähnen.
Er gehört zu den wenigen Menschen, die ich nie verstimmt, misslaunig oder aggressiv erlebt habe. Seine stetige Freundlichkeit, der Witz und die Ausgeglichenheit entstammen nicht einer professionellen Haltung seinen Gästen gegenüber, sondern seinem Naturell.
Hervorstechend sind seine großen und strahlenden, braunen Augen. Sie sind wie ein Markenzeichen der Familie. Spyros hat sie vom Vater Georgios geerbt, so wie seine Schwester Milia und Kosta, sein jüngerer Bruder.
Bei Spyros drücken sie immer einen Anflug von freundlicher Schlitzohrigkeit und Spott aus.
Bekleidet ist er wieder mit seinem olivgrünen T-Shirt und der dunkelblauen Hose, die am Sitz und an den Taschenrändern etwas abgewetzt glänzt. Die Füße stecken ohne Socken in schwarzen Mokassins.
Spyros’ ganze Haltung spiegelt Ruhe und Gelassenheit wider. Das Sonnenlicht verleiht seinem Gesicht jetzt einen bronzenen Farbton. Um in mein Zimmer zu gelangen, muss ich an ihm vorbei zum hinteren Teil der Taverne gehen. Dort führt eine Treppe in das erste Stockwerk. Ich wende meinen Blick von ihm ab, richte ihn auf den Boden und strecke meinen Arm ruckartig zu einem übertriebenen Gruß senkrecht nach oben. Ohne auf seine Reaktion zu warten, setze ich meinen Weg fort. Plötzlich, ohne mir über meinen Sinneswandel klar zu sein, halte ich ein, kehre um und gehe auf ihn zu.
Da wir uns schon früh am Tag begegnet sind, tippe ich ihm nur auf den Oberarm und murmele halblaut eine der Schweinereien, die ich von ihm gelernt habe. Er antwortet mit einer noch deftigeren. Damit erschöpft sich unsere Konversation. Ich setze mich auf die Stufen des Einganges. Sie sind von der Sonne aufgeheizt. Ihre Wärme ist angenehm und tut meinem Hinterteil gut. Es ist durch die nassen Shorts kalt geworden. Spyros bleibt weiterhin stehen. Beide schauen wir schweigend auf das Meer, in die untergehende Sonne, auf die felsige Küstenlinie der Insel und die bewaldeten Berge. Alles ist nun in ein weiches, warmes Licht getaucht, das Schatten und Konturen verstärkt. Dieses Panorama löst in mir intensive, schwer zu beschreibende Empfindungen aus. Es sind ineinander verwobene Gefühle von Freude, Ehrfurcht und Sehnsucht. Offensichtlich entstehen solche Empfindungen nicht nur bei mir, sondern auch bei demjenigen, der dieses Bild sein ganzes bisheriges Leben vor Augen hatte.
Denn nach einer Weile gemeinsamen Schweigens wendet Spyros seinen Kopf zu mir herab und sagt leise in ungewohntem Ernst: „Ist das nicht wunderschön?“
* * *
Eine gute halbe Stunde später sitze ich geduscht und umgezogen auf der Restaurantterrasse an meinem Stammtisch – es ist der Eckplatz direkt an der Fensterfront. Zuvor habe ich noch einen Tisch an den meinen gerückt, um Platz für die sieben Personen zu schaffen, die ich erwarte.
Die Sonne ist seit einiger Zeit hinter dem Dunstband am Horizont verschwunden; es ist jetzt sehr viel dunkler. Dort aber, wo die Sonne untergegangen ist, glüht es noch tiefrot nach.
Ich beobachte eine Weile die Fledermäuse, wie sie im Dämmerlicht mit ihrem vieleckigen, schnellen Flug Insekten jagen. An einem großen Tisch schräg neben mir sitzen Griechen vom Festland. Sie verbringen hier ihren Urlaub. Es sind sechs Personen. Ein Elternpaar mit zwei Kindern und zwei älteren, in traditioneller schwarzer Witwentracht gekleideten Frauen. Die Ähnlichkeit der Frauen untereinander und mit dem Familienvater lässt vermuten, dass es sich um Schwestern, also um Mutter und Tante des Vaters, handelt. Die Kinder bilden ein sehr ungleiches Paar.
Die Tochter ist ein schlankes, sehr hübsches, etwa sechzehnjähriges Mädchen, mit großen dunklen Augen und langem, schwarzem Haar. Der Sohn, etwa neunjährig, ist stark übergewichtig. Sein kreisrundes, etwas dümmlich wirkendes Gesicht und das kurz geschorene Haar erwecken den Eindruck eines Häftlings.
Eine ähnliche Kopfform und Frisur besitzt auch der Vater. Dessen Haare sind jedoch um einiges länger und bilden einen militärischen Igelschnitt. Er wirkt freundlich, in sich ruhend und lebenslustig. Die Mutter dagegen verhärmt, gequält und rastlos. Ihre unruhigen kleinen Augen wieseln ständig hin und her und sind wie ihr Mundwerk ununterbrochen in Bewegung. Das blond gefärbte Haar ist nachgewachsen, die Haaransätze treten in ihrer natürlichen, dunklen Farbe hervor. Es sind nicht nur die Haare, die auf geringe Gepflegtheit hindeuten. Alles in allem wirkt sie wie eine Frau, die begonnen hat, sich aufzugeben. Mir kommt das Lied von Charles Aznavour in den Sinn: ‚Du lässt dich gehen.’
Die beiden älteren Frauen sind ausschließlich auf den fetten Jungen konzentriert, reden fortwährend auf ihn ein, lachen, streichen ihm über den Kopf, wischen ihm den Mund ab, reiben Flecken von Hemd und Hose und necken ihn. Sie spielen ein Fütterungsspiel wie mit einem Haustier: Abwechselnd bieten sie kleine Häppchen Honigjoghurt an, die sie ihm auf einem Löffel dicht vor den Mund halten. Er versucht, danach zu schnappen, bevor der Löffel weggezogen wird. Wenn er die Leckerei ergattert, erhält er lauten Beifall, verfehlt er sie, wird er bedauert. Die Szene ist bizarr und abstoßend. Der dicke Junge tut mir leid.
Obwohl das Spiel von Großmutter und Tante auf den ersten Blick liebevoll gemeint sein mag, entsteht dennoch in mir das Bild zweier Krähen, die laut krächzend um ihre Beute tänzeln und sie mit schnellen Schnabelhieben traktieren. Ich beschließe, diese Familie die ‚Krähenfamilie’ zu nennen.
Die Tochter hat sich von alledem mithilfe ihres Walkmans abgeschirmt und schaut verträumt in Richtung Meer. Den Rücken halb zum Tisch und halb zu einer der schwarzen Frauen gedreht, ruht ihr rechter Arm auf der Rückenlehne des Plastiksessels. Auf diesen Arm hat sie ihr Kinn gebettet. Mit der Hand klopft sie rhythmisch auf die Lehne, zu nur für sie hörbarer Musik. Diese demonstrative Abwendung vom familiären Geschehen und die laszive, hin gegossene Haltung erscheinen mir wie eine aggressive und erotische Provokation. Ihre Herausforderung bleibt nicht ohne Wirkung, auch hier wechseln sich die schwarzen Frauen ab, allerdings mit Ermahnungen. Ich bin sicher, es sind Aufforderungen, sich ordentlich hinzusetzen. Von der neben ihr sitzenden schwarzen Frau erhält sie sogar einen Klaps auf den Rücken. Das Mädchen schreckt empört hoch, faucht wie eine Katze und begibt sich sofort wieder in ihre alte Pose. Nichts führt bei ihr zu einem ‚Haltungswechsel’.
Auf mich wirken diese Maßregelungen kraftlos. Sie werden ohne Engagement vorgetragen, sind eher pädagogische Pflichtübungen. Wahrscheinlich ist man sich längst über deren Wirkungslosigkeit im Klaren.
Die Mutter beachtet die Mästung ihres Sohnes nicht. Sie hat ihn wohl bereits an die beiden Alten verloren. Während der ganzen Zeit redet sie ununterbrochen.
Es ist für mich nicht auszumachen, an wen sie sich mit ihrem Redefluss wendet; sie schaut beim Sprechen niemanden an. Das löst in mir eine merkwürdige Vorstellung aus: Anstelle der Worte kommen nun Rauchwolken aus ihrem Mund, sodass die Personen um sie herum, langsam von diesen Schwaden eingehüllt werden. Möglicherweise ist es ihre Methode, mithilfe des eigenen Wortschwalls Abstand zu den anderen zu halten, sie zu benebeln, oder sich selbst dahinter zu verstecken und zu verschanzen.
Читать дальше