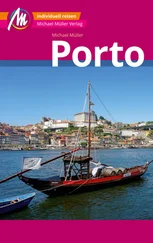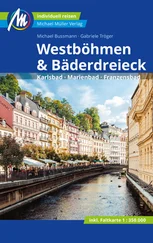„ Denk doch mal nach! Es ist schon spät, Badehose an- und ausziehen, mit feuchtem Handtuch abtrocknen, würdest frieren und ...“
Die große Welle habe ich nicht kommen sehen. Sie unterbricht die Auflistung der Bedenken und umspült mich bis zum Bauchnabel. Ich habe Mühe, nicht von ihr umgeworfen zu werden. Aber die Shorts und der untere Teil meines Hemdes sind klatschnass.
Diese plötzliche Dusche erkläre ich zum Ersatz für das abendliche Abschlussschwimmen. Ich schwenke die Badehose mehrmals durch das Wasser und wringe sie aus. Es wird Zeit, aufs Trockene zu flüchten, denn die nächsten großen Wellen rollen heran.
Ich ziehe mein Hemd nochmals aus, um die nassen Stellen auszuwringen. Dabei fällt meine Armbanduhr aus der Hemdtasche in den Sand. Ein kurzer Anflug von Ärger: Habe sie wieder einmal mit an den Strand genommen, obwohl ich mir jedes Mal vornehme, sie im Zimmer zu lassen. Ich säubere sie sorgfältig und binde sie um.
Dann suche ich meine Badelatschen. Einer liegt rechts, der andere links neben der Liege. Sie sind fast vollständig mit Sand bedeckt. Ich angle sie nacheinander mit den Füßen aus dem Sand und versuche, sie in eine solche Stellung zu bringen, dass ich hineinschlüpfen kann. Heute gelingt mir das nicht sofort, und ich muss eine Art kleinen Tanz aufführen, um sie an die Füße zu bekommen.
Jetzt gilt es, die nasse Badehose und die Flasche mit Sonnenöl in das Handtuch einzurollen. Mir fällt auf, dass ich bei allem, was ich tue, sehr langsam vorgehe und dabei eine merkwürdige Sorgfalt an den Tag lege. Ist es wirklich erforderlich, die Ecken des Handtuchs genau übereinander zu bringen oder die nasse Badehose vor dem Einrollen ins Handtuch vorher sorgsam zusammenzulegen?
Diese Sorgfalt entspricht nicht meiner sonstigen Gewohnheit. Man sagt mir in solchen Dingen eher Schlampigkeit nach, was ich durchaus einräumen würde.
Mir fallen Kinder ein, die trödeln und alles betont langsam machen, um das Schlafengehen so lange wie möglich hinauszuzögern. Wende ich diese Verzögerungstaktik hier an, um noch eine Weile am Strand bleiben zu können? Das würde bedeuten, dass ich mich selbst austrickse, denn eigentlich zwingt mich nichts, jetzt zu gehen - aber nur eigentlich. Denn sogleich meldet sich meine Stimme:
„ Es wird Zeit, jetzt zu gehen, dir ist schon kalt, du musst dich vor dem Essen noch duschen und umziehen, und schließlich muss ja mal Schluss sein.“
Wer kann sich dieser geballten Vernunft widersetzen?
Der Abschied vom Strand fällt mir etwas leichter, weil die nassen Shorts sich bei jeder Bewegung unangenehm bemerkbar machen und der Tag nun in einen anderen Abschnitt übergeht, auf den ich mich sonst freue. Heute allerdings sind meine Gefühle gemischt. Den Vorschlag zum gemeinsamen Abendessen habe ich spontan - fast leichtfertig - unterbreitet und mir kommen jetzt Zweifel, ob das eine weise Entscheidung war?
Ein fernes Grollen reißt mich aus meinen Gedanken. Es ähnelt zunächst einem Gewitter, schwillt aber schnell zu einem dauerhaften, gewaltigen Dröhnen an. So wie es die ruhige Abendstimmung zerstört, hat es etwas Gewalttätiges.
Ich bin beunruhigt, weil ich den Ursprung des Donners zunächst nicht zuordnen kann. Dann aber erkenne ich zwei Militärjets von Süden heranrasen. Für einen Moment bildet sich die beängstigende Vorstellung, dass hier keine der üblichen Patrouillen geflogen wird, sondern, dass es aus diesen Maschinen gleich Bomben regnet. Die Düsenjäger fliegen nahe der Küste und dicht über dem Wasser im Langsamflug. Eine Maschine führt, die Zweite hält sich links daneben, um eine Flugzeuglänge versetzt.
Im Gegenlicht erscheinen sie schwarz, nur die Cockpits werden vom Abendlicht hell erleuchtet, und ich kann darin die behelmten Köpfe der Piloten erkennen.
Die Triebwerke haben nun im Vorbeiflug ohrenbetäubende Lautstärke erreicht und lassen meinen Körper innerlich vibrieren. Die Jets fliegen über die nördliche Bucht und sind vor dem Hintergrund der Berge und dem dunklen Wasser nicht mehr auszumachen. Erst ein erneutes Dröhnen kündigt ihren Steigflug an. Sie werden wieder als steil nach oben fliegende, schwarze Dreiecke sichtbar, abgehoben gegen das Graublau des Abendhimmels, hinter sich eine dunkle Rauchschleppe, die der Wind seitlich verschiebt und schnell auflöst.
Ich bin wieder einmal fasziniert von der gewaltigen Kraft dieser Technik, die Menschen erzeugen und bändigen können.
Als jemand, der selbst ein paar Stunden als Privatpilot durch die Lüfte geschaukelt ist - und übrigens auf diesem Wege, diesen Flecken hier gefunden hat - schaue ich mit Wehmut und Neid auf die Leute im Cockpit solcher Maschinen.
Aber irgendwo ist da noch das Gefühl der Enttäuschung oder Ernüchterung, dass dieser schöne Strand und die herrlichen, malerischen Sonnenuntergänge nicht von dieser hoch entwickelten Kriegstechnik verschont bleiben.
„ Was für ein Unsinn! Da baust du dir in deinen Vorstellungen eine heile Welt, eine Insel der Glückseeligen und bist sauer, wenn du merkst, dass es sie nicht gibt. Eine geniale Art, sich selbst zu ‚ent’ - täuschen und sich fertig zu machen, weiter so“, rügt meine Stimme sofort. In Gedanken antworte ich trotzig:
„ Ja, ja stimmt schon, aber trotzdem ist es schade!“ Ich mache mich auf in Richtung Georgios Taverne. Das Wegstück über den Strand ist kurz, vielleicht nur vierzig Meter.
Diese Strecke zu überwinden, kommt mir heute wie Schwerstarbeit vor. Ich fühle mich schlapp und müde, so als hätte ich den ganzen Tag Zementsäcke geschleppt. Ich stolpere, eine Sandale rutscht vom Fuß. Es braucht einige Zeit, bis ich sie, ohne meine Hände einzusetzen, wieder am Fuß habe. Mein Gang muss dem eines Betrunkenen ähneln.
Zur Taverne verläuft der Weg über eine betonierte, steile Auffahrt, die hauptsächlich dazu dient, Boote an den Strand zu transportieren. Sie verbindet den Strand mit der Straße, die vom Dorf in den Bergen kommt und vor der Taverne in eine gepflasterte Plattform mündet.
Am Fuß der Auffahrt befindet sich ein Wasserhahn mit einem kurzen grünen Schlauch. Ich drehe den Hahn auf und versuche, den Sand von Waden und Füßen zu spülen. Das gelingt nicht sofort. Erst, nachdem ich die Öffnung des Schlauchs etwas zudrücke und der Wasserstrahl mit größerer Geschwindigkeit austritt, lässt sich der restliche Sand entfernen. Nach diesem mühsamen Reinigungsprozess erwartet mich eine weitere Herausforderung: Es gilt, mit nassen Füßen, in glatten und offenen Gummisandalen, ohne aus diesen herauszurutschen oder zu stolpern, eine beachtliche Steigung zu überwinden. Es gelingt, ich erreiche die Plattform vor der Taverne unfallfrei.
Die Taverne ist ein - wie hier üblich - in gelblich-roter Farbe verputzter, zweistöckiger Bau mit flachem Ziegeldach und einem geräumigen, einstöckigen Vorbau. In der oberen Etage bildet dieser Vorbau eine große, offene Dachterrasse. Im rückwärtigen, überdachten Teil des Hauses liegen Gästezimmer, von denen ich eines bewohne.
Unter der Dachterrasse liegt der sogenannte kleine Gastraum, in dessen rückwärtigen Bereich, ein offener Durchgang zur Küche führt. Von der linken Seite des Gastraumes gelangt man durch eine Tür auf die große, verglaste Restaurantterrasse. Früher war sie kleiner und primitiver eingerichtet, aber keineswegs ungemütlich. Heute ist sie ‚touristisch voll erschlossen’: Ausgestattet mit einem festen Holzdach, einem mit hellen Steinplatten belegten Fußboden, einer umlaufenden Glasfront mit großen, verschiebbaren Fenstern, mit Plastikmöbeln, einer Musikanlage, einigen mehr oder minder gelungenen Dekorationsartikeln und einem großen Aquarium, in dem üblicherweise Krebse auf ihr Ende im Kochtopf warten. Zurzeit ist das Bassin unbewohnt, da die Wasserpumpe den Geist aufgegeben hat. Den ersten Stock der Taverne hat die Plastik-Ära noch nicht erreicht, hier ist die Zeit scheinbar stehen geblieben. Die Einrichtung der Gästezimmer besitzt noch den Charme der fünfziger Jahre. Zur Zimmerausstattung gehören der ein oder andere alte Tisch und jene typischen Stühle mit geflochtener Sitzfläche.
Читать дальше