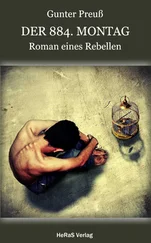1 ...6 7 8 10 11 12 ...24 Wir erinnern uns an das Jahr 1933 und seinen verhängnisvollen 10. Mai. Ich bin Jahrgang vierzig und habe also die Machtergreifung Hitlers und seiner Komplizen nicht miterlebt. Mein Wissen vom damaligen Geschehen habe ich aus Geschichtsbüchern, aus Berichten der Mütter und Väter, vor allem aber aus der Literatur, die am 10. Mai 1933 in deutschen Städten auf den Scheiterhaufen verbrannte. Unser Entsetzen ist groß über Menschen, die den Umgang mit dem Kulturgut „Feuer“ auf geradezu teuflische Weise perfektioniert hatten, die ihr eigenes Kulturerbe verleugneten und all die Zeugnisse menschlicher Größe den Flammen preisgaben, und wenig später Hunderttausende ihrer Mitmenschen - Mütter, Väter, Brüder und Schwestern, ja, Kinder - in Verbrennungsmaschinen zu Asche werden ließen. Doch aus meiner Betroffenheit wächst der Triumph: Wir sind hier versammelt, einen schwer errungenen Sieg zu feiern, einen Sieg der Kultur über die Unkultur, über Unmenschen und Unmenschliches, den Sieg des Widerstandes, der kämpferischen Vernunft und Liebe also, ohne die menschliches Leben und seine Kunst nicht zu denken sind.
Der Triumph kann nur kurz sein, die Siegesfeier keinesfalls laut. Wir erinnern uns der Toten und Gebrochenen des 2. Weltkrieges - mit der Verbrennung von Büchern hatte der Nationalsozialismus zum ersten Mal in aller Öffentlichkeit seine bestialische Fratze gezeigt - und blicken in die gegenwärtige zerrissene und zerstrittene Welt, der die Rüstung den Hals zuschnürt, die Augen blind und die Ohren taub macht. Eine Vielzahl die menschliche Existenz bedrohende Probleme stehen zur baldigen Lösung an - es ist in der Tat fünf vor zwölf, es steht uns eine Geisterstunde bevor, die wir, wenn wir sie nicht doch noch abwenden, alle nicht überleben werden.
Ein Triumphgefühl verliert sich schnell in meiner Angst. Gegen seine Angst muss man etwas tun, sonst webt sie uns ein in ihren engen Kokon. In einer Welt, die sich in zwei feindliche Lager gespalten hat, wobei beide Seiten sich zunehmend mehr auf Wirtschaftswachstum und militärische Stärke verlassen, dürfen wir Schriftsteller auf das mahnende Wort nicht verzichten, auf die Kunst des Erzählens von Menschengeschichten und der Menschheitsgeschichte, auf das heikle Brückenbauen von der Wirklichkeit zur Wahrheit.
Dieses Jahr 1933, dieser 10. Mai soll uns sagen: Wir sind nicht geboren, um an Wunder zu glauben. Gott, alle Hoffnung auf Erlösung, die wir bewusst oder unbewusst mit ihm verbinden - dieser Gott ist in jedem von uns. An uns sollen wir glauben, von uns und um uns müssen wir wissen. Wir sind es, die über Wohl und Wehe unserer Erde zu entscheiden haben. Oft sprechen wir von Ewigkeiten und können doch nur den Augenblick meinen. Nur die Hoffnung gibt Ewigkeit. Hoffen aber ist Tun. Und Tun ist: sich seiner selbst bewusst werden durch die Liebe und Arbeit und immer wieder einen Schritt auf den anderen zugehen. Dazu braucht es den Frieden. Wir befinden uns in einem kampflosen Zustand, durch Waffen und Angst gehalten, das ist kein Frieden. Frieden ist kein Zustand, er ist Ziel auf einem nie endenden mühseligen Weg. Um den Frieden müssen wir kämpfen; aber es darf kein anderes Kampfmittel geben, als das zum Argument erhobene Wort: Wir erinnern uns an den 10. Mai 1933.
6. Da ich ein Suchender bin, darf ich ein Irrender sein (1983)
Das Gespräch führte: Wolfgang Tittel
Du bist „alteingesessener“ Leipziger, arbeitetest nach dem Besuch der Grundschule und einer Lehre als Fernmeldemechaniker als Transportarbeiter und Lagerist, warst Leistungssportler im Judo, besuchtest Ende der Fünfzigerjahre die Artistenschule, kehrtest danach als Fernmelderevisor in deinen Lehrberuf zurück. Seit Mitte der Siebzigerjahre bist du als frei schaffender Schriftsteller tätig. Mich interessiert, wie du zum Schreiben gekommen bist. Gibt es einen Zusammenhang dabei mit bestimmten Stationen deines Lebens? Was bedeutet für dich das Schreiben?
Ich bin ein Kriegs- und vor allem ein Nachkriegskind. An den Krieg gibt es kaum konkrete Erinnerungen. Und doch sind seine Schattenbilder in mir lebendig geblieben. Er ist etwas im Dunkeln Lauerndes, ein Ungeheuer, das mir selbst jetzt noch, einigermaßen erwachsen geworden, Angst macht. Bei Kriegsende war ich fünf Jahre alt. Erst hier setzt meine Erinnerung ein. Eigenartig ist, dass die konkreten Bilder meinem Gefühl widersprechen. Wenn ich an meine Kindheit denke, da ist es Frühling, Ostern, Sonntag, die Menschen haben ihre guten Sachen angezogen und verlassen ihre Wohnungen in Richtung Stadtwald. Da ist eine warme Sonne am Himmel, feste Erde unter den Füßen, und ganz nahe ist frisches Grün, das die Menschen lächeln und tief atmen lässt. Es ist ein Bild der Hoffnung, eines Neubeginns, des Osterspaziergangs. Es widerstrebt mir, genauer hinzusehen. Tue ich es dennoch, sehe ich die häusliche Enge einer Arbeiterfamilie, eine Welt in der Welt, von meiner absolutistischen Mutter beherrscht, der die Kriegserlebnisse Vertrauen und Glauben an eine gerechte und ihrer Familie wohlgesinnte Welt genommen haben.
Die Mutter hatte die Zeit für das „Draußen“ uns Kindern und auch ihrem Mann knapp bemessen. Für jedes Wetter lag die passende Kleidung bereit, auf jede mögliche Gefahr wurden wir mit eindringlichen Worten vorbereitet, die uns sagten, wie ihr am sichersten aus dem Weg zu gehen sei. Aber das Draußen, diese andere geheimnisvolle und gefahrvolle Welt lockte unwiderstehlich. In ihr wollte und musste ich leben. Mein Vater zeigte mir den Kompromiss. Er, ein lebenskräftiger und tüchtiger Mann, mit Ambitionen zur Sangeskunst, von Beruf Fleischer, brach immer wieder aus Mutters Welt aus, kehrte dann am nächsten Morgen - nachdem er in einer Kneipe gezecht und all die Tenorarien aus Opern und Operetten gesungen hatte - sanft und Reue zeigend zurück. Nach so einer Nacht, in der mein Vater weggeblieben war, erschien er mir wie ein Abenteurer, ein Weltreisender, einer, der auf Cooks Schiffen gefahren war. Ich verstand es und verstand es auch nicht, wie er hatte zurückkommen können in eine Welt ohne Wunder.
Eines Tages dann bestand ich meiner Mutter gegenüber auf die mir unendlich erscheinende Welt da draußen. Dem Tüchtigen und Begabten versprach der Leistungssport schnelle und gute Möglichkeiten, sich Freiräume zu verschaffen. Ich wählte mir die in Europa junge Sportart Judo aus, wo der Kämpfer Körper und Geist gleichermaßen braucht. Aber bald musste ich erleben, dass der Leistungssport nichts mit dem ersehnten befreienden Spiel und mit Lebensfreude zu tun hatte, auch sein Lebensraum war knapp bemessen, er versetzte mich in einen neuen Zwang: Siegen zu müssen. Nach den Sportlern selbst, nach ihrem Denken und Fühlen, wenn es denn nicht mit dem Sport zu tun hatte, wurde nicht gefragt. Alles war dem Erfolg, dem Sieg also, untergeordnet. Nur der Sieger galt was und wurde gefeiert, der Verlierer wurde fallen gelassen. Sensibilität, das Nachfragen und hinter die Dinge kommen wollen, war unerwünscht, es wurde der Zielstellung als hinderlich angesehen. Die Liebe, das Wunderbarste, was uns Menschen passieren kann, war von den Sportfunktionären am meisten gefürchtet, sie konnte von heute auf morgen all ihre Arbeit zunichtemachen und ihre Schützlinge aus der Siegerbahn werfen. Wir hatten nur eins zu denken und zu tun: Kämpfen. Und Kämpfen hieß siegen. Das konnte ich einfach nicht durchhalten. Ich wollte ja kämpfen. Und auch siegen. Aber es war ein anderer Kampf und ein anderer Sieg, den ich meinte.
Was ich eigentlich wollte, wusste ich damals noch nicht. Eines hatte der Leistungssport dennoch geschafft: er hatte mich aus Mutters Welt befreit, und aus der neuen Anhängigkeit löste ich mich jetzt schneller. Ich war von Zuhause losgegangen und musste nun weitergehen. Ich spürte intensiv wie nie zuvor, weil bewusster: Ich lebe. Für Leben lassen sich viele Synonyme finden. Eines davon - ich glaube eines der Wichtigsten - ist Suchen, ins Dunkel Licht bringen, um mit den Dingen sich selbst erkennen zu können. Ja, leben wollte ich endlich aus eigener Erfahrung, eingreifen in dieses schmerzlich-lustvolle Spiel um das Geheimnis des Daseins, das wir bei aller Fortschrittsgläubigkeit wohl nie völlig lösen werden. Der Leistungssport hätte mich doch nur einem Bild gleichgemacht, das nicht mein eigenes war.
Читать дальше