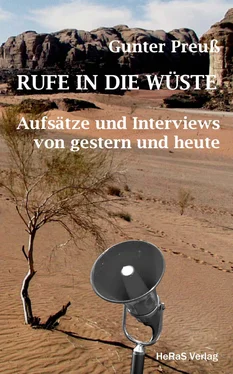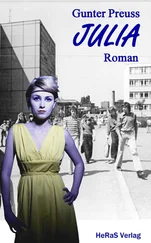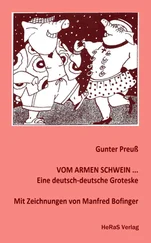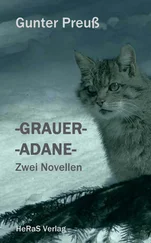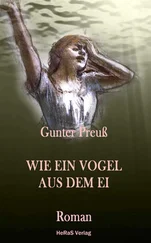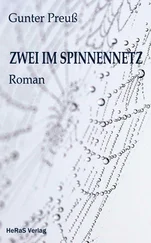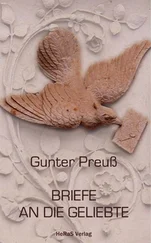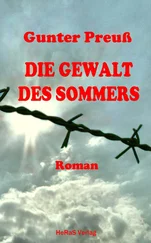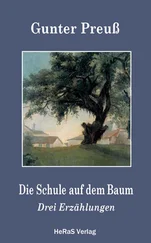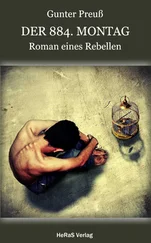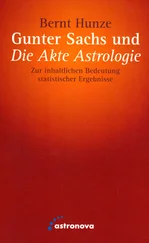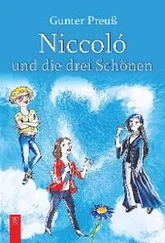Wenn ich heute meine bisherige literarische Arbeit betrachte, würde ich davon nur noch wenig gelten lassen. Das Gefühl der Sicherheit im Beruf habe ich nicht. Ich hatte es in meinem Beruf als Fernmeldetechniker. Wenn ich dort nach der Arbeit nach Hause ging, wusste ich, was ich geleistet hatte, und es war ein gutes Gefühl in mir, das ich heute neidvoll herbeisehne. Ich möchte eines Tages ein Buch auf den Tisch legen können, wozu ich unabhängig von der Meinung anderer sagen kann: „Hier hast du gegeben, was du konntest. Du hast rausgeholt, was in dir war. Und es ist gut so.“ Vielleicht lässt die Beschäftigung mit der Kunst so ein Gefühl überhaupt nicht oder nur für kurze Zeit zu, weil ja gerade Unruhe und Zweifel ihre treibende Kräfte sind und sie sich weniger der Schönheit als vielmehr der Wahrheit verpflichtet sieht. Und wenn es nur eine gute Stunde der Übereinstimmung des Anspruchs mit der Verwirklichung ist - dafür will ich arbeiten, für dieses Aufgehobensein in sich selbst. Das wäre so ein Augenblick, wo man mit dem Auge Schiwas auf den eigenen Grund gesehen hätte und keinem Trugbild verfallen wäre. Ich würde also nicht nach dem Alter eines Autors oder dem Umfang seiner literarischen Arbeit fragen, sondern in erster Linie nach ihrer Qualität.
Die Generationsproblematik muss ja immer wieder herhalten, wenn wir uns mit dem Benennen eines Problems und erst recht mit seiner Aufarbeitung schwer tun. Ich sehe in ihr ein sich wiederholendes, für die Kunst notwendiges Grunderlebnis, das die Vor- und Nachgeborenen, also auch die jungen und alten Autoren gleichermaßen betrifft: Ein Suchender ist losgegangen und hier und da angeeckt, es kommt also zu vielgestaltigen Berührungen. Er verspürt Schmerz oder Freude (all die zahlreichen Nuancen, die dazwischen liegen), und über die formuliert er nun mit seinen künstlerischen Mitteln das Ereignis seines Anstoßes und schafft da herum eine Geschichte.
Und diese Ereignisse des Anstoßes wiederholen sich durch die Jahrhunderte. Sie waren und sind die Liebe, der Krieg, die Lüge, der Tod, das Verhältnis zwischen Geist und Macht, die Glückssehnsucht ... Es gibt eigentlich sehr wenige Grundthemen für die Kunst, und doch sind sie so unendlich vielfältig und in ihrer Fülle nie zu bewältigen, wenn eben der Künstler sich in den Mittelpunkt seiner Zeit stellt und Welt durch sich gehen lässt. Dann wird er das Leben lieben müssen und verstehen wollen, er wird um die Welt leiden und für ihr Bestehen und ihre Entwicklung kämpfen. Dabei wird er die ewigen Themen, schon so oft und so meisterhaft gestaltet, neu sehen und vielleicht - wenn er ein Meister ist - der Erkenntnis etwas hinzufügen können.
Ich denke, der Generationskonflikt wird auch dazu benutzt, Unzufriedenheit mit sich selbst und den anderen auszutragen, zum Beispiel, weil der eine eben die Welt nicht so sieht und sie so beschreibt, wie der andere das gern hätte. Es fehlt oft an notwendiger Toleranz, die Meinungen verhärten sich, es entsteht ein „Generationskonflikt“. Ich sehe da einen ganz anderen Generationskonflikt, in mir selbst, wenn Jugend an das Alter stößt, wenn das Wollen und die Erfahrungen sich reiben, wenn das unbändige Drängen sich in einen notwendigen Raum gesetzt fühlt, wenn der eine den anderen der Feigheit und Anpassung, und der andere den einen der Blindheit und Maßlosigkeit beschuldigt. Das halte ich für normal im Prozess menschlichen Reifens. Die Gegensätze begegnen sich wieder und wieder, sie reiben sich aneinander, sorgen für den Fluss der Bewegung.
In diesem Prozess der Selbstfindung und Selbstverwirklichung in Auseinandersetzung mit sich und der Umwelt stößt man aber doch an äußere und innere Grenzen?
Alles in mir wehrt sich gegen Grenzen, äußere wie innere. Eine Grenze ist ein Maß, das notwendig ist, um die Dinge erfassen und bewältigen zu können. Innerhalb dieser Grenze ist Lebensraum, und wenn ich mir den zu eng und undurchlässig abstecke, laufe ich zunehmend Gefahr, mich zu isolieren, keine neuen Lebensräume zu entdecken. Ich kann somit nicht mehr in eine sich erweiternde Umwelt hineinwachsen, muss mich beschneiden, in einer Form halten, die mich mit der Zeit schwächt und schließlich verkümmern lässt. Die Frage ist doch: Was kann ich tun, dass ich meine Grenzen erweitern kann, ohne dass ihre Öffnung nach außen mir eine existenzielle Gefährdung bringt? Wenn ich auf eigene Entwicklung bestehe, bleibt mir nichts anderes übrig, als das Risiko einzugehen, im Prozess des Wachsens womöglich zu scheitern. Davor sind nichts und niemand gefeit. Das Leben kann nun mal auf „Reibungen“ nicht verzichten, die für eine schier unendliche Vielfalt sorgen, aber auch kleine und große Katastrophen mit sich bringen.
Wir sind eine junge Gesellschaft. Das Wachsen und Reifen - wer erfährt es nicht an sich selbst und an seinen Kindern - ist ein langer, schwieriger und oft widersprüchlicher Prozess. Dabei müssen wir der Ungeduld Geduld abverlangen und umgekehrt. Wir propagieren einen in seinem Denken und Handeln sich frei bewegenden Menschen, der die Idee des Sozialismus mit Inhalt erfüllt. Das aber kann ein Mensch nicht erreichen, wenn er nicht Stück um Stück seine Grenzen hinausschiebt. Nur so erobert er sich seine Welt, trägt er seine Idee in sie hinein und setzt sie in Leben um. Wir haben mit unserer Gesellschaftsordnung für jeden Bürger die materiellen Grundvoraussetzungen eines menschenwürdigen Daseins geschaffen. Viele von uns leben gar im Überfluss. Jahrzehnte harter Arbeit - Auferstanden aus Ruinen ... - haben uns wieder auf die Beine gebracht. Im Erreichten liegen zwei verschiedene, einander ausschließende Möglichkeiten: Entweder ich benutze die Gesundung des Körpers zur Entfaltung des Geistes (der nicht mehr hungernde und frierende Mensch erschließt sich seine eigentliche Welt, die der Kultur und Schönheit), oder aber ich füttere mich satt und fett, dass der überdimensionierte Körper den Geist lähmt und sich nur noch zur Erhaltung seines Übergewichts anstrengt.
Zu wenige unserer Menschen gehen den ersten, den beschwerlichen, den risikoreichen, wohl aber einzigen Weg zum Menschsein. Zu viele noch bringen nur ihr Korn ins Trockene, füttern sich und die Ihren, bis es ihnen die Augen und Ohren zudrückt und sie blind und taub werden gegen die anstehenden Probleme unserer Zeit. Vor Jahren hatten wir den Mund vollgenommen mit dem Wort „Menschengemeinschaft“. Nach der ersten Euphorie haben wir angefangen, es zu bewitzeln, seine Inhaltsschwere ist uns bewusst geworden, die kaum lösbare Aufgabenstellung und hohe gegenseitige Verantwortung. Heute sprechen wir kaum noch davon. Dabei ist es ein schönes, wichtiges, ein so hoffnungsvolles Wort, das im Sprachschatz eines Sozialisten immer eines der ersten Wörter sein sollte. Ich denke dabei an Hermann Hesses Morgenlandfahrer, die trotz vielfältiger Unterschiedlichkeit gemeinsam ihrer Idee von der Verwirklichung eines Menschenlebens nachgehen. Diese Morgenlandfahrer müssen immer wieder Grenzen überschreiten, eigene und fremde, sie sind Suchende, die ihren Glauben in die Welt tragen. Darin allein sehe ich den Sinn des Menschseins, der unsere Hoffnung nicht mehr in ein himmlisches Paradies verweist, sondern im Spielraum Erde belässt. Darum auch muss ich mich aus dem Druck ständig wachsender materieller Wünsche befreien, die mich nur in neue Zwänge setzen und die Entfaltung meines Geistes und die Umsetzung meiner Idee blockieren. „Sozialismus schaffen“ ist eine Morgenlandfahrt, der Weg vom Ich in die Gemeinschaft. Dabei entsteht nicht der Verlust von Ich, sondern vielmehr auch ein Gewinn an Individualität.
Tritt eine Generation anders an dieselbe Wirklichkeit heran?
Ja. Und das ist gut und richtig so. Die jungen Leute nehmen das von ihren Eltern Erreichte als das Gegebene, das sie oft erst einmal in Frage stellen und vielleicht ganz oder aber zum Teil ablehnen. Die jungen Leute wollen es anders, ja, besser machen. Sie wollen sich selbst einbringen. Das ist ihr gutes Recht und nur zu unterstützen. Aber sie müssen das Maß finden, müssen lernen, sich in den Geschichtsprozess einzuordnen. Sie sollen ja nachwägen, was ihre Väter und Mütter auf die Waage gelegt haben; aber es darf nicht nur bei ihrer Kritik oder der Ablehnung bleiben, sie müssen dem Erreichten selber etwas hinzufügen, nämlich ihren Anteil. Und den werden sie dann von ihren Kindern kritisch abwägen lassen müssen. Und so weiter und so fort. Will ich den großen Wagen „Sein“ bewegen, muss ich mich neben all den anderen an seiner Deichsel in ein Joch bringen und meine Kraft und Ungeduld im Sinne des gemeinsamen Vorankommens zügeln lernen. Nur vereint mit den Mitziehenden kann sich meine Kraft vervielfachen.
Читать дальше