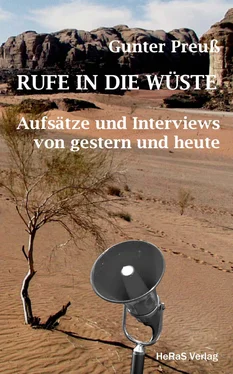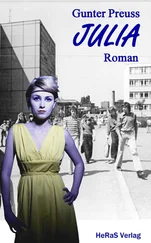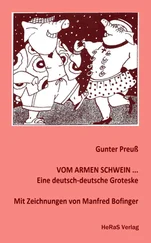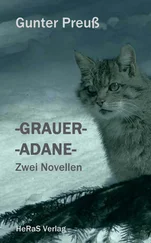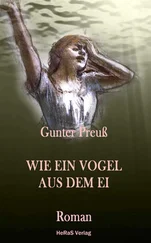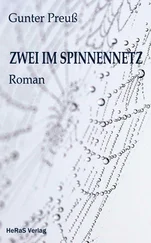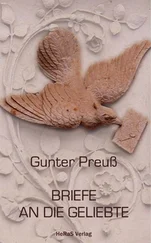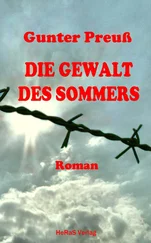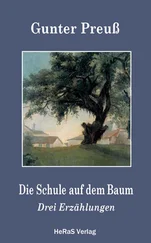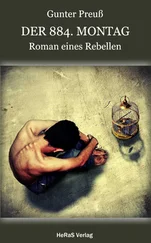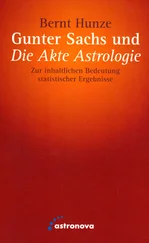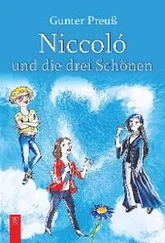1 ...7 8 9 11 12 13 ...24 Angelockt von der Weite und vom Abenteuer - eigentlich wollten wir ja auf Jack Londons Spuren in die Südsee - blieb ich mit einem Freund in Ostberlin an der „Fachschule für Artistik“ hängen. Mit der vielgestaltigen Bewegung lockten Glanz und Flitter von Zirkus und Varieté, der Salto mortale, die große Geste, der dankbare Beifall. Aber es ging um viel mehr in dieser Zeit. Ich war in das gespaltene Berlin wie in einen Vulkan hineingeraten. Der Mutterwelt entkommen, war mir das Draußen plötzlich zu groß und zu verwirrend geworden. Und es gab nicht nur diese eine Welt, es gab zwei Welten, eben das hüben und drüben, den Osten und den Westen, die so gegensätzlich waren und sich befeindeten. Es galt für uns junge Menschen, sich zu entscheiden, für die eine oder die andere Seite. Ein gesellschaftliches Zuhause musste gefunden werden. Wir pendelten hin und her, uneins mit uns und diesen beiden Lagern, die ja auch die Spaltung der gesamten Welt anzeigten, und von der uns jedes sein Glück versprach. Lange konnte man in dieser Spannung nicht unbeschadet leben, es war wie ein Balancieren zwischen Feuer und Wasser auf dünnem Seil - ich musste endlich Boden unter den Füßen gewinne. Es gab also Hier und Drüben, und mancher von uns hatte sich für das Drüben entschieden. Meine Entscheidung für das Hier entsprach nicht einer ausgeprägten politischen Überzeugung, ich war ja gerade so achtzehn Jahre alt und in vielerlei Hinsicht noch unfertig.
Es war mehr eine Entscheidung des Gefühls als des Verstandes. Ich entschied mich für die Welt, die ich kannte; sie war mir zwar zu eng geworden, aber sie hatte mir auch Sicherheit und Geborgenheit gegeben. Ich glaubte, mich schuldig zu machen, wenn ich sie verlassen würde. Hüben hatte ich meine Freunde und Bekannten. Drüben wäre ich trotz aller Verlockungen allein gewesen, das scheute ich. Hier wollte ich weitersuchen. Der Spielraum der Artistik konnte nur den Körper bilden; ich fragte mich bald, ob denn das mit Trick und Geschick Sich-selbst-zur-Schau-stellen schon alles sei, was ich gewollt hatte? Eine schöne Form hatte ich gefunden, aber der Inhalt war doch nur eitler Tand.
Ein solches Gefühl des Unbefriedigtseins und des Sich-in-Frage-Stellens kennt wohl jeder, doch nicht jeder kommt zum Schreiben...
Suchen heißt für mich: Auf ein Ziel hin in Bewegung sein. Dabei erkennt mancher erst sein Ziel, wenn er sich schon geraume Zeit bewegt hat. Am Anfang meines Weges war da nur so eine Art Instinkt, eine Ahnung, ein Drängen auf etwas hin. Das musste erst aus dem Unterbewusstsein durch Bewegung ins Bewusstsein geholt werden. Nicht jeder, der sucht, fängt an zu schreiben. Aber er wird Mittel und Wege finden müssen, um in diese Bewegung zu kommen, die ihn seinem Ziel näher bringt. Dabei spielen die Künste und Wissenschaften als Wegbegleiter eine große Rolle. Sie eröffnen dem Sucher unendlich viele Spielräume, dass er manchmal Gefahr läuft, sich darin zu verlieren. So ist der Sucher auch immer ein Gefährdeter, weil er auch Wege gehen muss, die noch niemand vor ihm gegangen ist. Und wenn er in die Irre geht oder seine Wege nicht bald zu grünen und Früchte tragenden Inseln führen, hat er alle gegen sich, die ihm vielleicht gefolgt sind, weil sie selbst zu schwach, zu träge, zu feig oder auch behindert waren, um auf eigenem Weg zu gehen.
Das Suchen scheint mir der Menschen Bestimmung zu sein. Es ist unsere Chance, unser Dasein wahrzunehmen, in flüchtigen Augenblicken Glück zu spüren, um wieder an sich glauben zu können und Mut für Neues zu haben. Eine sozialistische Gesellschaft muss den Menschen das Suchen ermöglichen, dass sie aufkommen von ihren sicheren Stühlen, Gleichgültigkeit und Furcht überwinden. Die Verantwortung ist nicht wegzudelegieren, ohne sich selbst, ohne die Gesellschaft aufzugeben. Es geht immer wieder ums Besinnen auf die einmaligen Ich und Du, die das Wir ausmachen, das mit seiner revolutionären Kraft und seinen Möglichkeiten der Umgestaltung oft schon ins Vergessen geraten ist. Wir alle haben unsere Enttäuschungen und vielleicht auch Verletzungen erfahren; aber es erscheint mir ein katastrophaler Irrtum, das Suchen an „die da oben“ abgeben zu wollen. Denn „die da oben“ sollen „die da unten“ sein und umgekehrt, so sind wir doch angetreten; das sollte keiner vergessen, dem es ums Suchen, ums Erfahren und Erkennen, dem es um Sozialismus geht.
Und wie ging es mit dir weiter? Wie kam es, dass du zur „Feder“ griffst?
Im Artistenberuf fühlte ich mich alleingelassen, dabei körperlich über- und geistig unterfordert. Und die geteilte Stadt, ihr beiderseitiges Werben, ihr überfallartiges Anziehen und Abstoßen, diese zwei Schreie nach Leben, diese immer mehr ins Böse hineinwachsende Wunde inmitten Deutschlands, das es ja so nicht mehr gab, hatte bei mir Wirkung gezeigt. Die Probleme häuften sich für mich, ich konnte sie nicht mehr ordnen und durchschaute sie nicht mehr. Das führte zu Depressionen und Ängsten, die mich in ärztliche Behandlung und schließlich zur Aufgabe des Artistenberufes zwangen. Ich kehrte nach Leipzig zurück und arbeitete wieder in meinem erlernten Beruf als Fernmeldemechaniker, der mich in ein funktionierendes Kollektiv brachte. Wir waren zehn Kollegen mit unterschiedlichsten Denk- und Verhaltensweisen, die uns aber nicht auseinander, sondern einander nahe brachten, weil wir immer im Gespräch miteinander blieben. Hier habe ich Mut und Sicherheit zu den ersten Schreibversuchen gefunden. Am Anfang war da nur ein Wust an unverarbeiteten Gefühlen, die mich zu erdrücken drohten. Das brachte ich erst einmal „unverarbeitet“ zu Papier. Schreiben schafft Distanz zu sich selbst und zu den Dingen. Später kristallisierten sich Fragen heraus, die auf Antwort drängten. Fragen nach meinem Standort und meinem Befinden in der Welt. Losgegangen war ich ja schon früher, aber jetzt war ich ein Suchender geworden und hatte (vielleicht) einen Weg gefunden, der mich mir selbst und den anderen näher bringen würde. Und ich glaubte leidenschaftlich an mich, wie man wohl nur mit Anfang zwanzig an etwas glauben kann.
Heute, unterwegs in den Vierzigern, muss ich manchmal über diesen Zwanzigjährigen lächeln, über sein Stürmen und Drängen, eine glückvollere Welt aus eigener Kraft über Nacht zu erschaffen. Inzwischen weiß ich manches besser; aber ich habe ihn gern diesen jungen Freund, und ich freue mich, wenn ich ihm in den heute Zwanzigjährigen wiederbegegne.
In einem Gespräch polemisiertest du einmal mit einem deiner Kollegen, der gesagt hatte: Wer sich selbst in den Mittelpunkt der Welt stellt, wird die Welt nie erkennen. Du hieltest dagegen, dass man sich gerade in den Mittelpunkt der Welt stellen müsse, um die Welt erkennen zu können. Darüber nachdenkend scheinen mir die beiden Positionen so konträr nicht zu sein, denn sicher hast du nicht gemeint, sich selbst zum Maß aller Dinge zu machen, sei eine für die Wahrheits- und Erkenntnisfindung notwendige Bedingung für das Schreiben. Was heißt für dich heute konkret „sich in den Mittelpunkt der Welt stellen“, welche Konsequenzen und Verantwortlichkeiten ergeben sich daraus für deine schriftstellerische Arbeit?
Als Wesen, das sich denkend und fühlend in der Welt bewegt, nehme ich Mittelpunkte mit, wohin ich auch gehe. Ich empfinde Welt und nehme sie auf. Und ich gebe auch wieder von ihr ab. Wo gelebt wird, da sind ständiges Geben und Nehmen. Der Künstler nimmt das wohl nur bewusster wahr, da er in seiner Arbeit auf sein Weltempfinden angewiesen ist. Das ist sein Material, damit muss er verantwortlich und zugleich poetisch umgehen. Aus solcher Auffassung ergibt sich natürlich eine Konsequenz: Trage ich meinen Mittelpunkt in die Welt, dann muss ich die sich ergebenden vielen Beziehungen aufnehmen, ich muss selbst aktiv werden, kann nicht nur fordern, muss selbst etwas tun, Stellung beziehen. Stehe ich also immer im Mittelpunkt der Welt, bin ich auch immer in der Verantwortung. Ich bin nie entschuldigt. Muss meine Augen und Ohren immer offen halten. Kann nie meine Seele verschließen. Das ist schwer. Das zehrt an der Lebenskraft; das lässt aber auch neue erschließen. In diesem Sich-in-den-Mittelpunkt-stellen liegt das ganze weiträumige und engmaschige Beziehungsfeld zwischen Individuum und Gesellschaft. Nennen wir es das gegenseitige Voneinander-betroffen-sein. Die Gesellschaft ist der Körper, der auf das Ich, die Seele und den Geist reagiert. Und natürlich reagieren Seele und Geist auch auf den Körper. Sie streben nach Einheit. So entsteht individuelles und gesellschaftliches Leben. Es wird sich immer auf der Stufe befinden, auf der Individuum und Gesellschaft, also Geist und Körper, eine Einheit bilden oder nicht. Und die Aufgabe der Künste ist es, diesen Stand herauszufinden und vielleicht einen Weg zu weisen zu größerer Einheitlichkeit.
Читать дальше