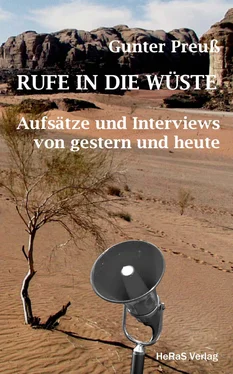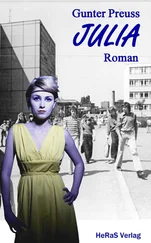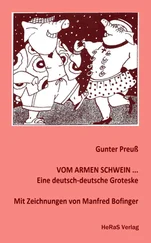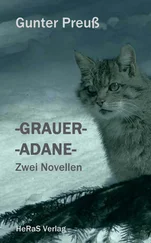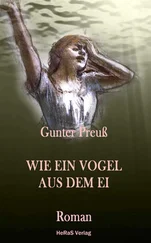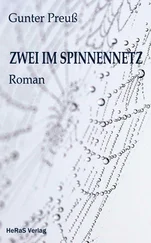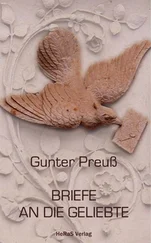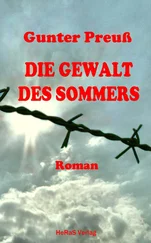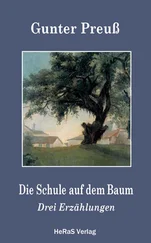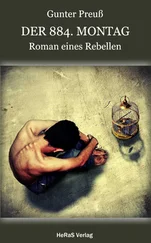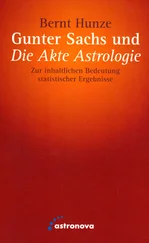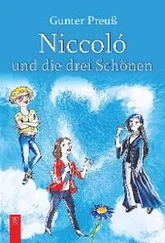Gunter Preuß - Rufe in die Wüste
Здесь есть возможность читать онлайн «Gunter Preuß - Rufe in die Wüste» — ознакомительный отрывок электронной книги совершенно бесплатно, а после прочтения отрывка купить полную версию. В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: unrecognised, на немецком языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:Rufe in die Wüste
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:3 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 60
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Rufe in die Wüste: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Rufe in die Wüste»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
Rufe in die Wüste — читать онлайн ознакомительный отрывок
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Rufe in die Wüste», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
Einer meiner Kollegen sagte: „Wer sich selbst in den Mittelpunkt der Welt stellt, wird die Welt nie erkennen.“ Ich meine, man muss sich gerade in den Mittelpunkt der Welt stellen, um sie erkennen zu können. Nur von dem, was man selbst gesehen, berührt, gefühlt und durchdacht hat, was uns also eigen geworden ist, kann man „verarbeitet“ dann auch wieder zurückgeben. Erst einmal bezieht man doch alles auf sich selbst, und erst im Lauf des Lebens lernt man Abstand zu gewinnen, zu konzentrieren, zu sortieren, um nicht an der Vielfalt zu scheitern oder sich durch allzu große Nähe den Blick zu verstellen.
Die Welt kann man nur bessern, wenn man sich selbst bessert. Und sich selbst bessern kann man nur, wenn man an sich arbeitet. Und an sich arbeiten kann man nur, wenn man sich nicht als fertig und gegeben nimmt, sondern sich mit sich selbst auseinandersetzt. Ich denke, dass gerade die Beschäftigung mit den Künsten, die ja vom Künstler eine ausgeprägte Individualität, also Eigenständigkeit und Unverwechselbarkeit, verlangt, ohne Egoismus nicht auskommt, in dem der Künstler vieles zurückstellt, das seiner Arbeit, die ihm ja zugleich Berufung ist, hinderlich ist. Sonst hätten ja die recht, die sagen, es ist in den Künsten eh schon alles meisterlich gesagt, gemalt und komponiert worden und alles Dazukommende könne doch nur eine Kopie sein. Ja, die Themen sind immer wieder dieselben, die Probleme auch, sie lassen sich an einer Hand abzählen, aber die Menschen sind neu, und ihr ganz persönliches Erleben von Welt, in deren Mittelpunkt sie sich gestellt haben, findet dann auch einen ganz eigenen künstlerischen Zugang zu den Menschen und Dingen. Darum kann ich auch die Eifersüchteleien unter Kollegen nicht verstehen; sie können sich gar nichts wegnehmen, sie arbeiten zwar alle mit demselben Stoff, aber das, was dabei entsteht, kann unterschiedlicher nicht sein.
Ihre Frage nach dem Optimismus, der ja in der Tat oft ein Scheinoptimismus ist, stellen Sie an einen eingefleischten Pessimisten. Und dennoch begehre ich beständig gegen meine Unbekehrbarkeit auf, das hält mich am Leben und Schreiben. Aber wenn ich auch selbst in der Negation versinken würde, nähme ich mir nicht das Recht, andere in mein Dilemma hineinzuziehen. Ich muss ja kein Komödienschreiber sein, um selbst in tragisch angelegten Geschichten eine lebensbejahende Haltung erkennbar werden zu lassen. Aber aller Scheinoptimismus ist mir im Leben wie in der Kunst zuwider, er verhöhnt das Dasein und verhindert jede positive Entwicklung. Der Optimismus hat ein Problembewusstsein, er begründet sich im Pessimismus, wie das Komische im Tragischen seine Wurzeln hat. In diesem Sinn darf ich mich und meinen Protagonisten Muzelkopp wohl als Optimisten sehen.
Wir haben über eine Reihe inhaltlicher und biografischer Voraussetzungen für Ihr Stück gesprochen. Wir sollten jetzt überlegen, welche künstlerischen, vielleicht auch handwerklichen Voraussetzungen erforderlich oder vorhanden waren, um sich an ein solches Stück zu wagen. Immerhin ist ja zu berücksichtigen: Es handelt sich um Ihr erstes Stück für das Theater, nicht aber um Ihre erste dramatische Arbeit überhaupt. Welche Arbeiten in anderen dramatischen Bereichen gingen voraus, und was hat sich von da an Kenntnissen, an Erfahrungen auf das Theaterstück anwenden lassen?
Von einem gewissen, wenn auch begrenzten Nutzen für die Theaterarbeit ist für mich das Hörspiel. Ich habe mehrere Hörspiele für Kinder und Jugendliche geschrieben, dabei habe ich gelernt, auf das erzählende Moment zu verzichten und mich auf Dialoge zu beschränken, was ja nicht gleich Verlust bedeutet. Für das Fernsehen habe ich nach einer meiner Erzählungen ein Treatment und Drehbuch erarbeitet, das dann auch verfilmt wurde. Der Film hat ja nun wieder seine ganz eigene Spezifik. Im Grunde bin ich wohl ein Prosaschreiber, mir reicht der Dialog oft nicht, um das auszudrücken, was ich sagen will. Beim Film mag das angehen, dort schlage ich ja zum Dialog auch Bilder vor. Aber für das Theater kann ein Erzähler tödlich sein, es braucht die Leerstellen im Dialog, um die Schauspieler spielen zu lassen. Am Theater muss wohl weniger gesagt und mehr gezeigt werden, und wenn der Autor seinen Text abgeliefert hat, braucht es ihn nur noch als Zuschauer. Zu meiner ersten Arbeit für das Theater ist es ja auch mehr zufällig gekommen. Als erstes stand die Erzählung, ich fuhr in die Ferien und langweilte mich, wollte die Prosaarbeit in ein Hörspiel umsetzen. Ich schrieb also Dialoge, und dann dachte ich, das könnte doch auch für das Theater passen.
Das war natürlich genau der Eindruck, den wir als Theaterleute beim ersten Kennenlernen des Stückes auch hatten: Ein Stück voller Dialoge. Und zwar voll nicht nur vom Anteil des Dialogs am Gesamtgeschehen her, sondern auch im Hinblick auf den Umfang. Das Stück hatte ursprünglich ungefähr 130 Seiten, und zwar durchweg Dialog. Nun ist das Dialogschreiben ganz gewiss eine der ersten Proben, die ein Schriftsteller bestehen muss, der für das Theater schreiben will. Insofern ist Dialog eine Grundvoraussetzung, allerdings eine, die allein dann wieder nicht ausreicht. Wo haben Sie im Laufe der Arbeit über den Dialog hinaus die größten Schwierigkeiten gehabt, „theatergerecht“ zu arbeiten, also von der Prosa auf das Stück zu kommen? Vom Dialogschreiben hin zum szenischen Gestalten.
Ich kannte das Theater ja nur als Zuschauer. Und als solcher schrieb ich auch den Text, was ziemlich flüssig vonstattenging, da ich ja mit der Erzählung eine Vorlage hatte. Die Schwierigkeiten fingen mit unserer Zusammenarbeit an, als mir die Dramaturgie des Leipziger Theaters sagte: „Wir werden mit Ihnen an dem Stück weiterarbeiten.“ Einesteils war ich froh über das Interesse an meiner Arbeit, andererseits dachte ich mir: Was wollen die eigentlich? Sie brauchen es doch nur noch auf die Bühne bringen.
Erst im Verlauf der Zusammenarbeit, mit dem Blick hinter die Kulissen sozusagen, bekam ich eine Vorstellung, was denn Theater eigentlich ist und wie es „gemacht“ wird. Anfangs ist mir die Teamarbeit schwergefallen, ich war ja die Einsamkeit am Schreibtisch gewöhnt; andererseits gefiel mir die Auseinandersetzung um eine gemeinsame Sache, die jeder auf seine Weise auf die Bühne bringen wollte. Allein hätte ich wohl aus den Dialogen kein aufführbares Stück zustande gebracht. Da waren gerade auch Sie mit all ihrer Theatererfahrung ein geduldiger, aber unnachsichtiger Lehrmeister. Es ist in der Tat nicht einfach, vom Zuschauer zum Mitwirkenden zu werden.
Wäre es möglich, jetzt an dieser Stelle zu sagen, worin die vom Theater geforderten, dann mit dem Autor abgesprochenen und letzten Endes zwischen beiden vereinbarten Veränderungen bestanden, die vom ersten Manuskript, was Sie ganz allein gemacht hatten und was dann im Theater vorlag, sich vollzogen bis zum endgültigen, dann aufgeführten Stück? Wo lagen diese wesentlichen Veränderungen?
Es gab eine Vielzahl von Einwänden, die dann eben auch Veränderungen nach sich zogen. Im Wesentlichen ging es um das Begreifen des Autors, dass das Theater eben seine eigenen Gesetze hat, die sich zur Prosa manchmal geradezu diametral verhalten. Das erste Problem hatten wir mit der Länge des Stückes. Das Manuskript hatte 130 Seiten, war also viel zu lang. Ich hatte mir darum keine Gedanken gemacht, wie ich auch beim Schreiben von Erzählungen und Romanen nicht vorher die Seitenzahl festlege. Nun ist das Kürzen, das Verdichten, das Auf-den-Punkt-bringen, damit Leerstellen entstehen, die dem Rezipienten genügend Raum zur Mitarbeit lassen, für jedes Genre der Literatur eine unverzichtbare Arbeit. Aber hier ging es nicht nur darum Text zu streichen, sondern herauszufinden, was alles nicht gesagt werden musste, um „vorgeführt“, also gezeigt werden zu können. Mir tat es schon weh, gelungene erzählende Passagen herauszustreichen und das freie Feld dem Regisseur, Bühnenbildner und den Schauspielern zu überlassen. Ich erlebte das anfangs wie einen Kampf – der allmächtige Prosaautor gegen eine aufmüpfige Theatergruppe, die mir meine „Schöpfung“ aus der Hand nehmen will. Da gab es im Text Personen, die im späteren Verlauf der Handlung auftauchten, ohne jede vorherige Funktion. In einer Erzählung ist das in zwei, drei Sätzen erklärt, im Stück fragt man sich: Wo kommt der plötzlich her? Am ehesten ist ein Theaterstück mit einer Kurzgeschichte zu vergleichen, wo nach Tschechow das Gesetz gilt: „Wenn auf der ersten Seite eine Flinte an der Wand hängt, muss sie am Schluss losgegangen sein.“ Mein Problem lag also nicht im Hinzuerfinden, sondern im Weglassen, um die Balance zwischen so wenig wie möglich und soviel wie notwendig an Sprache zu finden. Auch ein paar mir lieb gewordene Personen musste ich im Verlauf unserer Zusammenarbeit über den Jordan gehen lassen, wobei Platz geschaffen wurde, um die Charaktere und Lebensläufe der „Überlebenden“ zu vertiefen. Firat, der Meister zum Beispiel, ist eine ganz andere, tiefere Figur geworden. Ursprünglich hatte er die Rolle des Bösen zu verkörpern, einer, den die gesellschaftliche Anpassung verkrümmt hat, der jedes Problem fürchtet und seine Brigademitglieder vor der „Obrigkeit“ ducken lässt und vor allem auch den neu hinzugekommenen Muzelkopp unterkriegen will. Man wusste nicht so recht, warum er so war, wie er nun ist. Er bekam seine differenzierte Lebensgeschichte, aus dem Bösen wurde kein Guter, er bewegt sich wie wir alle dazwischen, und wer ihn sieht und ihm zuhört, der wird ihn, wenn auch mit Widerspruch, akzeptieren können.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «Rufe in die Wüste»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Rufe in die Wüste» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «Rufe in die Wüste» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.