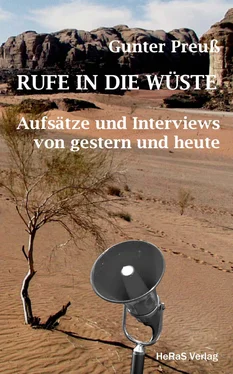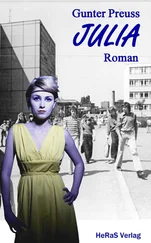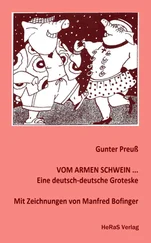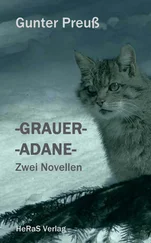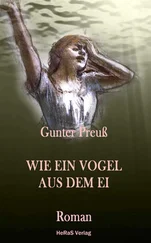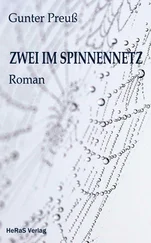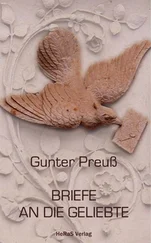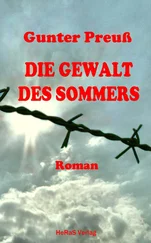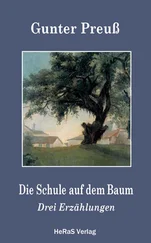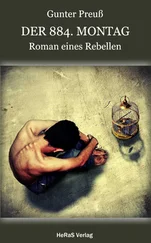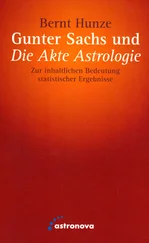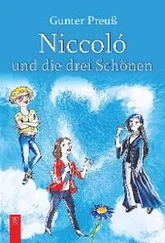Ich war auf der Suche nach dem Abenteuer, wo ich zum Bestehen all meinen Mut und meine ganze Kraft einsetzen musste. Meinen Freund und mich trieb es auf den Güterboden: täglich achtstündiges Karren der schweren Kisten aus den Waggons über die Rampe in die Lastkraftwagen oder umgekehrt. Die Kollegen waren schwere Jungs mit krimineller Vergangenheit, Studenten, die ein paar schnelle Mark machen wollten, und die „Politischen“, Akademiker, die von der Uni zur Arbeiterklasse strafversetzt waren, um ihr mangelndes sozialistisches Bewusstsein zu stärken. Es gab täglich verbale Auseinandersetzungen, aber auch Schlägereien und einmal sogar eine Messerstecherei. In der Nachtschicht erzählte uns ein Alter immer wieder Geschichten aus dem 2. Weltkrieg, wie er da noch „wirklich gelebt“ hätte, wie sie in Frankreich den Champagner wie Wasser getrunken und mit den „Madams“ die Nächte verbracht hätten. Der Bahnhof atmete Welt, die Ferne lockte uns, in den Waggons roch es nach Menschen und Dingen, die wir nicht kannten, aber um jeden Preis kennenlernen wollten.
Nun verstehe ich Abenteuer nicht ganz an dieser Stelle. Ich verstehe, dass Sie dort eine feinmechanische Arbeit verlassen haben und jetzt eine etwas gröbere, aber vielleicht abwechslungsreichere suchten. Spielte der Gedanke dabei mit an herumfahren, rauskommen?
Ja, das Rauskommen. Das Fernmeldeamt war ja ein abgeschlossenes Haus, für uns eine Art Gefängnis. Man trat an die Pforte, zeigte den Ausweis, durfte eintreten und musste nun acht Stunden drin bleiben, gleichgültig, was in der Welt auch passierte. Es war aber auch die Monotonie der Tätigkeiten, der ganze bis ins Detail festgelegte Tagesablauf, der uns lustlos und auch aggressiv machte. Auf dem Güterboden hatten wir ein Stück Himmel über uns, von dem wir wussten, dass er unendlich war. Und dann die Züge, ihr Ankommen, das kurze Verschnaufen und ihr Fortfahren, der schrille Pfiff der Lokomotive, die hoch aufschießende Dampffontäne, das Stampfen der Räder, wie sich der schwarze Koloss aus dem Stillstand befreite und langsam, aber kraftvoll in Fahrt kam - das machte Hoffnung auf das Gelingen der eigenen Befreiung.
Während Ihrer Schilderung fiel mir noch etwas auf. Sie haben in Berlin während der Zeit der Artistenschule heimlich Vorlesungen besucht. Das ist nicht üblich. Gab es dafür Gründe, die in der Person der Vortragenden oder in der Sache gelegen haben? Wenn ich Philosophie und Germanistik höre, scheint mir die Sache eine Rolle gespielt zu haben. Können Sie nachträglich ein Motiv namhaft machen, warum Sie dorthin gegangen sind und nicht in die Anatomie?
Es war nicht der Grund, dass etwa ein prominenter Wissenschaftler bestaunt werden sollte. Wir junge Leute waren an dieser „Kunststückchenschule“ körperlich oft überfordert und geistig einfach unterbeansprucht. Man hätte keinen von der Schule entfernt, wenn er in den theoretischen Fächern schlecht, aber in der Artistik zu gebrauchen gewesen wäre. Bei diesem dürftigen geistigen Angebot suchten eben einige von uns nach Möglichkeiten, um ihren Wissensdurst zu stillen. Das fortwährende Pendeln zwischen den Welten, der tägliche Kampf ums Überleben mit sechzig „Ostmark“ Stipendium im Monat, die Unzufriedenheit mit der allgemeinen Mangelsituation an der Schule, das alles warf viele Probleme auf. Die illegale Vorlesungsteilnahme an der Uni und die erschlichenen Besuche bei geistig-kulturellen Höhepunkten – wie die um die Osterzeit von Konwitschny dirigierten „Brandenburgischen Konzerte“ oder die Neuinszenierung eines Brechtstücks am „Berliner Ensemble“ - waren da wohl eine Art Notwehr. Es kam aber auch zu ziemlich handfesten Aktionen. Wir litten ja unter ständigem Geldmangel, die Internate und die Trainingsräume waren in schlechtem Zustand, für eine Verpflegung war nicht gesorgt. Der Sekretär der „Freien Deutschen Jugend“, der sich hätte für die Belange seiner Kommilitonen einsetzen sollen, hatte sich nach drüben abgesetzt. Mehr aus einem Ulk heraus wurde ich gewählt, nahm aber dann doch die Funktion ernst. Bald darauf haben wir, eine schnell zusammengestellte Delegation von Studenten, das Kulturministerium „gestürmt“. Wir sind auf heute recht abenteuerlich anmutende Weise bis ins Büro des Ministers vorgedrungen. Und man hörte uns an. Wir erzählten haarsträubend wahre Geschichten: wie ein Mitstudent vor Hunger vom Trapez gefallen war; dass wir uns in den Ruinen mit Luftgewehren der „Gesellschaft für Sport und Technik“ Wildtauben schossen und von den Mädchen braten ließen; dass bei Regen der obere Schlafsaal unter Wasser stand und es in der Schule wie im Raubtierhaus roch, weil keine Duschen vorhanden waren. Man gab uns zu verstehen, dass das alles nach einer Medienlüge des Klassenfeindes röche. Aber ein paar Tage danach kam der Minister persönlich in die Schule, und ein Vierteljahr später veränderte sich vieles zum Positiven. Wir waren mächtig stolz auf uns; aber den Studenten des neuen Studienjahres waren unsere „Errungenschaften“ schon nicht mehr gut genug.
Haben solche Jugenderlebnisse für Ihr späteres Leben und Arbeiten eine Rolle gespielt?
Meine Weltanschauung hat sich im geteilten Berlin entscheidend geprägt. Man hatte uns ja in den Schulen gelehrt, dass im Kapitalismus das Wolfsgesetz vom Fressen-und-gefressen-Werden herrscht und sich alles Tun und Lassen um den Profit dreht, dass das kapitalistische Wesen amoralisch, ja, menschenfeindlich ist. Und täglich erlebten wir ja den Propagandakrieg zwischen Ost und West. Ich bin wohl eher ein Zweifler als ein Glaubender und mache mir gern selbst mein Bild von Menschen und Dingen. Im Alltag lernte ich nun selbst den Kapitalismus zwischen Verlockung und Abstoßung kennen. Wie schon erwähnt, wir waren ja fast täglich im Westteil der Stadt. Der Glanz und Flitter, mit all seinen Versprechungen ums Glück, lockten gerade die jungen Leute an. Zudem waren wir begierig auf Westgeld, der Kurs stand zeitweise eins zu sechs, also für eine Westmark konnte man sechs Ostmark tauschen, oder aber wir gingen am Gesundbrunnen ins Kino und natürlich musste eine Markenjeans her. Vielleicht sagt aber ein kleines „Lehrstück“ mehr, als alle Erklärungsversuche. Wir haben abends und manchmal bis in die späte Nacht in Westberlin Kegel aufgestellt. Das war eine mörderische Arbeit nach dem harten Training in der Schule und dem nicht ausreichenden Essen. Wir bekamen als „die aus der Zone“, die von den Kegelbrüdern als bedauernswerte Individuen aus dem „Kommunistischen Knast“ gesehen wurden, für die Stunde fünfzig Pfennige und für jede Neun, die gekegelt wurde, eine Limo spendiert oder einen Fünfziger dazu. Wir haben unsere Arbeitgeber, meist Arbeiter und kleine Angestellte, die zu uns durchaus, wenn auch von oben herab, freundlich waren, bei dieser Schinderei von Herzen gehasst. Sie kamen mit ihren Autos vorgefahren, aßen erst einmal ausgiebig, eine Runde veranlasste die andere, es wurde lärmend gewitzelt und eben auch fleißig gekegelt. Nun, wir hatten bald heraus, wie auch wir auf unsere Kosten kommen konnten. Wir befestigten jeden Kegel an einen schwarzen Zwirnsfaden, deren Enden wir in der Hand hatten. Nun bestimmten wir mit unserem Fadenzug, wo es lang ging. So viele Kegel waren hier nie zuvor gefallen, und bei jedem Ruf „Alle Neune!“ hatten wir fünfzig Pfennige mehr in der Tasche. Bis es dann herauskam und wir den Verein wechseln mussten. Bei mangelnden Westangeboten stellten wir dann auch im Osten auf, es war zwar nicht viel zu verdienen, aber wir waren hier Gleiche unter Gleichen.
Heute sind das Episoden. Ich glaube aber, dass man durch solche als Achtzehnjähriger mit viel Anteilnahme erlebten Dinge mitgeprägt wird. Erlebnisse, die einem Abiturienten vielleicht erspart bleiben, der ein geregeltes Ausbildungsprogramm absolviert. Dass Sie den geistigen Ausgleich suchten, ist klar. Sagen müssten wir noch, warum es gerade in diese Fachrichtung ging. Sie sprachen vorhin davon, der Sinn des Lebens habe Sie schon immer besonders beschäftigt. Hängt die Fachwahl damit zusammen, vielleicht auch mit besonderen Erfahrungen in Jugend und Kindheit?
Читать дальше