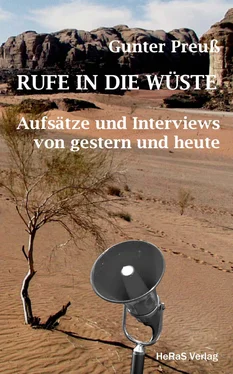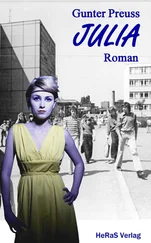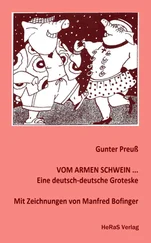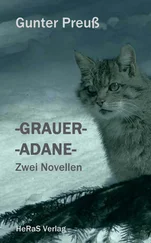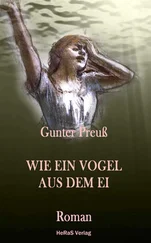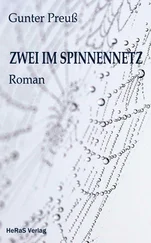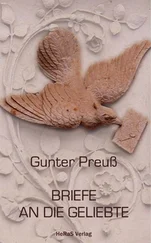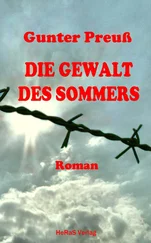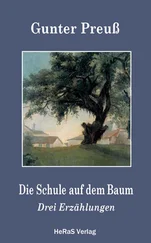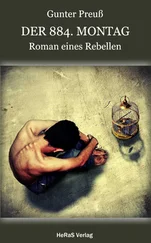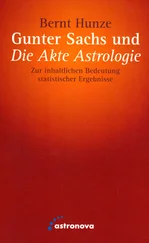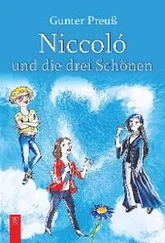Übrigens, ich habe in den Texten heute fast alles so stehen lassen, wie ich es gestern aufgeschrieben habe. Ein paar Schönheitskorrekturen habe ich mir hier und da gestattet - nur an der Form, nicht aber am Inhalt -, kaum der Rede wert und wohl nur vom Federfuchser wahrzunehmen.
1. Postulate zur Kritik (1973)
Leben und Kunst sind keine Schindmähren, aber auch keine Paradepferde, und in einen Stall passen sie schon gar nicht. Sie müssen sich in der Weite unserer Welt, die eng werden kann, zurechtfinden. Sie sind nicht gänzlich zu zähmen, und wer sie reiten will, muss schon den Sprung ins Ungewisse wagen und ins Kalkül ziehen, abgeworfen zu werden. Nach jedem Aufschwung muss dann auch wieder abgestiegen werden, um erneut aufsteigen zu können. Sehen wir doch die Kritik als Steigbügelhalter beim Aufstieg und Abstieg, die unerlässlich sind, denn wer will schon verdammt sein, ewig im Sattel zu sitzen.
Wenn ein Kritiker Kritisches anmerkt und nicht des Lobes voll ist, wird ihm vorgeworfen, dass er mit Autor und Werk nicht sensibel genug umgeht. Kritik an misslichen Zuständen innerhalb der Gesellschaft, ja, Selbstkritik am eigenen Versagen und all den menschlichen Unzulänglichkeiten wird von Partei und Regierung allerorts verlangt, um den Prozess des allgemeinen und individuellen Werdens und Reifens zu befördern. Doch wenn dann kritisiert und nicht nur an geschönter Oberfläche gekratzt und die Wurzel des Übels freigelegt wird, reagiert man höchst empfindlich. Kritik wurde bislang als gesellschaftsschädigend empfunden, wir haben nicht gelernt maßvoll mit ihr umzugehen. Man legte uns die Pflicht auf, ohne Fehl und Tadel zu sein, nur wenige Wege standen offen, die auf freies Feld zum Suchen und Ausprobieren führen. Es ist eine Binsenweisheit, die man lange vor uns dem Leben abgerungen hat – wo nicht gesucht wird, kann nicht gefunden werden. Das Suchen und Finden ist längst zum Kinderspiel geworden, das wir uns aber als Erwachsene verbieten. Fürchten wir uns vor der eigenen Entwicklung, haben wir Angst, in unserer neuen Gesellschaft Neues auszuprobieren? Was sich nicht bewegt ist tot oder stirbt. Dieses Lebensgesetz ist auch uns auferlegt.
Wir haben keine Schule der Kritik, keine Kritik in den Schulen. Unsere Menschen sind nicht von klein auf vorbereitet, mit Kritik selbstverständlich als Lebensnotwendigkeit umzugehen. Sie erleben Kritik als Bedrohung ihrer Persönlichkeit, anstatt sie als Chance für ihre Weiterentwicklung zu sehen. Alles hechelt nach Lob, das man doch am ehesten durch Anpassung an „gottgegebene“ Regeln erreicht. Jean Paul sagt 1806 in „Levana oder Erziehlehre“: Hofmeister suchen, wie Anatome, ihren Ruhm darin, Gerippe zu präparieren durch Entfleischen und sie dann zu bleichen, - Kräftigen und Kraft lassen, soll das erste und letzte Erziehwort sein.
Die Literaturkritik sollte wieder werden, was sie ist: ein eigenständiges literarisches Genre, das selbstbewusste, kluge, kenntnisreiche und vor allem mutige Persönlichkeiten verlangt. Wenn Kunstkritik sich nicht energisch Bewegungsfreiheit verschafft, wird sie weiterhin dilettieren und Unbehagen und Beschämung hervorrufen. Der Kritiker, wenn er sich denn als solchen ernst nimmt, bedarf keiner „Vorschläge“, wie er seine Kritik zu verfassen hat, er muss Parteiisches abwerfen und sich wie der Künstler ganz auf seine Subjektivität besinnen, um der Objektivität nahe zu kommen. Das ist nur scheinbar ein Widerspruch. Der Bezug auf sich selbst verleiht Glaubwürdigkeit; wenn man glauben kann, versteht man, was man weiß und kann sich selbst vertrauen, was Voraussetzung für die vielfältigen Beziehungen zu den anderen ist.
Kritik muss in der Wirklichkeit angesiedelt sein und die Wahrheit wollen; der Kritiker muss seine Eitelkeit und die Furcht anzuecken mit dem Mut zur Offenheit bekämpfen; die Scheuklappen der Parteilichkeit sind abzulegen; es ist nur nach dem eigenen Mund zu reden und eher zu schweigen, als ein Wort auszusprechen, das nicht von innen kommt.
Kunst ist eine „heilige Sache“, weil sie der Wahrheit verpflichtet ist, am deutlichsten wird das in der Literatur, da sie auf das Wort baut. Mit dem Wort umgehen, soll heißen: mit dem Leben umgehen. So wahr wir sprechen, so wahr leben wir, und umgekehrt. Die Sprache, die ja auch im Schweigen ist, ist der einzige gangbare Weg zum inneren und äußeren Frieden. Das Leben in all seinen Spielarten ist immer auch ein Tanz auf dünnem Seil. Die Kunst kann für den Seiltänzer eine hilfreiche Balancestange sein. Die Kritik sollte zum Scheinwerfer werden, der die Akteure nicht blendet und dem Publikum eine genaue Sicht ermöglicht. Im Leben und in der Kunst sollten wir uns vor Plattformen hüten, auf denen es sich todsicher stehen lässt, wo der Einzelne, eingekeilt in die Masse, zwar nicht stürzen, aber auch nicht steigen kann; denn es fehlt ihm einfach an Bewegungsfreiheit, die er benötigt, um ein Suchender zu sein, der finden will: sich selbst und die anderen.
Ich bin fünfunddreißig Jahre alt, und ich erwarte, dass noch einiges anfängt.
Mein Ich kenne ich nur vom Spiegel her, meistens von morgens, eine schlechte Nacht hinter mir, Unruhe in den Fingern, welche die Klinge führen gegen üppig wucherndes Barthaar. Das äußere Ich ist mit einem flüchtigen Blick zufrieden. Man hat sich an sein Gesicht gewöhnt. Aber da ist noch das zweite, das innere Ich, das wandelbare, verletzliche, ängstliche, aufbegehrende, das suchende Ich. Mit dem liege ich im Streit, täglich, oft auch nachts. Wie Welt sich verändert, verändert sich das Ich. Der Streit mit dem Ich ist Streit mit der Welt. Kann man überhaupt im Ich Welt entdecken? Zumindest muss man es über das Ich.
Als ich Kind war, sagte meine besorgte Mutter zu mir: „Junge, zieh dir eine Jacke drüber. Es ist kalt da draußen.“ Ich hatte gestern nicht gefroren. Warum sollte ich heute frieren? Ich ging ohne Jacke los. Es war ein schneidend kalter Tag. Bald schlich ich zurück in die Wohnung und zog mir die Jacke an. Aber manchmal konnte mir die Kälte nichts anhaben, ich vergaß sie im Spiel und brauchte nichts zum Drüberziehen.
Die Kinderzeit war bald vorbei. Es lag nun unendlich viel zwischen hässlich und schön, gut und böse, hell und dunkel, und manchmal war alles eins auf der Suche nach mir und den anderen. Es kamen die Lehrjahre, ein nach Maschinenöl und Kreide riechender Raum, in dem Relaisfedern nach zehntel und hundertstel Gramm justiert werden mussten; die Sucht nach schwerer Handarbeit, Kisten karren auf dem Güterboden eines Verladebahnhofs; der Kampf auf der Judomatte; der Traum vom dreifachen Salto am Flugtrapez und die erdgebundene harte Arbeit der Äquilibristik, das Bett in einer vulkanhaft auseinanderberstenden Stadt. Und es kamen Krankheit, Verzweiflung, immer wieder neue Hoffnung auf Erfüllung, und es kam der Griff zu Feder und Papier, um dort weiterzukommen, wo ich stehen geblieben war.
In dem Roman, an dem ich gerade arbeite, sagt der ältere Bruder zum jüngeren: „Mach eine Tür auf und tritt heraus, und du wirst wieder in einem verschlossenen Raum stehen. Und so viele Türen du auch öffnest, so viele geschlossene Räume wirst du finden.“
Ich bin froh, dass noch viele Türen zu öffnen sind, und ich will hoffen, dass die Räume, in die wir eintreten, die Anstrengungen lohnen. Ich bin fünfunddreißig Jahre alt und würde noch heute alle Mahnungen in den Wind schlagen und ohne Jacke auf die Straße gehen, um selber zu spüren, ob ich sie mir anziehen muss.
Das Gespräch führte: Prof. Dr. Peter Reichel
Z um Stück:
Bruno Jäger, Abiturient, 19 Jahre, tritt seine vierte Arbeitsstelle innerhalb eines Jahres an - bei der Batterietruppe, einer Brigade von Fernmeldeleuten. Seiner Mutter Olga zuliebe (den Vater kannte er nicht) und auch ein wenig aus eigener Einsicht nimmt er sich für diesmal äußerste Disziplin und Höflichkeit vor. Doch es ist Montag, die Brigade hört nur auf Fierats „verdienstvolles“ Kommando und in der ersten halben Stunde hat Bruno einen kräftigen Anpfiff und den neuen Spitznamen weg: Muzelkopp. Mit dem ängstlich-genügsamen Kauer zieht er nun mit destilliertem Wasser von Batterie zu Batterie, träumt dabei aber von hoher See oder auch vom Philosophiestudium. Es gibt Differenzen: mit der scheinheiligen Verwandtschaft bei der Geburtstagsfeier, mit seinen Freunden in der Disko - dem realistisch denkenden Eddy und dem karrieristisch handelnden Pythagoras -, mit dem Brigadier bei der Punktehascherei. Aber er findet auch Freunde: beim alten Kollegen Jakob Baum spielt er nachts wortlos Gitarre, seine Freundin Ev begreift ihn trotz seiner provokanten Maskerade. Am Ende verlassen ihn einige wieder, auf andere aber kann er sich nun verlassen.
Читать дальше