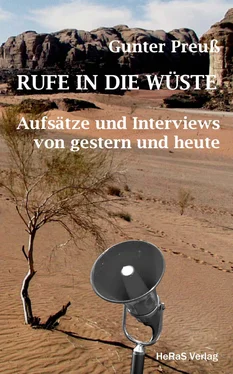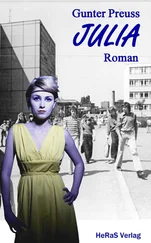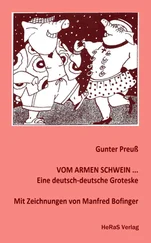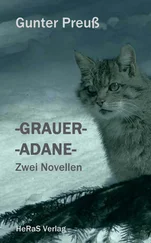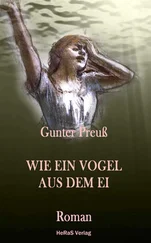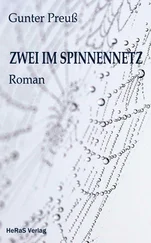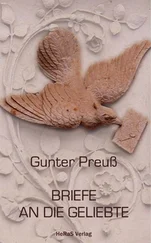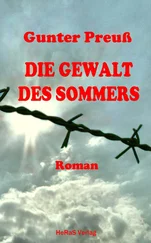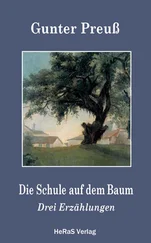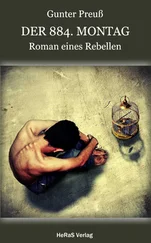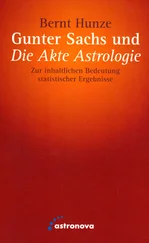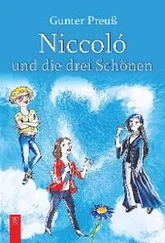Vieles was uns nicht wachsen lassen will oder aber zu unserer Selbstfindung beiträgt hat ja seine Ursache in frühester Kindheit. Wir Menschen sind gar nicht so unendlich entwicklungsfähig, wie wir es gern von uns behaupten. Das Fundament für das gesamte weitere Leben wird in den ersten Lebensjahren gelegt, alles was fortan dazu kommt, muss darauf seinen Platz finden.
Meine Mutter kannte ich nur krank. Die Kriegserlebnisse hatten in ihr verfestigt, was schon über die Gene und Kindheit in ihr angelegt war. Ihr Selbstwertgefühl litt wohl unter einem zu hohen eigenen Anspruch und einer angstgebremsten Umsetzung durchs Tun. Sie war bei alldem wenig gebildet und doch sehr klug, sie hatte einen „Nerv“ für Menschen und durchschaute sie mit untrüglicher Gewissheit. Sie blieb ihr Leben lang „Hausfrau“ und versuchte ihre vier Wände zu einer Burg gegen die Welt auszubauen, von der sie meinte, dass sie ihrem persönlichen Glück feindlich gesinnt war. Mein Vater dagegen war ein lebensvoller zupackender Mann, der das blutige Fleischerhandwerk ausübte und dennoch ein „Musensohn“ war. Er hatte eine sehr schöne Tenorstimme, vor dem Krieg hatte er bei namhaften Gesangslehrern geübt, und er hätte wohl in Dresden an der Oper ein Engagement bekommen sollen. Der Krieg kam dazwischen, die Front, Flucht aus amerikanischem Gefangenenlager, in der Nachkriegszeit der fortwährende Kampf ums Überleben. Er bildete im Leipziger Schlachthof die Lehrlinge aus, die auf ihn nichts kommen ließen, weil sie seine Toleranz und sein Verständnis schätzten. Während meine Mutter sich dem „Draußen“ immer mehr verschloss und meinem Vater drohte, ihn mit den Kindern zu verlassen, wenn er doch noch zur Bühne ging, hat mein Vater seinen Lebenstraum nie aufgegeben. Er war in etlichen Gesangvereinen als „erster Tenor“ gesetzt, seine Bühne fand er in Kneipen, wo der „Caruso vom Schlachthof“ dann all die berühmten Tenorarien zum Besten gab. Mein Bruder und ich erlebten viele unschöne Szenen zu Hause, die eben auch dadurch zustande kamen, dass die Eltern nicht miteinander leben und sich nicht trennen konnten. Bei mir war es dann die Fantasie, die ich überreich geschenkt bekommen habe, mit deren Hilfe ich mich aus der Diktatur meiner Mutter in eine freundlichere und vor allem buntere Welt hinüberretten konnte. Aber „krank am Herzen“ war ich wohl schon damals, und die alten Sinnfragen nahmen wohl viel zu früh einen Platz in mir ein, der noch ganz dem kindlichen Spiel gehört hätte.
Und dennoch hat meine Mutter, selbst eine leidenschaftliche Leserin, mich zum Lesen gebracht, und Jahre nach ihrem Tod zum Schreiben. Wenn ich von meinem Vater das „trotzdem“, den Willen zum Leben habe, so habe ich von meiner Mutter das Hinterfragen und Wissen wollen, eben auch die Liebe zur Literatur. Ich bin sozusagen mit den „Geschwistern“ aus Büchern groß geworden, mit Hänsel und Gretel, mit Huckleberry Finn, Tom Sawyer, Robinson Crusoe, Kriemhild und Siegfried, dem grünen Heinrich, Gretchen und wie sie alle heißen. Sie machen mich heute noch froh, es werden derer immer mehr, und ich fühle mich sicherer, sie um mich zu wissen, und vielleicht gelingt es mir ja auch, ihnen einen Bruder oder eine Schwester hinzuzufügen, der oder die aus meiner Feder stammt.
Vieles von dem, was Sie jetzt erzählt haben, erklärt Haltungen und Handlungen im „Muzelkopp“, Ihrem ersten Theaterstück. Beispielsweise findet nicht nur Bruno Jäger, sondern auch sein Spannemann Kauer dann zu seiner Identität und damit zu einem produktiven Neuansatz, wenn er die Übereinstimmung mit der eigenen Kindheit herstellen kann. Kindheit spielt für Sie offenbar eine große Rolle. Vielleicht kommt daher auch Ihre Neigung zum Kinderhörspiel, zum Kinderbuch, zur Bildergeschichte - eine Eigenart übrigens, die Sie mit anderen Bühnenautoren, etwa Peter Hacks, teilen. Vielleicht braucht man gerade für das Theater eine gehörige Portion Naivität, Kindlichkeit, Illusion, Fantasie, alles das, was noch nicht fertig und restlos nachrechenbar ist, wo man noch fragen und seinen Spaß daran haben kann, wo vieles von diesen Träumen angerissen wird oder sich zum Teil fantastisch verwirklichen lässt. Von daher scheint mir jetzt, dass Ihr Gang zum Theater, der im Einzelnen ja gar nicht konkret zu motivieren ist, doch irgendwo Gründe haben kann.
Nun sagten Sie eben, Sie seien früh mit dem Tod konfrontiert worden, auch Angstgefühle hätten sich da und dort eingestellt. Da scheint es mir eine starke Gegenreaktion von Ihnen zu sein, dann diesen gewaltigen Sprung von der Ausbildung an einem Institut in das Dasein eines freischaffenden Autors zu wagen. Gewiss muss man da eine ganze Portion Angst oder Befürchtung überwinden. Ist das der Mut der Verzweiflung gewesen, der Versuch, einmal alle Bedenken beiseite zustellen, oder hat sich das aus anderen Gründen so ergeben? Ist das eine ganz überlegte Handlung gewesen? Vielleicht keine Zeit mehr zu verlieren?
Ich habe oft das ungute Gefühl, als hätte ich nicht ausreichend Zeit zur Verfügung, um mich so weit wie möglich zu vervollständigen. Daraus entspringt natürlich eine Lebenshaltung, die das Risiko des Scheiterns erhöht. Ich habe einfach keine Zeit, mir bei jedem Schritt ein Hintertürchen offen zu lassen, um gegebenenfalls auf sicheres Terrain zurückzuflüchten. So macht man sich natürlich angreifbar, man wird leichter verwundet und steht eben oft auch allein da. Andererseits hat es den Vorteil, den Überraschungseffekt für sich zu haben und vieles unverstellt zu erleben. Der evangelische Theologe und Philosoph David Friedrich Strauss trifft in seiner „Theologischen Streitschrift“ den Punkt, in dem er die Möglichkeit mit dem Ideal verbindet: Wer möchte nicht ein Ganzer sein ? und wer bliebe doch nur immer ein Halber? Gewiss, keiner von uns kann seiner Länge einen Zoll, geschweige eine Elle zusetzen; aber sein natürliches Maß ausfüllen wollen, seine Kraft vollständig in Anwendung bringen, die Dinge festen Blickes anschauen, und das Erkannte ganz und rückhaltlos aussprechen, - das kann jeder. In diesem Sinne ein Halber zu sein, ist Schmach, ein Ganzer immer mehr zu werden, unbedingt Mannes- (Menschen-) pflicht. Ich denke, dass ist ein ebenso individuelles wie gesellschaftliches Problem, es birgt in sich den schmerzlichen wie lustvollen Weg von der Wirklichkeit zur Wahrheit. In dieser Spanne bewegt sich ja menschliche Entwicklung; aber meistens tritt sie eben auf der Stelle.
Ich habe eine kleine Geschichte für ein Bilderbuch geschrieben, die niemand haben will. Margit kann sich mit ihrer „gottgegebenen“ Stupsnase nicht anfreunden. Und als sie mit ihrem Freund Peter streitet, wird sie von ihm damit auch noch geärgert. Sie beschließt: Das Ding muss weg. Sie geht zu ihren Freunden und bietet ihre Nase zum Tausch an. Doch keiner will auf die eigene Nase verzichten und sich mit Margits Stupsnase belasten. An einem Teich schließlich tauscht ein noch dummes Entchen seinen Entenschnabel gegen die Stupsnase. Jetzt hat Margit aber einen Entenschnabel im Gesicht, der sie auch nicht froh macht. In ihrer Verzweiflung geht sie in den Zoo und tauscht immer wieder die Nase, Storchenschnabel gegen Elefantenrüssel, usw.. Dabei wird sie immer unzufriedener, sie tauscht nun auch andere Körperteile, trifft so auf ihren Freund und ist zutiefst betroffen, als der sagt: „Du bist nicht Margit! Meine Freundin hat eine Stupsnase!“ Sie rennt zurück in den Zoo, wo die Tiere schon auf sie warten, denn jeder will zurückhaben, was zu ihm gehört. Zu guter Letzt machen Margit und das Entchen ihren Tausch rückgängig. Und als die Kleine ihrem Freund begegnet, macht er sie froh, in dem er ruft: „Nun bist du ja endlich wieder da – Margit mit der Stupsnase!“
Ihre letzten Bemerkungen ebenso wie die Bilderbuchgeschichte weisen darauf hin, wie Sie Muzelkopp verstanden wissen möchten und wie Sie gleichzeitig wünschten, dass unsere Gesellschaft mit jedem einzelnen ihrer Mitglieder umginge. Nicht ich mache mir ein Bild von mir, das ich nie erreichen kann, und gehe an der Differenz zugrunde, sondern ich sehe das Bild in mir, das ich wirklich erfüllen kann und erfülle das also. Deshalb ist der Muzelkopp auch keine so völlig außergewöhnliche, exorbitante oder gar Außenseitergestalt, sondern einer, der sich selber sucht in seinem relativ alltäglichen Leben und dabei glücklicherweise nicht nach dem ersten Nichtfinden aufgibt, sondern weiter sucht. Schließt das nicht einen optimistischen, konstruktiven Lebenszug ein, das Prinzip der Entwicklung und Veränderung, und verhindert gleichzeitig Tendenzen des Scheinoptimismus? Welches Verhältnis des Autors zu seiner Gesellschaft setzt das voraus?
Читать дальше