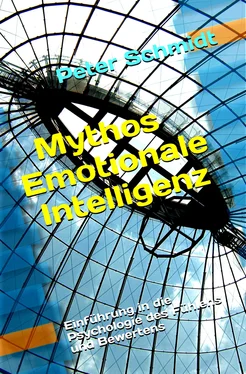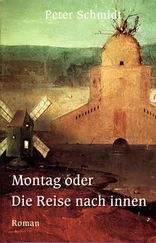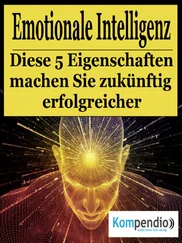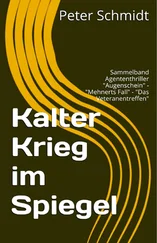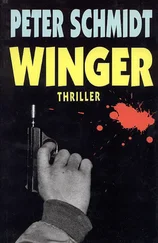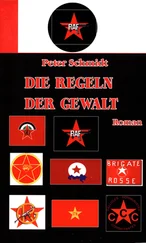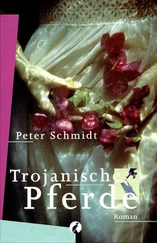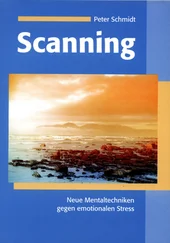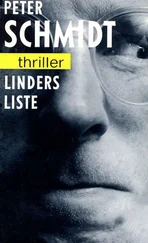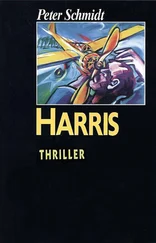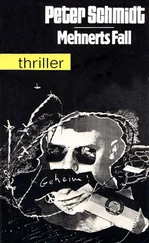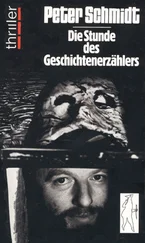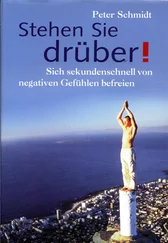Heerscharen amerikanischer Schüler schlucken Ritalin , um ihre Konzentration zu verbessern, oder Paxil , das gegen Schüchternheit hilft. Prozac Fluctin , das bekannte Antidepressivum, wurde zeitweise in amerikanischen Kleinstädten von Hausärzten wie Aspirin verordnet. Zur Leistungssteigerung wird Modafinil eingesetzt, das den Wachheitsgrad erhöht.
Ein weiter Hinweis darauf, wie wenig Selbstauskünfte und Selbsteinschätzungen für bare Münze genommen werden dürfen, ist unserer Trink- und Rauchverhalten. Wenn man unterstellt, dass Alkohol vor allem zur (oft unbewussten) Gefühlsveränderung konsumiert wird, und erst in zweiter Linie wegen des Geschmacks oder um seinen Durst zu löschen, dann dürfte es sehr bezeichnend sein, dass die Deutschen gegenwärtig im Jahr etwa 12 Milliarden Liter Bier trinken. Wo so massiv Gefühle und Stimmungen verändert werden, da kann man wohl zu Recht ein beträchtliches Defizit an Wohlgefühl vermuten.
Ein Großteil der mindestens 19 Millionen regelmäßigen Raucher in Deutschland kann als suchtkrank angesehen werden. Nikotin ist eine der am schnellsten süchtig machenden Drogen. Rauchen vermittelt den begehrten „Erleichterungskick“ und wirkt aktivierend und stimmungsaufhellend.
Der kanadische Pharmakologe Paul B. Clarek wies in Versuchen mit Ratten nach, dass die Tiere ihr Lustzentrum stimulieren konnten, indem sie sich über eine Apparatur per Tastendruck Nikotin in die Blutbahn verabreichten – und vieles spricht dafür, dass Mensch und Ratte sich in ihrem Suchtverhalten gleichen. Wissenschaftler der Howard-Universität in Washington konnten in Versuchen mit Ratten nachweisen, dass das Nervengift sogar als Antidepressivum wirkt. Viele Raucher scheinen mit Nikotin ihre Depressionen zu bekämpfen, vermuten Forscher.
Umgekehrt führt Nikotinentzug zu Stimmungstiefs, die bis zur Depression reichen können. Aufmerksamkeit und Konzentration verschlechtern sich. Langzeitraucher benötigen ihre tägliche Dosis nicht erst, um sich besser, sondern um sich normal zu fühlen (!). Auch neun Tage nach dem Rauchentzug, so konnte der amerikanische Pharmakologe Jack Henningfeld zeigen, war die geistige Leistungsfähigkeit noch nicht wieder auf dem alten Niveau. Nur maximal drei bis vier Prozent der Versuche, mit dem Rauchen aufzuhören, sind erfolgreich.
Die latente, weil oft unbewusste Fadheit des Alltags bei aller kaum zu lösenden Problematik durch Krieg und Terror, durch Gewalt, Hunger und Armut in der Welt zeigt sich auf vielen Ebenen. Populäre Unterhaltungsmusik und Heftchenromane, sofern sie uns die Idylle eine heilen Welt vorspiegeln, wirken auch deshalb so kitschig, weil wir unterschwellig spüren, dass dieses Bild nicht stimmig sein kann.
Unsere Gesellschaft ist, wie man jeden Tag aus den Medien erfährt, sexuell, ja sexistisch orientiert. Doch hier werden öffentlich Ideale vorgespiegelt, die keiner sachlichen Überprüfung standhalten. Tatsächlich regiert vielfach Unlust in den Schlafzimmern. Um nur ein Beispiel zu nennen: „Ungefähr 50 Prozent der Frauen leiden laut einschlägigen Umfragen unter einer Störung ihrer sexuellen Erlebnisfähigkeit. Das heißt im Klartext: Fast die Hälfte der Frauen kommt nie oder nur sehr selten zum Höhepunkt.“
58 Prozent der Männer und 51 Prozent der Frauen bezeichnen Sex sogar als „Stress“, so Umfrage bei 1015 Befragten im Auftrag der Zeitschrift „Fit for Fun“.
Die Lustfeindlichkeit ist zwar seit Oswald Kolle weitgehend aus den Schlafzimmern verschwunden. Lust ist kein Tabu mehr. Das gute Gewissen zum positiven Gefühl hat zugenommen. Aber Erotik und Sexualität sind durch zu viel Offenheit und Leistungsdruck entzaubert.
Versucht man statt aus Befragungsergebnissen Schlüsse aus dem Eindruck zu ziehen, den Menschen im Alltag auf uns machen, dann scheint dieses Bild die Selbstauskünfte eher zu widerlegen oder doch zumindest korrekturbedürftig zu sein: Wir finden selten glückliche Gesichter. Wenn überhaupt, dann vermitteln die meisten Menschen eher den Eindruck mäßiger Begeisterung und verhaltenen Interesses. Lachen ist in diesem Alltag eher die Ausnahme, Freude weder in Gesprächen noch in der Gebärdensprache oft zu entdecken.
Was gut und interessant am Leben ist, wird bevorzugt in die Zukunft verlegt: in den Urlaub, die Beförderung, die Ehe, den Ruhestand. Viele wirken gelangweilt, angespannt, mürrisch, gestresst. Sie gehen einer überwiegend freudlosen Routine nach. Und das ist angesichts der Monotonie und fehlenden Kreativität eines durchschnittlichen Arbeitsalltags auch kaum verwunderlich. Arbeit – das heißt nur allzu oft: kleinliches Vorgesetztengehabe, Mobbing, Intrigen, Jagd nach Pöstchen.
Nach einer Gallup-Umfrage geben nur 15 Prozent aller Arbeitenden an, dass ihnen die Arbeit Spaß mache – doppelt so viel Männer übrigens wie Frauen. 16 Prozent haben die sogenannte „innere Kündigung“ ausgesprochen und identifizieren sich nicht mehr mit den Zielen oder dem Sinn ihrer Arbeit. 69 Prozent machen lediglich Dienst nach Vorschrift. 85 Prozent aller Arbeitnehmer, so der Umkehrschluss, erleben ihre Arbeit demnach als nichtssagend, wenn nicht sogar als langweilig oder emotional belastend. Als verantwortlich dafür wird auch das autoritäre Verhalten deutscher Arbeitgeber angesehen: Ein deutlicher Hinweis darauf, dass es unserer Führungselite an emotionaler Klugheit mangelt.
Doch auch das Umfeld der Arbeit ist selten attraktiv. Der Tag beginnt mit immer gleichen Aufgaben. Arbeitsweg – das bedeutet für viele: Verspätungen, volle Züge, verschmutzte Toiletten, Lärm, Aggressivität, verstopfte Straßen. Auch die schnelle Bereitschaft, bei einer Belastung unfreundlich, aggressiv, frustriert zu reagieren, spricht nicht für eine positive Laune und Grundbefindlichkeit.
Impulsivität gilt als eines der Hauptprobleme, wenn wir „emotional intelligenter“ werden wollen. So auch Daniel Goleman, dem wie einigen amerikanischen Neurologen dafür vor allem die überschnelle Reaktion des Mandelkerns vor allem rationalen Abwägen verantwortlich ist: jenes emotionalen Zentrums im Gehirn, ohne das wir keine Gefühle hätten.
Nur allzu zu gut vertraut ist uns allen unsere Aggressivität im Straßenverkehr. Da wird um Sekunden und Meter gekämpft und dabei nicht selten das eigene und fremde Leben in Gefahr gebracht. Da beweist man seinen sozialen Status mit PS und der Überholgeschwindigkeit, ist genervt und ständig in Eile, straft jeden Regelverstoß im Verkehr mit wütenden Beschimpfungen – und leert dann bei der nächsten Rast seinen Aschenbecher am Straßenrand aus.
Auch Jugendliche sind, zumal in der Pubertät, keineswegs immer die glatt und „cool“ funktionierenden Angepassten, die uns Jugendkultur, Musik und Mode suggerieren. Ein Blick auf (anonyme) Anfragen an eine Beratungsstelle mag das belegen.
Thomas, 15 Jahre:
„Ich frage mich oft, ob das Leben einen Sinn hat für mich. Ich denke oft, dass es für mich am besten wäre, nicht mehr zu leben. Aber ich habe nicht vor, mich umzubringen. Ich hätte auch gar nicht den Mut dazu. Aber was kann ich tun, um das Leben sinnvoll zu finden?“
Anna 13 Jahre:
„Mir ist immer so langweilig. Ich weiß gar nicht, was ich den ganzen Tag machen soll. Was soll ich den ganzen Tag tun?“
Tina, 15 Jahre:
„Ich habe Probleme mit dem Essen. Immer öfter muss ich nach einer Mahlzeit erbrechen. Dann gibt es aber auch Tage, an denen ich richtige Fresssuchtattacken habe. Was kann ich tun?“
Sabine, 14 Jahre:
„Ich leide unter Bulimie, ich habe regelrechte Fresssuchtattacken.“
Sarah, 15 Jahre:
„Ich fühle mich oft deprimiert. Ich habe zu nichts richtig Lust und manchmal finde ich es so schlimm, dass ich mich umbringen möchte. Was soll ich tun?“
Antje, 16 Jahre:
„Meine Freundin schnippelt sich die Haut auf. Ich mache mir Sorgen. Mit wem kann ich darüber reden? Wo gibt es kompetente Gesprächspartner? Soll ich ihre Eltern ansprechen?“
Читать дальше