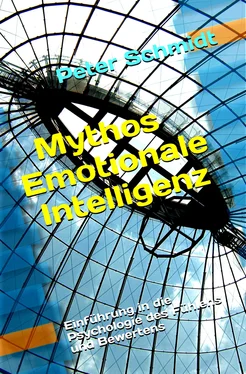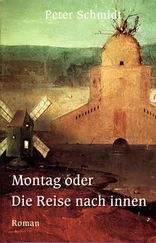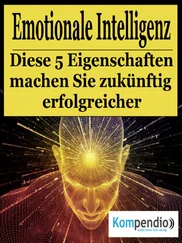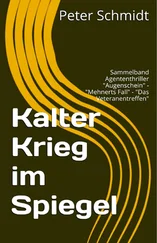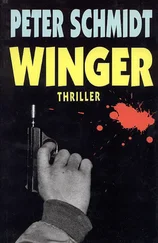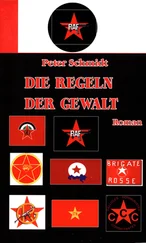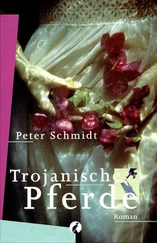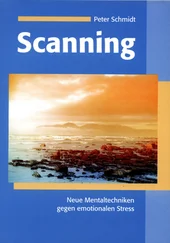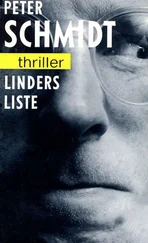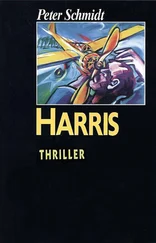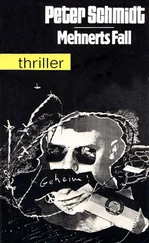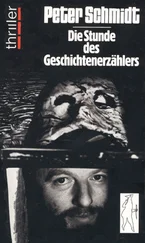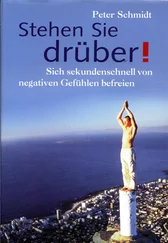2) Oder im weiteren Sinne als selbstentfremdeter Zustand des Menschen durch die ihm von den Herrschenden aufoktroyierte Massenkultur, insofern sie der Emanzipation und Aufklärung im Wege steht, wie bei Horkheimer und Adorno. Oder auch, ähnlich, als Nicht-bei-sich-selbst-Sein, sondern stattdessen der Alltagsroutine und Oberflächlichkeit in der Masse verfallen wie bei Heidegger.
3) Selbstentfremdung wird hier auch nicht begrenzt auf den seelischen Zustand, bei dem bewusste und unbewusste Bereiche nicht auf dasselbe Lebensziel hinarbeiten, weil sie sich widersprechen oder ihnen der Einklang fehlt, wie bei Freud.
Sondern alle diese Faktoren – aber auch völlig andere – können je nachdem mehr oder weniger ursächlich sein für jenen allgemeineren – ja allgemeinsten – Begriff der Selbstentfremdung, die darin besteht, dass wir das, was wir insgeheim wollen, nicht erreichen, weil wir gar nicht wissen, was wir wollen sollen.
Wenn wir selbstentfremdet sind, wird Konventionen und Bräuchen mehr Gewicht beigelegt als nötig. Dann sind wir nicht selbstbestimmt, sondern zu unserem eigenen Nachteil außengeleitet, und neigen dazu, in kleinlicher Regelbefolgung zu erstarren. Oft fehlt es uns dabei an Lebendigkeit und Entdeckerfreude, an Kreativität und Vitalität, an Freude und Optimismus.
Im Zustand der Selbstentfremdung tendiert unsere Stimmung dahin, gedrückt oder doch wenigstens nichtssagend und unattraktiv zu sein. Denn die Frage „Wozu das alles?“ steht unausgesprochen oder ausgesprochen im Raume. Das gilt erst recht, wenn wir Belastungssituationen ausgesetzt sind. Wir spüren, dass wir nicht genau wissen, wozu wir leben. Und leider reagieren unsere Gefühle auf „Sinnleere“ und oberflächliche Vergnügen nur all zu oft mit Frustration und Aggression, mit psychosomatischen Beschwerden, mit Zynismus und übertriebener Kritik oder dem Bedürfnis nach Exzessen, gleichgültig, ob solche Eskapaden unsere Gesundheit schädigen oder das gesellschaftliche Klima vergiften.
Unsere Äußerungen sind dann oft blass und einfallslos oder auch auf manische Weise rechthaberisch. Denn wir spüren, dass wir etwas ändern müssen, wissen aber nicht genau, wo wir den Hebel ansetzen sollen. Hier liegt das objektivistische Missverständnis der Werte besonders nahe: Die anderen machen irgendetwas falsch. Und wo sonst sollte dieser Fehler liegen, wenn nicht in den objektiven Verhältnissen und Verhaltensweisen? Der andere wird dabei oft als Langweiler wahrgenommen, als manischer Egomane oder Narziss, wenn nicht sogar als rücksichtsloser Egoist und Ausbeuter, der allerdings alles daran setzt, seinen Egoismus zu rationalisieren und zu bemänteln. Ist man unter solchen gesellschaftlichen Bedingungen nicht gezwungen, es den anderen gleichzutun?
Selbstentfremdung bedeutet darüber hinaus, für den anderen, die Gemeinschaft und das gesellschaftliche Umfeld ein Faktor zu sein, der Negativität erzeugt. Der Politiker, der Lehrer, der Diktatur, der Geschäftsmann, der Feldherr, der sich selbst entfremdet ist und der seine eigenen mentalen Hauptprinzipien nicht erkannt hat, d.h. jene Prinzipien, die ihn ein positives, erfülltes Leben anstreben lassen:
Wer selbst nicht intakt ist, droht seine Negativität auch auf andere zu übertragen
Was unsere wahren Ziele und Motive sind, braucht dabei nicht immer genau bekannt sein. Wir können vordergründige Ziele verfolgen, die uns sehr plausibel erscheinen, deren genauere Analyse dann aber zeigt, dass wir uns selbst nicht verstanden haben. Auch darin – in dieser Desorientiertheit – liegt unsere Selbstentfremdung. Und die Folge dieses Mangels ist, dass wir wegen unserer Desorientiertheit unsere eigentlichen Lebensziele nicht realisieren.
Selbstentfremdung kann als allgegenwärtiges Problem unserer Kultur angesehen werden
Hier könnte man einwenden: Aber wie ist denn überhaupt generelle Kritik möglich angesichts der großen Verschiedenheit der Menschen, ihrer unterschiedlichen Wünsche, Motivationen und Ansichten? Setzt Gesellschaftskritik nicht voraus, über die persönlichen Ziele anderer besser Bescheid wissen als der Betroffene selbst? Wäre es nicht vermessen, über die „wahren“ Lebensziele anderer urteilen zu wollen?
Unsere Legitimation, auch die Individualität des anderen in die Analyse einzubeziehen, leitet sich daraus ab, dass wir eben nicht nur Individuen mit ganz unterschiedlich Gefühlen, Motivationen und Interessen sind, sondern darüber hinaus trotz aller Verschiedenheit identischen mentalen Prinzipien gehorchen. Unser Werterleben lässt sich auf einen gemeinsamen Nenner bringen. Jedes Werturteil und jede Werterfahrung, die mit recht so genannt werden könnte, folgt einem immer gleichen Schema. Dies ist allerdings eine der am wenigstens bekannten und dabei doch offensichtlich wichtigsten Einsichten, die man im Leben haben kann.
2 Was uns zu emotionalen Irrläufern werden lässt
Viele Menschen wissen intuitiv, wie ein friedliches, produktives und erfülltes Leben zu führen ist. Sie handeln aus dem Bauch heraus „klug“ und „vernünftig“. Und dieser Teil der Menschheit ist dafür verantwortlich, dass wir Gesetze und brauchbare Verhaltensregeln entwickeln, dass wir Moral und Freiheit, Toleranz, Kunst und Kultur und die Wissenschaften fördern.
Aber die wenigsten sind im Stande, ihr Verhalten rational zu erfassen, geschweige denn, es auf den Punkt zu bringen. Sie leben in einem Zustand leichter Selbstentfremdung , doch ohne jene negativen Folgen wie Hass, Krieg, Terror und Intoleranz und Gewalt, für die echte emotionale Irrläufer verantwortlich sind.
Emotionales Irrläufertum ist ein komplexes Phänomen, das unterschiedliche Ursachen hat. Ein typischer und dabei besonders schwer wiegender Grund liegt wie schon angesprochen darin, dass wir nicht wissen, wozu wir leben. Dann handeln wir auf vage oder gar nicht bekannte Ziele hin und drohen wegen dieser Ziellosigkeit öfter zu scheitern als notwendig. Uns fehlen überzeugende Kriterien. Stattdessen rechtfertigen wir Werte intellektuell, ohne Bezug zu Gefühlen. Wir diskutieren mit großem Ernst und manchmal im wahrsten Sinn des Wortes bis aufs Blut über Mittel, ohne den genauen Zweck zu kennen, den diese Mittel haben könnten oder sollten.
Wenn wir unsere Ziele nicht kennen, werden wir sie nur schwer oder gar nicht erreichen.
Wenn wir nicht erkennen, dass es fast unmöglich ist, unsere Ziele allein und ohne Hilfe anderer zu erreichen, drohen wir ebenfalls scheitern.
Wenn wir nicht sehen, dass andere, um uns behilflich zu sein, von uns das Gleiche erwarten, dann ist die Kooperation damit der Beliebigkeit ausgeliefert.
Im Folgenden dazu eine kurze, noch sehr abstrakte und allgemein gehaltene Zusammenfassung, die dann später durch konkrete Analysen belegt werden soll.
10 THESEN
Wir werden zu „emotionalen Irrläufern“:
1 Weil wir nicht oder nicht klar genug wissen, dass das Fühlen der Hauptzweck des Lebens ist.
2 Weil der „Wertblick“ des Menschen in der natürlichen Einstellung am Wesentlichen vorbeisieht und das vermeintlich Wichtige gar nicht das Wesentliche, das vermeintlich Akzidentielle das eigentlich Wichtige ist.
3 Weil wir zu oft bei bloß „ verkopften Werten “ oder Werten als Mitteln, beim bloß Nützlichen stecken bleiben, das keinen Bezug zu unseren Gefühlen hat.
4 Weil wir zu oft an ambivalenten Wertgefühlen und fixen Wertvorstellungen anhaften, die uns schaden.
5 Weil unsere emotionale Grundverfassung aus physischen und mentalen Gründen zu sehr auf Leiden beruht; anders ausgedrückt: weil die Aversio überwiegt.
6 Weil Befriedigung und Erfüllung zu oft hinter den Erwartungen zurückbleiben.
7 Weil wir nicht erkennen, welchen Prinzipien unsere Werterfahrungen und unsere Werturteile gehorchen.
Читать дальше