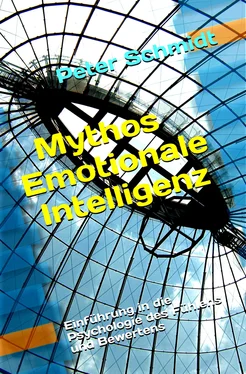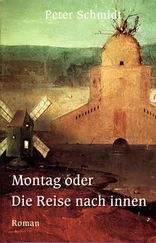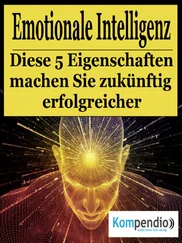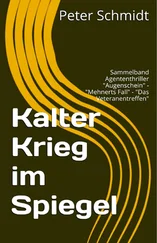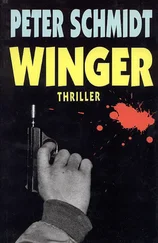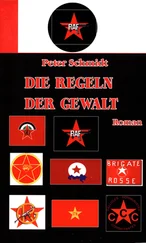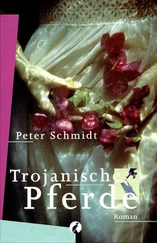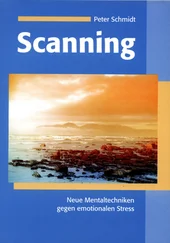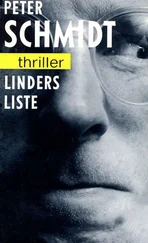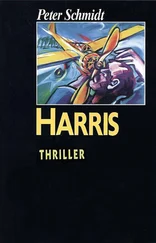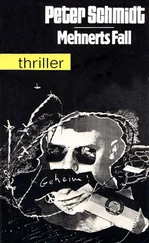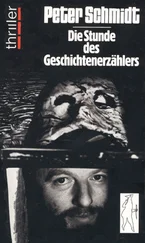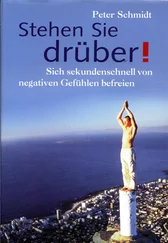Wenn es überhaupt so etwas wie eine gesellschaftlich Übereinkunft für den Umgang mit Gefühlen gibt, dann lautet sie:
Man soll sich nicht von seinen Gefühlen „übermannen lassen“. Man soll seine Gefühle „unter Kontrolle halten“ und nicht „gefühlsselig“ sein, „nicht emotional werden“. Wir sollen rational denken, nüchtern bleiben und die „Ruhe behalten“.
Gefühle sind nach weitverbreiteter Meinung mehr oder weniger obskur und hinderlich, ja oft sogar schädlich oder gefährlich. Selbst positive Gefühle wie Vergnügen und Unterhaltung oder Gefühle, die mit Sex, Erotik, Macht, Ruhm oder Gier einhergehen, sollten nicht die Überhand gewinnen, sagt man uns. Lust, zumal außereheliche oder womöglich sogar homosexuelle Lust, gilt nicht allein der katholischen Kirche als suspekt. Wir sind zwar etwas weniger lustfeindlich als früher, glauben aber immer noch, die Arbeit um der Arbeit willen schätzen zu sollen, die Moral um der Moral willen, das Leben um des Lebens willen. Gefühle spielen dabei höchstens eine marginale Rolle.
Allenfalls wird noch konstatiert, dass manche Gefühle (wie z.B. Trauer), oder einschneidende Lebenserfahrungen (z. B. schwere Krankheiten) uns durch Leiden „stärker machen“ und „weiterbringen“. Und die Mühsal des Lernens und der Arbeit findet vielleicht ihren Lohn materieller Sicherheit, Wohlstand und Vorsorge für das Alter. Im Übrigen sei das Leben ohne negative Gefühle doch „langweilig“.
Fragt man jemanden, der so argumentiert, wie er seinen Standpunkt begründen könnte, dann herrscht meist beredtes Schweigen. Sind diese Forderungen und Ansichten denn nicht evident? Muss man darüber diskutieren? „Nicht emotional“ zu werden oder „seine Habgier zu zügeln“ erscheinen den meisten als plausible, sozusagen sich selbst erklärende Werte.
Aber was ist eigentlich evident daran, seine Habgier zügeln zu sollen? Warum sollte ich nicht so viel haben wollen, wie ich mir wünsche? Warum sollte ich nicht emotional werden? Was genau spricht denn gegen „zu viel“ Lust an der Macht?
Bei der Antwort auf solche Fragen offenbart sich unser blinder Fleck in Sachen Gefühl. Wenn Sie mir die (zunächst noch anmaßend erscheinende) Behauptung gestatten: Mir ist noch kein Mensch begegnet, von dem ich – am gegenwärtigen Erkenntnisstand gemessen – guten Gewissens behaupten könnte, er habe ohne fremde Hilfe verstanden, worauf es bei seinen Gefühlen ankommt.
Fall sich diese These belegen lässt, ist das zweifellos ein alarmierendes und erschreckendes Ergebnis. Denn die Folgen unserer Unwissenheit sind dramatisch: Ein unerwartet großer Teil unser Fehler lässt sich anscheinend auf mangelndes Wissen über Gefühle zurückführen. Selbstverständlich nicht alle Fehler im Leben, aber doch ein viel größerer Teil, als gemeinhin angenommen wird. Je genauer man das Problem erfasst, desto mehr drängt sich sogar der Eindruck auf, dass wir in Gefühlsfragen geradezu „emotionale Irrläufer“ sind – wir sind „emotional desorientiert“.
Der Appell an unsere vielbeschworene Emotionale Intelligenz erweist sich so als Mythos
Denn er zielt auf etwas ab, das wir nicht einmal mehr schlecht als recht verstanden haben. Charakter und Ziel Emotionaler Intelligenz liegen im Dunkeln. Emotionale Intelligenz bleibt ein Mythos, so lange es sich um Bauchentscheidungen mit oft gefährlichem Ausgang handelt.
Sie bemerken: Ich versuche zu provozieren, um die Dringlichkeit des Themas zu verdeutlichen! Inzwischen bestätigt sich immer klarer, dass unsere Blindheit hinsichtlich des Phänomens Gefühl nicht nur für viele Tragödien im Privatleben verantwortlich ist, sondern ein noch viel tragischeres Unwesen in Politik, Wirtschaft und Kultur treibt – genaugenommen in allen gesellschaftlichen Bereichen des Lebens.
Wir führen Kriege nicht zuletzt auch deswegen, weil wir unsere Gefühle nicht verstehen. Wir unterdrücken Menschen und zwingen ihnen unsere Meinung auf. Wir schlagen uns wegen unserer Gefühle und der mit ihnen einhergehenden Werturteile die Köpfe ein. Wir streiten, morden, vergewaltigen wegen unserer Gefühle. Und für all diese Probleme ist, neben anderen Gründen, leider auch allzu oft unsere Unwissenheit in Sachen Gefühl verantwortlich. Hitler, Stalin, Pol Pot, Idi Amin, Saddam Hussein – offenbar findet die Geschichte immer wieder mit größter Leichtigkeit ihren gerade geeigneten Protagonisten für emotionale Dummheit.
1 Emotionale Desorientiertheit
Fast die ganze Welt, so könnte man glauben, ist sich selbst entfremdet. Denn viele Menschen leben in einem Zustand permanenter Desorientiertheit hinsichtlich ihrer allgemeinen Lebensziele und ihres Lebenssinns. Unsere Motive und Wertvorstellungen sind über weite Strecken Selbsttäuschungen.
Wir wissen zwar im Einzelnen recht genau, was wir jeweils wollen. Aber wir wissen nicht oder nur äußerst selten, warum wir wollen, was wir wollen. Folglich mangelt es uns an Klarheit darüber, warum wir eigentlich wollen sollten , was wir nicht so genau wissen. Und warum man nur das aus guten Gründen wollen kann, was wir wollen sollten.
Ein wichtiger Grund für diese Selbstentfremdung, die man durchaus als „emotionale Desorientiertheit“ bezeichnen könnte, liegt in unseren mangelnden Begriffen und in unserer geistigen Trägheit und Bequemlichkeit, auf grundsätzliche Lebensfragen intelligente Antworten zu finden. Was die Frage nach dem Sinn und Wert des Lebens anbelangt, sind wir Dilettanten geblieben. Darin erreicht unsere Intelligenz auch nicht annähernd ein ähnlich hohes Niveau wie bei der Lösung der Aufgaben, ein Garagentor einzubauen, zum Mond zu fliegen oder die Leistung unserer Computerchips zu steigern. Hier steht die Aufklärung bestenfalls am Anfang.
Auch Philosophie und Psychologie, die Geisteswissenschaften und Naturwissenschaften haben darin versagt, uns zu erklären, was das Ziel des menschlichen Handelns ist – vielleicht, weil sie zu voreilig davon ausgingen, dass es sich um eine Vielzahl höchst unterschiedlicher, individueller Ziele handelt? Offenbar lag es ihnen fern, auch nur die Möglichkeit zu erwägen, in all unseren Wertvorstellungen, Motivationen und Entscheidungen lasse sich ein identisches Prinzip finden.
Hinsichtlich der zentralen Frage nach dem Sinn und Wert des Lebens ist die Geschichte der Philosophie eine Folge blamabelster Fehlschläge, die jeden Philosophiestudenten an der Kompetenz all jener hoch geschätzten Theoretiker der Vergangenheit und Gegenwart zweifeln lassen sollte. Wir finden überall einen Mangel an Grundlagendenken. Bezeichnend für dieses Versäumnis ist die resignative Haltung des Philosophen Ludwig Wittgenstein, wonach Philosophie unsere Lebensprobleme im Kern gar nicht berühre.
Sieht man von – allerdings oft rudimentären und völlig ungenügenden – Ansätzen in der Antike, in der englischen Philosophie des 17. und 18. Jahrhunderts, der deutschen Wertphilosophie, etwa bei Windelband, Rickert, N. Hartmann und Scheler oder der Existenzphilosophie nach dem Ersten Weltkrieg ab, gelang es bisher nie, überzeugend zu bestimmen, worin Wert und Ziel des Lebens bestehen.
Auch die sogenannte Psychologie der „Emotionalen Intelligenz“ geht bei allen Verdiensten als Vorreiter eines neuen Nachdenkens über Gefühl und Intelligenz hinsichtlich der Frage nach dem Wert eher halbherzig zu Werke. Ihr publizistischer Initiator, der amerikanische Psychologe Daniel Goleman, hatte 1995 in Emotionale Intelligenz eine Reihe psychologischer Vorarbeiten und Untersuchungen zusammengefasst, die zeigen sollten, dass unser gewöhnlicher Intelligenzbegriff nicht zureichend ist, um erfolgreiches Handeln zu charakterisieren. Vielmehr bedarf es zu dessen Erklärung eines weiteren Faktors, den man „emotionale Intelligenz“ nannte, der aber vielleicht treffender „emotionale Klugheit“ genannt werden sollte. (Während der Intelligenzbegriff eher starre Fähigkeiten charakterisiert, beinhaltet „emotionale Klugheit“ auch ein gewisses Maß an Erfahrung und wohlüberlegter Intention, sich weiser zu verhalten, als es spontane Intelligenz nahelegen würde.)
Читать дальше