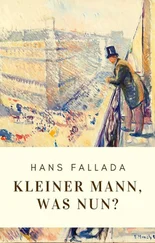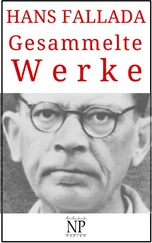Damals ging noch alles ganz gut zwischen Meta Schulze und Paulus Hagenkötter, niemand konnte voraussehen, daß zwischen der Lehrerin Fräulein Schulze und dem Kontoristen Herrn Hagenkötter einst so erbitterte Feindschaft herrschen sollte. Während zwischen Karla und mir eigentlich von der ersten Stunde an alles klar vorauszusehen gewesen war. Denn als wir dann im Dunkeln – mein Anzug war noch recht recht feucht und immer noch völlig Vogelscheuche: sieh her, und bleibe deiner Sinne Meister! – als wir also im Dunkeln Arm in Arm nach Haus gingen, gaben wir uns schon den ersten Kuss! Es war ja dunkel, wir mußten uns nicht ansehen dabei –!
Und es hätte noch immer mit uns nichts zu werden brauchen trotz dieses Kusses, denn wenn man jung ist, ist die Welt voller Küsse. Aber nun wir es doch so, daß Karla mich nicht betrügen konnte, sie mußte es mir gestehen, daß sie schon einmal einen Jungen geküßt hatte. Und es war gar nicht so schön gewesen, und sie hatte sich so geängstet ...
Leise redete sie im Dunkeln neben mir weiter. Wir gingen nicht mehr Arm in Arm, eines hatte die Hand um die Hüfte des anderen gelegt, wir wußten noch nichts, unser Blut war noch ruhig, küssen war schon Glück genug.
Und er hat mich gar nicht geküßt, weil er mich gerne mochte, sondern bloß weil er seine Mutter ärgern wollte, die ihm das Ausgehen am Abend verboten hatte! Extra haben wir uns unter die Gaslaterne vor seinem Hause stellen müssen, wo er doch wußte, seine Mutter lauerte auf ihn, und er hat gesagt: Nun machen wir einen Fünf-Minuten-Brenner! Und genau fünf Minuten lang hat er mich geküßt, er hat dabei immer auf seine Armbanduhr gesehen, er hatte seinen Arm hinter meinem Kopf – oh, war das eklig! Findest du nicht auch –?
Ich gab ihr als Antwort nur einen Kuss, er war ohne Uhr gegeben, aber die Sterne zwischen den schwarzen Baumwipfeln über uns fingen so an zu tanzen, daß ich die Augen wieder zumachen mußte ...
Und ich bin vom Fleck nach Haus gelaufen und bin im Dunklen ins Bett gekrochen. Ich wagte kein Licht zu machen, ich dachte, Mutter müßte es mir ansehen. Und die ganze Nacht habe ich wach gelegen und auf das Hellwerden gelauert, damit ich mich im Spiegel sehen konnte. Ich hatte solche Angst, alle würden es mir ansehen! – Du, das ist aber erst ein halbes Jahr her, ist das schlimm?
Ja, so war Karla, von der ersten Stunde an offen und ehrlich, Heimlichkeiten gab es bei ihr nicht. Ich habe fast zwei Wochen gebraucht, bis ich ihr gestand, daß ich vor ihr schon vier Mädchen geküßt hatte ...
Wir trieben mit dem Kahn immer leiser durch den Nebel, und schließlich ließ ich die Ruder ganz ruhen, nahm ihre Hand und sagte: Ach Kerlchen, es ist doch immer schön gewesen – warum soll es denn nicht schön bleiben können, jetzt, wo wir Geld haben?
Sie drückte meine Hand wieder, aber sie sagte jetzt doch: Aus guter Meinung hat uns dein Onkel Eduard sein Geld nicht vermacht. Er hat uns etwas Böses damit antun wollen.
Aber das ist doch Unsinn! rief ich. Wie er es gemeint hat, das ist ganz egal! Man kann Geld haben und anständig bleiben!
Auch bei viel Geld? Bei sehr viel Geld?! Ich glaube, man muß da furchtbar stark sein! Ich muß immer daran denken, was er geschrieben hat, daß alle Leute von den Reichen nur Geld wollen und wie sie das böse und mißtrauisch macht.
Siehst du, nun redest du doch von dem Brief! Es sollte von ihm überhaupt nicht mehr geredet werden, du hast ihn darum selbst verbrannt.
Das ist keine Antwort, Maxe! sagte sie. Auf dem Wege hierher habe ich solche Angst gehabt, du könntest einmal so werden wie dein Onkel. – Sieh mal, Max, wir haben erst fünfundzwanzig Mark von dem Geld ausgegeben, das von der Sparkasse können wir wieder abheben ... Wenn wir nun zum Herrn Justizrat gingen und ihm sagten, daß wir es uns anders überlegt haben, wir wollten lieber nicht erben?
Aber, Karla, schrie ich fast, sprang hoch und wäre vor Aufregung beinahe wieder in den Mummelteich gefallen. Das ist doch ganz unmöglich! So können wir uns doch nicht blamieren! Denke doch, der Nachlassrichter! Und der Justizrat! Und wie soll ich denn je mit Subdirektor Kracht wieder in Ordnung kommen, wo ich schon so viel gefehlt habe? Und alle werden sagen, wir sind verrückt, und ich werde nie wieder eine Stellung kriegen! Und dann das Honorar für den Justizrat und die Gebühren vom Gericht – woher sollen wir denn das Geld nehmen?
So überschüttete ich sie mit Gründen, und einer war immer beweiskräftiger als der andere, aber mein Hauptgrund, den ich ihr nicht sagte, war doch der, daß man eine Erbschaft von drei Millionen einfach nicht ausschlägt, nie und unter keinen Umständen. Statt dessen sprach ich ihr von der Mücke, was wir ihr für eine Erziehung geben könnten, und wie viele Kinder wir noch haben wollten, und wie schön es sein würde mit all den Kindern in dem großen Hause, und sie würden einen Ponywagen haben und ein Ziegengespann und einen Hauslehrer, und Englisch würden sie lernen ...
Oh, ich wurde so beredt, ich erstickte jeden Widerspruch mit Gründen, Hoffnungen, Plänen! Und schließlich war sie ja als lebenspraktische Frau genauso überzeugt wie ich, daß man ein solches Geschenk nicht ausschlägt, einfach nicht ausschlagen kann.
Es war ja bloß ein Gedanke von mir, Maxe, sagte sie schließlich entschuldigend. Rege dich bloß nicht so schrecklich auf, du fällst noch aus dem Kahn. – Aber wenn ich merke, daß du, was er da geschrieben hat, von anderen Frauen, du weißt schon ...
Rede nur keinen Unsinn! sagte ich grenzenlos verlegen. Immer wieder fängst du von dem dußligen Brief an. Der ist verbrannt!
Denn ich bin eifersüchtig, Maxe, redete sie unaufhaltsam weiter und schämte sich nicht die Spur, und dich lasse ich mir nicht wegnehmen. Und wenn ich merke, du kommst in Gefahr, dann tue ich was ...
Sie versank in Nachdenken.
Was tust du denn da? fragte ich neugierig.
Das weiß ich noch nicht! Aber du sollst sehen! Du kennst mich noch lange nicht!
Sie funkelte mich an, als habe ich schon ... als sei ich bereits ...
O Gott, es ist schon fast dunkel, wir müssen nach Hause! Da ist die Mücke uns richtig eingeschlafen, hier auf dem kalten Wasser. Wir sind schöne Eltern! Das fängt ja gut an mit unserer Vorsorge für das Kind!
10. Kapitel
Zuckertorte und Totenkranz – Oma Böök und ihr Enkel August, der Wandergeselle – Ein Seifensieder geht mir auf!
Nach Radebusch hinein, mit der schlafenden Mücke im Huckepack auf meinem Rücken, kamen wir schnell genug, trotz Nacht und Nebel. Aber dann standen wir doch wieder auf der Straße und starrten zu unseren Fenstern empor, von denen das an der Stube völlig erhellt war, während in der Schlafkammer ein Halbdämmer herrschte, als falle Licht von der Stube herein.
O Gott! seufzte Karla. Da sitzt doch wahrhaftig jemand und lauert auf uns. Oma Böök ist auch zu gutmütig, daß sie jeden in unsere Wohnung läßt! Und ich hatte noch nicht einmal richtig aufgeräumt heute früh, als wir zum Amtsgericht losrannten.
Es hilft nichts, Karla, sagte diesmal ich tröstend, vielleicht ist es nur der Bürovorsteher Fiete von Herrn Justizrat Steppe, oder deine Freundin Meta, oder der Paulus. Hinauf müssen wir, wer es auch sei, denn die Mücke muß ihr Abendbrot haben und ins Bett. Also komm schon!
O Onkel Eduard! seufzte Karla, als wir die Treppen zu unserer Mansarde hinaufzuklettern anfingen, und das klang so komisch, daß wir beide lachen mußten. Nur die müde Mücke sagte, weinerlich protestierend: Ich heiß nich Eh-darda, ich bin die Mücke Schreyvogel!
Als wir aber oben anlangten, schnupperte Karla und rief: Es riecht hier so nach Bohnerwachs – wer hat denn hier die Dielen gewachst?
Ich legte mutig die Hand auf die Türklinke, aber unsere Tür war verschlossen, und drinnen brannte doch Licht –!
Читать дальше