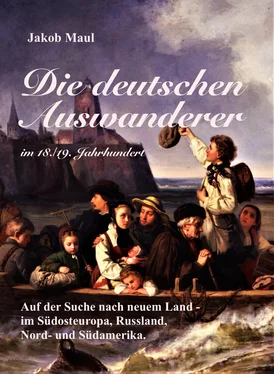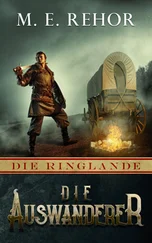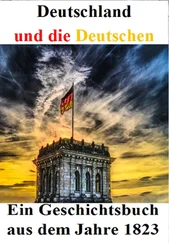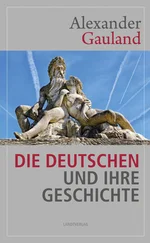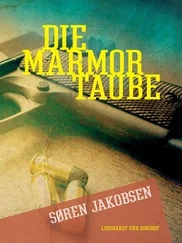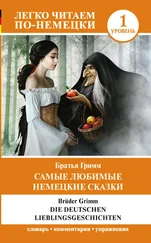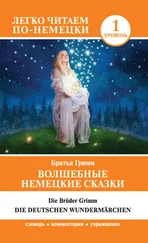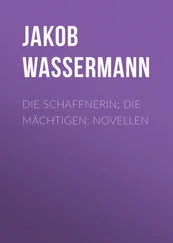1 ...8 9 10 12 13 14 ...20 Trotz der bedeutenden Zahl an Ausländern, die zur Zeit Peters I. nach Russland kamen, hatte ihre Übersiedlung noch keinen organisierten und planmäßigen Charakter. Sie ließen sich in der Regel in der Hauptstadt und anderen russischen Großstädten nieder.
3.2. Kolonisationsprojekte zur Zeit
von Zarin Elisabeth
Das Erscheinen deutscher Kolonisten in Russland im 18. Jahrhundert wird normalerweise mit dem Namen Katharinas II. (der Großen) in Verbindung gebracht, der deutschen Prinzessin Sophie Auguste Friederike von Anhalt-Zerbst. Diese wuchs im Haus ihres Vaters, des Herzogs von Anhalt-Zerbst, auf, welcher unter Friedrich II. den Preußen diente. Durch diesen Umstand konnte sie sich bereits in jungen Jahren mit der Populationstheorie und ihrer praktischen Umsetzung in Preußen vertraut machen, und es ist wenig verwunderlich, dass sie zu einem aktiven Verfechter derselben wurde, als sie den russischen Thron bestieg.
Allerdings war sie nicht die erste, die diese Ideen in Russland verwirklichte. Schon zur Regierungszeit Elisabeths (Elisabeth Petrovna) gestattete die russische Regierung Auswanderern aus Serbien die Übersiedlung in die Ukraine und siedelte sie am rechten Dnjepr Ufer entlang der damals verlaufenden Grenze zu Polen an. Aus den 16.000 serbischen Siedlern, die sich an diesen Orten niedergelassen hatten, wurden ein Husaren- und ein Infanterieregiment gebildet. Diese hatten die Aufgabe, die russischen Grenzen zu schützen, und ihr kompaktes Siedlungsgebiet erhielt die Bezeichnung Neuserbien. In der Folge siedelten sich in Russland nochmals mehrere Tausend Serben an, denen Ländereien in der Provinz Bachmutsk am linken Flussufer des Severskij Donez, einem großen Zulauf des Don, zugewiesen wurden, und ihre Siedlungen erhielten die Bezeichnung Slawjanoserbien. 2Im Jahr 1764 gehörten diese Gebiete dem erneut geschaffenen Neurussischen Gouvernement an, seine Bewohner wurden als staatliche Bauern registriert, und die Offiziere erhielten den Adelstitel und Ländereien.
Die ersten Projekte im Zusammenhang mit der Einladung ausländischer Staatsangehöriger nach Russland, die die Kolonisation öder Landstriche zum Ziel hatten, wurden ebenfalls noch zur Regierungszeit Elisabeths ausgearbeitet. Die russische Regierung, die sich unter dem Eindruck der erfolgreichen Peuplierungspolitik Preußens befand, setzte sich intensiv mit dem Projekt von Francois de Lafont auseinander, der vorgeschlagen hatte, die noch in Frankreich verbliebenen Protestanten nach Russland umzusiedeln. In seinem Projekt schlug er vor, dem Beispiel des preußischen Königs zu folgen und eine Einladung in Form eines Manifests der russischen Kaiserin unter Angabe der für Übersiedler geltenden Rechte und Privilegien in französischen Zeitungen zu veröffentlichen. Man schlug vor, die Franzosen in der Ukraine entlang des Dnjepr oder an den Wolgaufern und in der Nähe Moskaus anzusiedeln. Das Projekt sah vor, dass die russische Regierung den Übersiedlern die freie Religionsausübung und eine 15-jährige Befreiung von Steuern und Abgaben zusichern, die Kosten des Umzugs und der für die Betriebseröffnung notwendigen Materialien, Gerätschaften, Tiere und Werkzeuge übernehmen, den Nachkommen das Recht auf den Besitz der Ländereien und die freie Ausreise aus dem Land gewähren und den Fabrikbesitzern verschiedene Vergünstigungen garantieren sollte, zu denen auch das Recht auf russische Bauern als Leibeigene gehörte.
Das Projekt wurde vom Kollegium für Auslandsangelegenheiten geprüft, welches zwar einzelne Vergünstigungen einschränkte, dabei jedoch die Steuerbefreiung auf 20 Jahre ausweitete und der Übergabe von Bauern als Leibeigene zustimmte. Die Instruktion, anhand derer Franzosen für den Umzug nach Russland angeworben werden sollten, wurde bestätigt, in den Küstenstädten wurden Sammelpunkte eingerichtet und die Bedingungen und das Verfahren für den Transport der Übersiedler festgelegt. Nachdem das Kollegium für Auslandsangelegenheiten alle Bedingungen und das Anwerbe-, Transport- und Ansiedlungsverfahren der Franzosen in Russland in einem Sonderbericht dargelegt hatte, schickte es diesen am 14. Januar 1753 an Kanzler Bestuschew-Rjumin, der es der Kaiserin zur Bestätigung überreichen sollte. Dies hatte allerdings keine Resolution der Kaiserin zur Folge, erst im darauffolgenden Jahr ordnete sie mündlich die Übergabe des Berichts an den Senat an. Diesem wurde das Recht eingeräumt, zu allen Fragen, die den Siedlungsort und die den Übersiedlern zugesprochenen Vergünstigungen betrafen, eine Lösung zu finden.
Die extrem langsame Senatsarbeit und der Ausbruch des Siebenjährigen Krieges verhinderten letztendlich eine Bestätigung des Projekts von De Lafont. Ein nicht weniger trauriges Schicksal wurde auch dem Projekt des sächsischen Generals Weißbach zuteil, welcher vorgeschlagen hatte, sich die durch unzählige Kriegsquartiere, die Einberufung von Rekruten und die harten Strafen Friedrichs II. im Zuge des Siebenjährigen Krieges entstandene Emigration aus Preußen in angrenzende polnische Gebiete zunutze zu machen. Die aus Pommern, Preußen und Schlesien stammenden Flüchtlinge, die mehrheitlich Protestanten waren, erhielten nicht nur keinerlei Unterstützung von der polnischen Regierung, sondern wurden auch von der katholischen Kirche unterdrückt. Weißbach wollte mit seinem Projekt insbesondere die militärische Macht Friedrichs II. schwächen und die massenweise Desertation aus seiner Armee noch weiter verstärken. Er schlug vor, die deutschen Flüchtlinge in Südrussland anzusiedeln und ihnen eine ganze Reihe von Vergünstigungen und Privilegien zu gewähren. 3
3.3. Kolonisationspolitik und Manifeste
Katharinas der Großen
Wir sehen also, dass die Frage, wie ausländische Staatsangehörige zur Eroberung öder und zurückeroberter russischer Gebiete angelockt werden sollten, zur Zeit Elisabets von der russischen Regierung bereits untersucht und im Hinblick auf das Treffen praktischer Entscheidungen Vorbereitungsmaßnahmen getroffen worden waren. Anhand dieser umfangreichen Vorbereitungsmaßnahmen lässt sich auch erklären, weshalb Katharina II. ihr erstes Manifest vom 04. Dezember 1762 innerhalb kurzer Zeit verabschiedete – es wurde nämlich lediglich fünf Monate nach ihrer Krönung am 28. Juni 1762 veröffentlicht. Dieses Dokument lud Ausländer verschiedener Nationalitäten (Juden ausgenommen) dazu ein, sich in Russland anzusiedeln, und gestatteten Flüchtlingen die Rückkehr in ihre Heimat, die sie zuvor aus verschiedenen Gründen verlassen hatten. Mit ihrem Manifest setzte Katharina II. die Projekte fort, die bereits unter Elisabeth Petrovna begonnen worden waren, ihr Schwerpunkt lag dabei jedoch nicht mehr in der Schaffung neuer Fabriken und Manufakturen in den Städten, sondern in der Entwicklung des Ackerbaus und der damit verbundenen Gewerbe. Obwohl das Manifest in verschiedenen Sprachen gedruckt und in den Ländern Europas verteilt wurde, zog es keine praktischen Folgen nach sich. Dies hatte damit zu tun, dass es keine konkreten Bedingungen und Vergünstigungen für Übersiedler enthielt.
Eine solche Reaktion auf das erste Manifest Katharinas II. stellt einen sehr wichtigen Punkt dar, der klar aufzeigt, dass in der europäischen Bevölkerung zu jener Zeit keine potenziellen Migranten existierten, die ohne wesentliche und genau definierte Bedingungen, Vergünstigungen und Garantien dazu bereit waren, in andere Länder wie Russland überzusiedeln.
Darüber war sich auch die russische Regierung im Klaren, weshalb sie aktiv an der Vorbereitung eines neuen, grundlegenden Dokuments arbeitete. Dieses stellte schließlich das weit bekannte Manifest Katharinas II. vom 22. Juli 1763 dar: „Über die allen nach Russland einreisenden Ausländern erteilte Erlaubnis, sich in Gouvernements ihrer Wahl niederzulassen, und über die ihnen gewährten Rechte“ . Am selben Tag wurden von ihr der „Erlass an den regierenden Senat über die Einrichtung einer Vormundschaftskanzlei für Ausländer“ und die „Instruktion der Vormundschaftskanzlei für Ausländer hinsichtlich ihrer Pflichten bei der Organisation der Aufnahme ausländischer Übersiedler in Russland“ . 4
Читать дальше