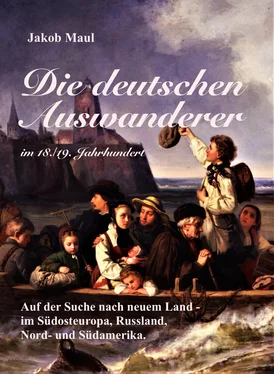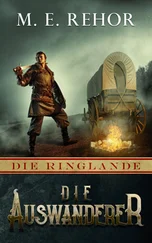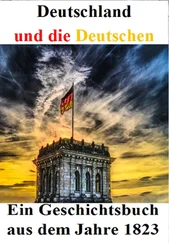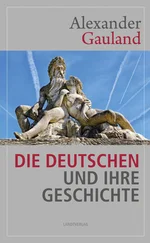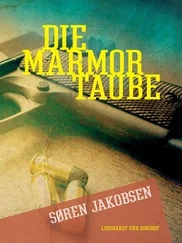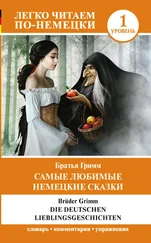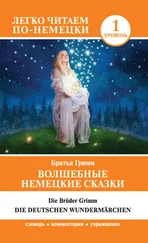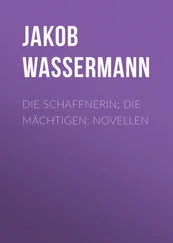1 ...7 8 9 11 12 13 ...20 Ungeachtet der bisweilen auftretenden Konflikte entstanden im Banat insgesamt tolerante, Nationalitäten übergreifende Beziehungen zwischen verschiedenen Völkern, die sich hier niedergelassen hatten. Die deutschen Kolonisten brachten ihre Kenntnisse, Fähigkeiten und Erfahrungen in der Landwirtschaft, der Industrie und dem Bauwesen in ihren kompakten Siedlungsgebieten gewinnbringend ein, worauf sie mit der Zeit auch von anderen Völkern übernommen wurden.
2.3. Besonderheiten und Bedingungen der
Massenemigration nach Südosteuropa
Im 18. Jahrhundert schlugen die deutschen Kolonisten im Zuge ihrer Massenemigration auch andere Richtungen ein, besiedelten Ländereien in Nord- und Südamerika, den Provinzen Ostpreußens, der baltischen Herzogtümer, Polens und Südrusslands und machten diese nutzbar. Doch lediglich die Übersiedlung nach Südosten, bei der die ungarischen Ländereien besiedelt und erschlossen wurden, vollzog sich auf Einladung und unter der Leitung der österreichischen Monarchen auf dem Gebiet des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation. Auch wenn diese Übersiedlung von einer zentralen Macht organisiert und finanziert wurde, was die Ausreise in vielerlei Hinsicht erleichterte, waren der Transport, die Unterbringung an den Siedlungsorten und ihre Bedingungen in verschiedenen Zeiträumen in hohem Maße unterschiedlich. Tabelle 1 unten zeigt die wesentlichen, für Kolonisten bei der Übersiedlung ins damalige Ungarn geltenden Bedingungen in verschiedenen Phasen des 17. Jahrhunderts. Dabei wurde auf die Daten historischer Quellen zugegriffen, die im Forum birda.de veröffentlicht sind und weiter oben in Kapitel 1 angeführt werden. 3-6
Tabelle 1
Ermäßigungen und Privilegien der deutschen Kolonisten zu Zeiten der massenweisen Übersiedlung deutscher Kolonisten im 18. Jahrhundert
| Zeitraum der Übersiedlung |
Wegzoll |
Steuerermä-ßigungen |
Zugeteiltes Land und Privilegien |
| Karl VI. (1722-1726) |
Verheiratete Erwachsene - 12 Kreuzer Unverheiratete Erwachsene – 6 Kreuzer Je Kind – 2 Kreuzer |
3 Jahre Befreiung von Steuerzahlungen. Nach 3 Jahren -12 Gulden Steuern. Nach 6 Jahren - 18 Gulden Steuern. Nach 12 Jahren - 24 Gulden Steuern. |
1 Joch - Hofgelände 24 Joch - Ackerland 6 Joch - Wiese Haus holz. Landwirtschaftliche Geräte. Haustiere. |
| Maria Theresia (1763-1772) |
Erwachsene – 6 Kreuzer Je Kind – 2 Kreuzer |
6 Jahre Steuerbefreiung |
1 Joch - Hofgelände 24 Joch - Ackerland 6 Joch - Wiese 6 Joch - Weidefläche Landwirtschaftliche Geräte. Haustiere. Haus holz. Vorauszahlung für den Hausbau. Später Hausbau auf Kosten des Staates |
| Joseph II. (1781-1787) |
Erwachsene – 6 Kreuzer Je Kind – 2 Kreuzer |
10 Jahre Steuerbefreiung |
32 Joch allgemeines Land und 4 Joch allgemeine Weidefläche. Landwirtschaftliche Geräte und Haustiere. Hausbau auf Kosten des Staates. |
1. Ein Joch entspricht ungefähr 0,57 ha
2. Ein Gulden entspricht 60 Kreuzern
Wie aus den Daten der Tabelle hervorgeht, wurden die Übersiedlungsbedingungen aus ökonomischer Perspektive mit jedem Folgezeitraum vorteilhafter und attraktiver: Wurden die Kolonisten zu Beginn des Jahrhunderts während der Regierungszeit Karls VI. über einen Zeitraum von drei Jahren und in der Mitte des Jahrhunderts während der Regierungszeit Maria Theresias über einen Zeitraum von sechs Jahren von der Steuerzahlung befreit, so waren sie gegen Ende des 18. Jahrhunderts während der Regierungszeit Josephs II. 10 Jahre lang vollständig von der Steuerlast befreit. Genauso verbesserten sich auch die Finanzierungsbedingungen für den Wohnungsbau und die Bedingungen für den Erwerb von landwirtschaftlichem Inventar und Haustieren.
All das geschah nicht zufällig und infolge einer Laune der plötzlich gutmütig gewordenen österreichischen Monarchen, vielmehr ging die Verbesserung der Einladungs- und Siedlungsbedingungen für die Übersiedler auf eine ganze Reihe von Faktoren zurück. So war bereits Maria Theresia auf die Konkurrenz des preußischen Königs Friedrich II. und der russischen Zarin Katharina II. gestoßen, die sich ebenfalls aktiv um die Anwerbung und Übersiedlung deutscher Kolonisten in ihre Länder bemühten. Gerade aus diesem Grund sah sich Maria Theresia gezwungen, die Bedingungen für den Zuzug von Kolonisten zu verbessern. Für diese wurde der Zeitraum, in dem keine Steuern erhoben wurden, verdoppelt, daneben erhielten sie eine umfangreichere staatliche Unterstützung beim Bau ihrer Höfe und Wohnungen.
Dennoch blieben die Zahlen derer, die nach Ungarn übersiedelten, hinter den Erwartungen zurück, was insbesondere auf die religiösen Einschränkungen zurückzuführen war. Bekanntermaßen gab Maria Theresia durch ihre Bedingungen katholischen Übersiedlern den Vorzug, während Friedrich II. und Katharina II. Übersiedler unabhängig von deren Glaubenszugehörigkeit nach Preußen und Russland einluden. Dieser Fehler wurde später mit den Einladungsbedingungen von König Joseph II. aufgehoben. Dieser brachte 1781 einen speziellen Erlass (das Toleranzpatent) heraus, welcher alle Einschränkungen aufhob und den Protestanten den Umzug in katholische Länder der Habsburger-Dynastie gestattete.
Kapitel 3.
Deutsche Kolonisten in Russland
3.1. Geschichte der Beziehungen
Kontakte zwischen den Bewohnern deutscher Fürstentümer und der Kiewer Rus werden erstmals gegen Ende des ersten Jahrtausends unserer Zeitrechnung erwähnt, und bereits im Mittelalter luden russische Monarchen fremde Staatsangehörige nach Russland ein. Diese wurden für den Kriegsdienst angestellt oder waren als Händler, Mediziner, Apotheker, Bauarbeiter und Meister verschiedener Gewerbe tätig. Sie ließen sich hauptsächlich in Moskau und später im 16., 17. und 18. Jahrhundert in Sankt Petersburg, Woronesch, Saratow und anderen Städten in den sogenannten „deutschen Vorstädten“ nieder.
Während der Regierungszeit Peters I. (des Großen, 30.5.1672 – 28.1.1725) brach für Russland ein neuer Entwicklungsabschnitt an. Die Veränderungen betrafen alle Bereiche des alltäglichen Lebens, die Armee wurde verstärkt und perfektioniert, die Handelsbeziehungen wurden verbessert, Werke und Fabriken wurden erbaut, die staatliche Verwaltung und die internationalen Beziehungen wurden optimiert und die ökonomische und kulturelle Rückständigkeit Russlands wurde überwunden. Dabei machte sich Peter I. die Erfahrung der westeuropäischen Länder und der dort ansässigen Spezialisten zunutze, die Russland durch die Möglichkeit anlockte, ihre Kenntnisse einbringen und schnell Karriere machen zu können. In seinem speziellen Manifest vom 16. April 1702 („Über die Ansiedlung von Ausländern in Russland beim Versprechen freier Religionsausübung“) versprach er den ausländischen Spezialisten einen hohen Lohn, gute Lebens- und Arbeitsbedingungen und freie Religionsausübung, verlangte jedoch auch nach Lehrlingen und der Ausbildung russischer Fachkräfte, die die ausländischen Spezialisten ersetzen sollten. Die Einladung Peters I. und seine Reformen führten zu einer erheblichen Intensivierung des Zustroms von Ausländern nach Russland. Bei diesen bildeten die Auswanderer zahlreicher deutscher Fürstentümer die Mehrheit. Für viele von ihnen wurde Russland zur zweiten Heimat, welcher sie selbst und ihre Nachkommen ergeben dienten, und zu deren Wohl sie ihr Wissen, ihre Seele und Erfahrung einbrachten. Bei allen Initiativen und Reformen Peters I. kamen ausländische Spezialisten zum Einsatz, die erheblichen Anteil an der Entwicklung und Optimierung des Staatsapparates, der Wissenschaft, Kunst, Architektur, Medizin, Wirtschaft, Armee, Flotte und der Kultur in Russland hatten.
Besonderes Augenmerk wurde auf die Entwicklung des Außenhandels gelegt. Den ausländischen Kaufleuten, die ins Land eingeladen wurden, wurden bestimmte Vergünstigungen gewährt. Unter den etwa 8.000 Ausländern, die zur Zeit Peters I. in Russland ankamen, waren etwa 500 Kaufleute, die Waffen, Metalle, Stoffe und andere Bedarfsgüter ein- und in Russland hergestellte Waren ausführten. 1
Читать дальше