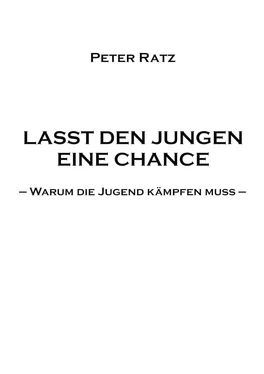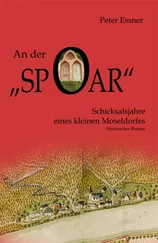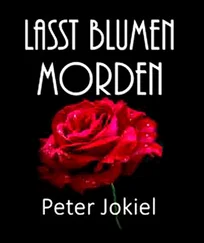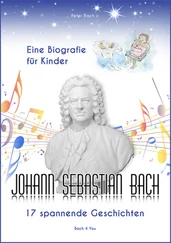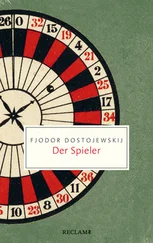Die bisherige Entwicklung in nahezu allen Bereichen des wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Lebens gründet sich auf das Grundprinzip: mehr – mehr – immer mehr. Aufschwung wurde bisher nur durch steigende Mobilisierung von Ressourcen bewirkt. Die so erreichten Verbesserungen sind die Folge industrieller Fertigung in immer größerem Stil. Sie produziert über den eigentlichen Bedarf hinaus. Die Ware muss aber auch abgesetzt werden. Dazu muss der Mensch unzufrieden gemacht werden mit dem, was er hat. Ihm wird eingeredet, mehr Besitz bedeute auch mehr Glück und Freude. Als am leichtesten zu beurteilende Größe ist der Besitz Maßstab und Ausdruck der sozialen Rangordnung, und das schon immer. Die Produktion macht sich von den wirklichen Bedürfnissen unabhängig. Sie schafft über die verschiedensten Formen der Werbung neue Wünsche, die der Einzelne sich erfüllen soll und letzten Endes auch will. So schrauben Produktion und Konsum einander in immer neue Höhen. Es entsteht der Konsum – Mensch mit unaufhörlicher Konsumsteigerung als Lebensziel.
Man kann die Situation auch beschreiben als Beziehung von Bevölkerungswachstum und Steigerung des Lebensstandards auf der einen Seite sowie Verbrauch der Ressourcen durch Produktion von Waren auf der anderen. In den Industrieländern, aber nicht nur dort, hat sich der Glaube verfestigt, Fortschritt bestehe darin, von allem immer mehr und immer Besseres haben zu können. Für die Entwicklungsländer sind die Lebensverhältnisse in den Industrieländern wie die Verheißung des Paradieses auf Erden. Sie folgen dem Weg, den die Menschen in den Industrieländern genommen haben. So konsumieren zu können, wie ihnen von den Medien dargestellt wird, ist der Traum vieler Menschen. Sie können nicht wissen, dass bei allem verführerischen Glanz auch viel Schatten besteht. Die Industrieländer bestärken die Menschen anderswo in ihrem schiefen Bild, weil sie so zu guten Verbrauchern werden. Selbstverständlich sollen sie die Waren der Industrienationen oder ihrer Unternehmen kaufen und am besten in Naturalien bezahlen. Diese Wunschvorstellungen regen die Nachfrage stark an. Beide Entwicklungen, die der Bevölkerungszunahme und der gleichzeitigen Steigerung des Lebensstandards, lassen sich nur über eine Steigerung der Produktion erreichen. Auf Dauer aber ist dieser Weg nicht möglich. Rohstoffmangel, Energieknappheit und die Begrenztheit landwirtschaftlich nutzbarer Flächen setzen dem dauernden Wachstum unerbittlich ein Ende. Das Lebensmittelproblem wird durch das verantwortungslose Verhalten der Industrieländer sehr verschärft. Ausführlichere Darlegung des Problemkreises finden Sie in den Kapiteln, die von Globalisierung sprechen und davon, dass wir bei unserem heutigen Lebensstil zwar unbekümmert verbrauchen, dass aber die Nachkommen dafür bezahlen müssen.
Das Ungleichgewicht von Verbrauch und Reserven, also von Konsum und Produktion einerseits und der begrenzten Menge an Rohstoffen andererseits, führt unweigerlich zu einem Zusammenbruch der Zivilisation weltweit, die von einer ständigen Verfügbarkeit der Ressourcen abhängt. „Jede Kette ist so stark wie ihr schwächstes Glied“, sagt man. Wenn wesentliche Rohstoffe fehlen, wird die gesamte Kette der modernen Lebensabläufe unterbrochen. Eines hängt vom anderen ab. Wenn keine Computer mehr gebaut werden können, weil die dazu nötigen seltenen Elemente nicht mehr da sind, dann bricht alles zusammen. Dasselbe gilt auch für fossile Brennstoffe und vieles andere mehr. Deshalb können wir die Produktion nicht so weit steigern, dass alle Menschen ein Lebensniveau erreichen wie in den Industriestaaten heute üblich. Selbst der heutige Verbrauch lässt sich nicht auf Dauer halten.
Wollen wir auf Dauer als wissenschaftlich – technisch orientierte Kulturen überleben, müssen wir den Verbrauch an die Möglichkeiten anpassen, die uns die Erde bietet. So besteht der einzige Ausweg darin, das Wachstum umzukehren. Die Bevölkerung muss schrumpfen. Statt immer mehr zu fordern und mehr zu erwarten, müssen wir schleunigst lernen, Maß zu halten und unsere Forderungen zurück zu schrauben. Das gilt für alle reichen Länder. Nicht mehr das Wünschenswerte darf unser Handeln bestimmen, sondern das Vernünftige, das Notwendige. Wir müssen damit jetzt anfangen, nicht morgen oder gar übermorgen. Überall auf der Welt. Gleichzeitig. Wir haben keine Wahl. - Dabei können wir nicht hinnehmen, dass die Menschen in den Entwicklungsländern nicht einmal die Grundbedürfnisse befriedigen können, die zu einem Leben in Würde gehören. Die Industrieländer müssen ihre Anforderungen an die materiellen Güter senken, die Entwicklungsländer müssen den Weg aus Hunger und Elend finden. Wir müssen Solidarität üben.
„Am Golde hängt, zum Golde drängt doch alles.“ ( J. W. Goethe, Faust I ) - Ist das Geld wirklich das Wichtigste in unserem Leben? Ordnen wir dem Besitz und der Sehnsucht nach Anerkennung und Macht alles Andere unter? Zählen Freundschaft, Liebe, Ehre, Anstand, Gerechtigkeit und Freiheit so wenig?
BESITZ
Mit dieser Feststellung drückte Goethe vor rund 150 Jahren den immer währenden Drang nach Besitz aus. Besitz verleiht Ansehen und Macht. Bei den gesellig lebenden Säugetieren ist in der Regel die Grundfrage, von dem die Beantwortung fast alle anderen abhängt: „Wer ist der Bestimmende?“ Das entscheidet bei den Männchen nicht nur über die Stellung im Rudel, sondern in Zusammenhang damit auch darüber, wer die Begattung vollziehen darf und wer warten muß oder überhaupt nicht zum Zuge kommt. Die endgültige Entscheidung darüber treffen aber häufig die Weibchen. Sie wird von den Männchen geachtet. Bei den Menschen ist das wegen der kulturellen Überlagerung nicht mehr ganz so offensichtlich. Aber jedem Beobachter wird rasch klar, dass derjenige Mann besonders gute Chancen bei den Frauen hat, der Geld besitzt oder eine hohe Position oder sich einer besonderen Anerkennung erfreut. Insofern ist der Wunsch nach diesen auszeichnenden Eigenschaften verbreitet und sehr verständlich. Die Eigenschaft, die am leichtesten vorgezeigt werden kann, ist der Reichtum. Daran hat sich, soweit schriftliche Zeugnisse in die Vergangenheit reichen, nichts geändert. Körperliche Schönheit, Kraft und Mut gehören zu den Eigenschaften, die einen Menschen auszeichnen, die aber weitgehend angeboren sind. Geld aber kann auch der erreichen, dem diese Qualitäten fehlen, sei es auch nur dadurch, dass er es erbt. Aber wieso haben das Geld und seine verschiedenen Erscheinungsformen eine so große Macht über uns bekommen, dass alles Andere dadurch beinahe verdrängt wurde?
REGELN FÜR DAS ZUSAMMENLEBEN
Die zehn Gebote
Alle Völker haben Regeln und Gesetze für ihr Zusammenleben entwickelt. C. G. Jung stellte fest, dass sie sich in allen Kulturen ähneln. Sie sind also die Grundlage für ein gedeihliches Miteinander, die Voraussetzung für eine erfolgreiche Gemeinschaft. Sie erst machen das Überleben einer Gruppe in einer schwierigen, oft als feindlich empfundenen Umgebung möglich.
In der abendländischen Welt sind es die zehn Gebote, in der islamischen die Gebote und Vorschriften des Koran. Dort und überall sonst wurden die grundlegenden Vorstellungen angereichert mit den kulturellen Besonderheiten der jeweiligen Weltgegend. Die zehn Gebote dürften zwar allgemein bekannt sein, dennoch seien sie in ihrer Kurzform noch einmal zitiert. Die Originalform findet sich in der Bibel, Zweites Buch Moses, Kapitel 20, bzw. Fünftes Buch Moses, Kapitel 5. Alles, was sich später im jüdisch – christlichen Raum an Gesetzen ergab, geht auf das eine oder andere Gebot zurück.
1) Du sollst keine anderen Götter haben neben mir.
2) Du sollst dir kein Bildnis noch irgendein Gleichnis machen, bete sie nicht an und diene ihnen nicht.
3) Du sollst den Namen des Herrn, deines Gottes, nicht missbrauchen.
Читать дальше