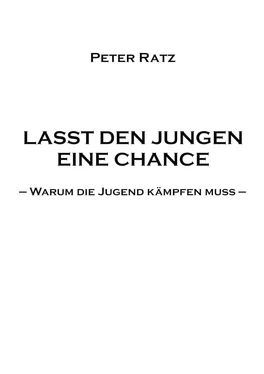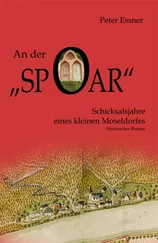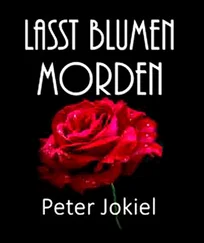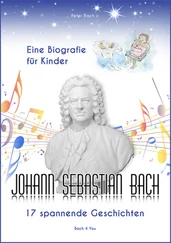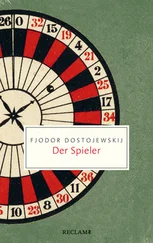1 ...7 8 9 11 12 13 ...16 Theater, Opern- und Konzerthäuser mit ihren Ensembles werden vom Staat finanziell unterstützt, weil wir Europäer diese Formen der Hochkultur bewahren möchten. Sie sind im wirtschaftlichen Sinn unrentabel. Dasselbe gilt für den europäischen Film. Sollte das Freihandelsabkommen in der vorgesehenen Form Wirklichkeit werden, bekämen alle nordamerikanischen Betreiber von Musicals und alle Filmproduzenten das Recht auf die gleiche finanzielle Unterstützung. Das wäre nicht mehr zu bezahlen. Also müssten wir Europäer unsere Theater, unsere Opern- und Konzerthäuser schließen und die europäische Filmherstellung beerdigen. Das kann aber von Kulturnationen niemals gut geheißen werden.
Ein ähnliches Schicksal würde den öffentlich – rechtlichen Sektor bei Radio und Fernsehen betreffen. Auch die Buchpreisbindung, die die Vielfalt der verlegerischen Landschaft schützt, würde verschwinden.
Konzerne könnten umstrittene Technologien wie das Fracking durchsetzen, auch gegen den Willen und die bestehenden nationalen Gesetze eines Landes. Investitionsabkommen mit den schon beschriebenen Gefahren können vereinbart werden. Die Befürworter solcher Abkommen rechnen vor, wie alle aus dem Abkommen Nutzen ziehen, Unternehmen ebenso wie Verbraucher. Neue Arbeitsplätze würden ebenfalls geschaffen, versprechen sie.
Die Befürworter verschweigen aber, dass jede Liberalisierung dieser Art auch Verlierer hervor bringt. Man richte den Blick auf das Freihandelsabkommen, das zwischen den ungleichen Partnern
USA und Mexiko geschlossen wurde. Greifen wir einen Bereich des Abkommens heraus. Früher hatte der Staat Mexiko den Kleinbauern den Mais zu einem Festpreis abgekauft. Mit dem Freihandelsvertrag war das nicht mehr möglich. Der hoch subventionierte US – Mais wurde zu Preisen in Mexiko verkauft, zu denen die Mexikaner ihn nicht produzieren konnten. Die Bauern konnten ihren überschüssigen Mais nicht mehr verkaufen. In zehn Jahren verließen zwei Millionen Kleinbauern ihre Betriebe und ihre Dörfer. Sie wanderten ab in die Großstädte oder versuchten, sich in den USA ein neues Leben aufzubauen.
In Südkorea entwickelt sich eine ähnliche Situation wie in Mexiko. Heute erzeugen die Südkoreaner mehr Reis, als sie essen. Dadurch fällt der Reispreis.Die Welthandelsorganisation zwingt den Staat, Reis aus den USA, Japan und Ägypten zu importieren. Das treibt den Preis für Reis in Südkorea noch weiter nach unten. Der südkoreanische Staat kauft den Bauern ihre Reisernte zu einem Garantiepreis ab. Aber wenn das Freihandelsabkommen in Kraft tritt, wird es diesen Ausweg für die Bauern nicht mehr geben. Es wird ihnen genau so gehen wie den Kleinbauern in Mexiko. Nur gibt es keinen wirtschaftlich starken Staat in ihrer Nähe, in den sie auswandern könnten.
Bei den Ankündigungen, wie positiv sich Freihandelsabkommen auswirken, wird darauf hingewiesen, dass die daran teilnehmenden Partner Gewinne machen werden. Gesamtwirtschaftlich mag das stimmen. Aber schon, wenn es um die Arbeitsplätze geht, heisst es nicht mehr „wird“, sondern nur noch „kann“. Niemand garantiert, dass Arbeitsplätze nicht verloren gehen. Der Staat muss seine Bürger und deren Lebenssicherheit schützen. Sollen Verträge geschlossen werden, die diese Grundlagen gefährden können, muss man von solchen Plänen zurücktreten.
Produktionsanreize
Der Technologietransfer, die Übertragung von Kenntnissen also, sorgt dafür, dass bei der Qualität der hergestellten Produkte kein großer Unterschied bestehen muß. Der Kampf um Absatzmöglichkeiten folgt, wenn nicht über die Qualität, dann über den Preis. Das Ziel ist, möglichst viel zu verkaufen und dabei einen möglichst großen Gewinn machen. Das bedeutet, man versucht, möglichst billig einzukaufen und möglichst teuer zu verkaufen. Der Verbraucher ist bemüht, für sein Geld möglichst viel zu bekommen. Er sucht also nach den billigeren oder billigsten Angeboten, getreu dem Werbespruch einer großen Handelskette: „Geiz ist geil“. Diesem Wunsch müssen Produktion und Handel entsprechen.
Muß man mit dem Preis herunter gehen, will man wenigstens die verkaufte Menge erhöhen. Es ist das Prinzip der Discounter. Solche Verhältnisse führen zum Kostendruck bei den Produzenten, bei denen der größte Kostenfaktor die menschliche Arbeit ist. Will man die Produktionskosten senken, hat man verschiedene Möglichkeit. Man kann billiges Ausgangsmaterial wählen, kann möglichst niedrige Löhne zahlen und man kann mit möglichst wenig Menschen produzieren. Die Einsparmöglichkeiten lassen sich leicht miteinander kombinieren.
Sind aber immer weniger Menschen in Lohn und Arbeit oder bekommen sie immer weniger Geld für ihre Tätigkeit, geht die Kaufkraft zurück. Man kann sich nicht mehr viel leisten. Der Drang zum Billigprodukt wird größer. Der Konsum nimmt ab. Die Produktion muß entsprechend verringert und weiter verbilligt werden. Nun braucht man noch weniger Beschäftigte. Damit ist die nächste Runde der wirtschaftlichen Abwärtsspirale eingeleitet.
Konsum-Menschen
Die weltweit tätigen Unternehmen sind Wirtschaftsunternehmen. Die Globalisierung hat neben den wirtschaftlichen Auswirkungen auch einen großen Einfluß auf die Kulturen der Völker. Der von Herstellern und Händlern gewünschte, auf Konsum ausgerichtete westliche Lebensstil soll weltweit verbreitet werden. Die ständige Unzufriedenheit mit dem, was man hat und was man ist, soll lebensbeherrschende Grundeinstellung werden. Alle sollen zu dem Glauben bekehrt werden, durch den Erwerb materieller Güter könne man glücklich werden. Man müsse nur das richtige Produkt besitzen. Welches das ein soll, führt uns in äußerst phantasievoller, aufdringlicher und stets wechselnder Form die Werbung vor. Die Anpreisungen beschränken sich nicht auf Gegenstände. In gleicher Weise werden auch geistige Erzeugnisse auf den Markt und möglichst auch an den Mann
gebracht. Alles wird in gleicher Art vermarktet, ob Bier oder Auto, ob Schuhe, Kleider, Musik, Bücher oder Kunst. Alles soll zu Geld werden. Die ausgefeilte Technik der Menschenbeeinflussung durch Werbung ist unaufhörlich und überall tätig. Man kann sich dieser Einwirkung nicht völlig entziehen, wenn man in einer technisch beeinflussten Umgebung lebt. Die westliche Lebensweise hat sich von hohen Idealen weit entfernt. Sie ist verkommen zu einem sinnlosen Kampf und Wettstreit um Konsumgüter.
Die Umwandlung des Menschen in einen Konsumenten bringt eine Veränderung der Ansichten, Ideen und des Lebensstils. Damit ändert sich auch die Form des Zusammenlebens, des Umgangs mit einander, der Beziehungen innerhalb der Familien, der Einstellung zur Religion und zur eigenen geschichtlichen Vergangenheit. Der Glaube an die glücklich und selig machende Kraft materiellen Besitzes, die Vergötterung der Diesseitigkeit, die Hingabe an das Prinzip des hier-und-jetzt machen uns zu Sklaven derer, die uns etwas verkaufen wollen, die es auf unser Geld abgesehen haben. Geld ist nicht nur ein Maßstab für materielle Werte. Es ist in gewisser Weise auch Lebenszeit. Jeder, der sich sein Geld selbst verdienen muß, verbraucht eine bestimmte Spanne seiner Lebenszeit, um es zu erwerben. Geld bedeutet eine Entsprechung in Lebenszeit. Der „Umrechnungskurs“ von Geld in Lebenszeit ist für die einzelnen Menschen sehr verschieden, abhängig von dem Lohn pro Arbeitsstunde. Wie lange müssen wir arbeiten, um einen bestimmten Artikel kaufen zu können? Jeder von uns sollte das einmal für sich ausrechnen. Wir haben alle eine begrenzte, genau bemessene Lebenszeit, deren Dauer wir allerdings nicht kennen. Wir sollten unsere wertvolle Lebenszeit bewusster einsetzen, damit auch das Geld. Man rechne Preise auf dem Boden des eigenen Umrechnungskurses in Lebenszeit um. Vielleicht bewahrt das manchen davor, den Marktschreiern, der Werbung also, auf den Leim zu gehen.
SCHLUSSBETRACHTUNG
Читать дальше