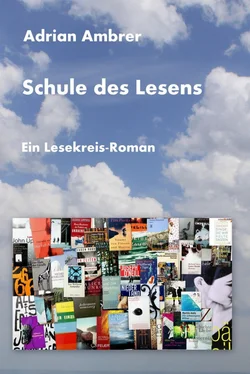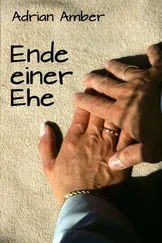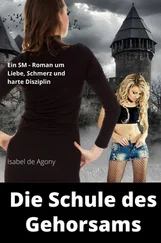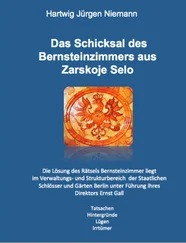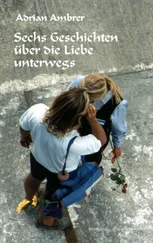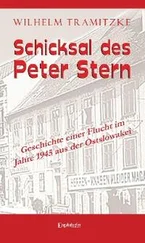„Nun bist du aber wirklich etwas hart. Du darfst hier nicht die Maßstäbe eines mit allen Hinterhoftricks der Literatur gewaschenen Junggenies wie Safran Foer anlegen“, meinte Elke. Immerhin könne man behaupten, dass man durch Narayans „Reifeprüfung“ mit einem traditionelleren Reifebegriff konfrontiert werde, der bei uns ein wenig aus der Mode gekommen sei, einer Vorstellung von Reife, die sich dadurch erfülle, dass sie die eigenen Flausen abstreife und sich in die Gesellschaft integriere – während im Westen Reife gerade dadurch definiert würde, dass man sich von Traditionen absetze, um neue Wege zu ergründen.
Das war´s dann. Man klopfte noch ein wenig mit den Knöcheln auf den Buchdeckel herum, als versuche man dadurch, neue Aspekte zu entdecken. Schließlich meldete sich Lothar zu Wort, um ein letztes Zitat vorzulesen: „ Chandran wurde Mitglied der städtischen Leihbibliothek und verschlang ungeheure Mengen zu allen Themen. Er entdeckte Carlyle. Er fand heraus, dass Shakespeare trotz allem doch einige bewegende Dramen geschrieben hatte und einige Dichter gar nicht so öde waren, wie man sie ihm dargestellt hatte. Seine Lektüre hatte kein System und keine Reihenfolge. Er verschlang die Bücher, wie sie ihm in die Finger kamen. Er las etwas Humoristisches und wechselte zu Carlyle, sprang zu Shakespeare, um dann zu Shaw und Wells überzugehen.“
Lothar hob den Kopf: „Jetzt kommt es: ` Am wichtigsten war ihm, dass eine Lektüre unterhaltsam war, und Bücher, die ihn zu langweilen drohten, klappte er unbarmherzig zu.´ Das beschreibt genau Narayans Programm, und so hat er auch sein Buch verfasst.“

III
Amos Oz:
Eine Geschichte
von Liebe und Finsternis
Kunst und Liebe gleichen sich darin, dass ein jeder sich in ihnen zu erkennen wünscht, mehr noch: sich auf das Vorteilhafteste in ihnen spiegeln möchte. Das ist aber der große Fehler, sagt Adorno. Ein Kunstwerk, das mir nur meine eigene Subjektivität widerspiegelt, sagt mir nichts über mich. Eine Liebesbeziehung, in der ich mich im anderen gleichsam nur verdoppelt sehe, ist der pure Narzissmus. Erst wenn sich das Kunstwerk mir entzieht, kann ich etwas über mich selbst lernen. Erst wenn ich den anderen in seiner Differenz zu mir wahrnehme und anerkenne, kann der Prozess beginnen, der von der Verliebtheit zur Liebe führt. Für das wirkliche Kunstverständnis oder die Liebe sind aber nur wenige geschaffen – die meisten erkennen in den Schwierigkeiten, mit denen dieser Prozess beginnt, schon das Scheitern des ganzen Projektes und werfen die Flinte ins Korn.
Frank hatte sich von seiner Frau Gisela getrennt und sich auf Gedeih und Verderb mit der schönen Karin verbunden. Er liebte Karin, und sie liebte ihn, aber ein jeder liebte den anderen auf eine besondere Art, die der Geliebte nicht verstand. Sie erkannten einander, sie rieben sich aneinander, sie ärgerten sich übereinander und waren doch entschlossen, einander lieben zu lernen. So empfing Frank den Lesekreis zum ersten und letzten Mal in seiner Junggesellenwohnung an der Subbelrather Straße in Köln-Ehrenfeld. Bald würden er mit Karin in das Japanische Viertel von Düsseldorf-Oberkassel umziehen, in der sie die nächsten Schritte ihres weiteren Lebens erproben wollten. Frank hatte passend zum heutigen Buch israelische und orientalische Speisen aufgetischt. Es wurde munter gefuttert, während Frank jüdische Musik auflegte.
Doch so gut es auch schmeckte, das heutige Buch – Amos Oz´ „Eine Geschichte von Liebe und Finsternis“ - war harte Kost. Lothar begann die Aussprache mit der Bemerkung, wie gut es sei, dass man die ausgewählten Bücher vorher nicht kenne, weil man sie sonst nicht wählen würde. Nicht, weil sie schlecht, sondern weil sie so schwierig zu lesen seien. Er selbst habe die 670 Seiten des Buches mit einer Mischung aus Leidensbereitschaft und Sturheit gelesen und sei erst kurz vor dem Lesekreistreffen fertig geworden.
Elke nickt, sagte aber nichts, denn sie hatte das Buch schon wieder nicht ganz gelesen, hoffte aber, durch die gemeinsame Zusammenfassung des Inhalts zu den anderen aufschließen zu können. Frank schwieg und schenkte den Wein ein.
Die folgende halbe Stunde verging damit, den Inhalt des Buches herauszuarbeiten. Marcel gab die Richtung vor, indem er vorschlug, die „Erzählpakete“ des Buches in vier Geschichten zu gliedern, wobei zu beachten sei, dass diese Geschichten parallel erzählt würden.
Zuerst enthielt das vorliegende Buch eine Geschichte des modernen Judentums, beginnend in den zionistischen Salons von Odessa, Wilna und Rowno, fortgesetzt über die Flucht aus Russland und den Holocaust bis hin zur Gründung des Staates Israel. Antisemitische Osteuropäer, Nazis, Bolschewiken und arabische Extremisten verfolgten die Juden auf diesem Weg, mordeten und peinigten sie, so gut sie es vermochten, so dass es am Ende fast einem Wunder glich, dass ein eigener Staat der Juden überhaupt entstehen konnte. Vor diesem historischen Hintergrund wurde zweitens die Familiengeschichte der Klausners und der Mussmanns über drei Generationen hinweg entfaltet, ehe sich Ariel Jehuda Klausner und Fanny Mussman, die Eltern des Autors, fanden und heirateten und der Roman schließlich - drittens - in die Biografie des kleinen Amos mündete. Der kleine Amos verlebte seine Kindheit im britischen Mandatsgebiet Palästina und wurde Zeuge der Teilung des Landes, der Entstehung des Staates Israel und des ersten Nahostkrieges. Doch Amos wurde nicht nur zum Bürger eines neuen Staates sondern auch zum Novizen in noch einer viel größeren Welt: dem Reich der Literatur. Wie aus dem sensiblen Einzelkind ein Schriftsteller wurde, das erschien als vierte und intimste Geschichte - und zugleich als die einzig mögliche Therapie, aus "Liebe und Finsternis" wieder herauszufinden.
Als wäre all das nicht schon anspruchsvoll genug, springt der Autor nicht nur zwischen diesen vier Ebenen hin und her, sondern auch noch zwischen den Zeiten vor und zurück. Gerade befindet man sich noch am Ende des ersten Nahostkrieges, dann geht es zurück in die Salons von Odessa. Auf der einen Seite wird der polnische Antisemitismus der Dreißiger Jahre beschrieben, auf der nächsten folgen Reflektionen über die beste Methode, Stoff für Kurzgeschichten zu erhalten. Die Erzählhaltung folgt keiner anderen Regel als der der frei assoziierenden Erinnerung, und wie diese geht sie vor und zurück, wechselt die Kategorien und die Protagonisten, bis sich schließlich, nach etwa der Hälfte des Buches, beim Leser das Gefühl einstellt, man sei der Zeuge eines ganzen Lebens geworden. Das hatte Lothar in ganz besonderer Weise beeindruckt. „Ich habe bei der Lektüre tatsächlich einen Anhauch des Entsetzens gespürt, das sich in den jüdischen Siedlungen ausbreitete, als sich arabischen Armeen anschickten, den jungen Staat zu vernichten. Und der Schmerz des kleinen Amos beim Freitod seiner Mutter hat mich so intensiv ergriffen, wie sich es sonst selten bei Büchern erlebe.“
Am Ende der Zusammenfassung waren sich alle einig, dass der Autor eine Menge zu bieten hatte, dass er aber auch den Leser bis an die Grenzen seiner Leistungsfähigkeit forderte. Wenn Eco das Kunstwerk mit einer "trägen Maschine" verglich, die der Mitarbeit des Rezipienten bedurfte, um in Schwung zu kommen, so drohte diese „Maschine“, das war Lothars Meinung, vor allem auf den ersten zweihundertfünfzig Seiten des Romans, immer wieder stecken zu bleiben, weil die epische Spannung, die der Autor mühelos entfaltete, sich durch seine asynchrone Erzähltechnik immer wieder verflüchtigte.
Frank erschien es fast so, als wolle der Autor durch die ambitionierte Form, die er seinem Roman gegeben hatte, alle Gelegenheitsschmökerer verscheuchen und nur die wirklichen Leser bei der Stange halten, um sie mit seiner Weisheit und seinem Humor zu belohnen.
Читать дальше