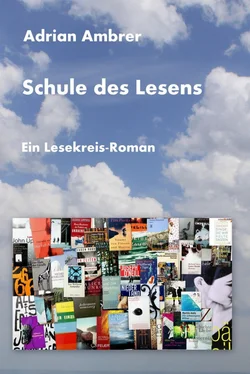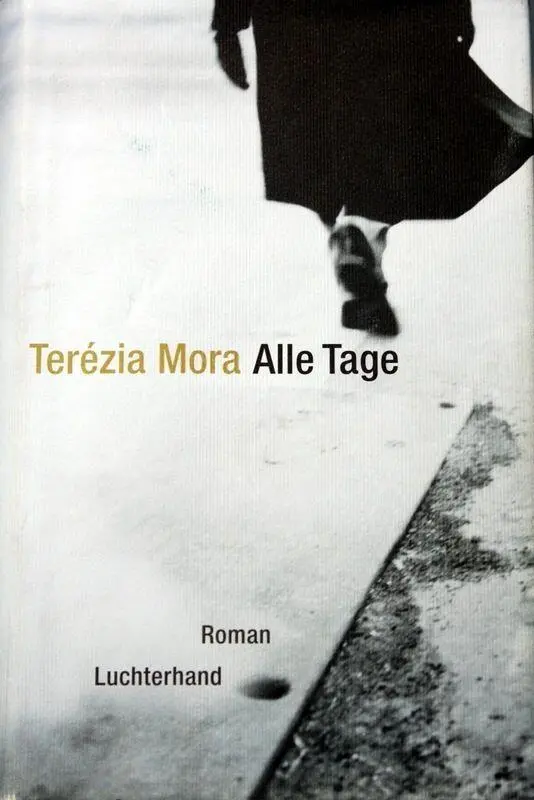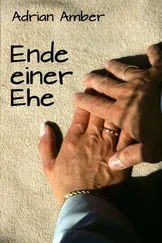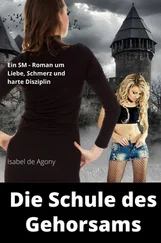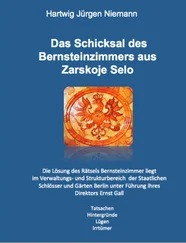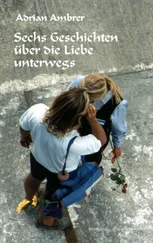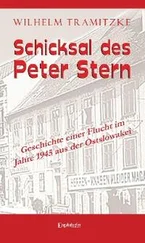„Wenn da nicht diese eigentümlichen Klammereinschübe wären, die mitunter eine halbe Seite einnehmen und deren Funktion mir schleierhaft ist“, warf Lothar ein.
„Damit bin ich auch nicht klargekommen“, gab Marcel zu. „Vielleicht haben wir hier eine zweite neutrale Erzählperspektive vor uns“, überlegte er. „Mir ist außerdem aufgefallen, dass das Werk praktisch ohne Gefühle auskommt, und ich vermute, dass die Klammertechnik damit zusammenhängt. Ich weiß aber noch nicht, wie.“
„Wollen wir das wirklich wissen?“ fragte Elke. „Ich meine, treibt ihr die Spekulation nicht jetzt doch ein wenig zu weit?“
Auf diese Bemerkung ging zunächst niemand ein. Marcel hatte das Buch zugeschlagen und auf den Tisch gelegt. „Vielleicht sind das wirklich nur Nebensächlichkeiten, die mit dem Anliegen des Autors nichts zu tun haben“, vermutete er.
„Und das führt mich zu der Frage, was denn genau das Anliegen des Autors ist“, fuhr er fort. „Meiner Meinung nach sieht er es so, dass er Laing als Caillié Werkzeuge eines Verhängnisses sind, ohne dass er ihnen persönlich etwas vorwerfen kann. Das Geschehen, in das sie verwickelt sind, ist verhängnisvoll. Der Entdeckung des `einzigen Ortes´ folgt die Umwandlung des Mythos in einen heruntergekommenen kolonialen Besitzstand. Denn bald nach den Entdeckern kamen die Soldaten und übernahmen die Herrschaft in Westafrika. “
Frank stimmte Marcel Resümee´ zu. Ein so gehaltvolles, pralles Werk habe er lange nicht gelesen, wobei ihn aber das Gefühl beunruhige, ihm nicht ganz gerecht geworden zu sein. Er habe das Gefühl, dass das Werk noch viel mehr enthalte, als sie entdeckt hätten. Vielleicht sei es ein Buch für Wilfried, den Mehrfachleser, der bei der zweiten und dritten Lektüre noch mehr entdecken würde.
Elke hob abwehrend die Hand. „Ich habe es noch nicht einmal geschafft, dieses Buch einmal zu lesen, und der Gedanke es dreimal lesen zu müssen, jagt mir einen Schauder den Rücken herunter“, verkündete sie. „Tut mir leid, ich konnte mit diesem Buch nichts anfangen. Die ganze Thematik sprach mich nicht an, die Textmassen erschlugen mich, und ich merkte, dass die Lektüre für mich eine richtiggehende Anstrengung war. Da habe ich es einfach weggelegt.“ Sie machte eine Pause und blickte in die Runde. „Nun aber, wo ihr dieses Buch derart in den Himmel gehoben habt, bekomme ich ein schlechtes Gewissen.“
„Brauchst du aber nicht“, beschwichtigte Lothar. „Ich finde das Buch auch beeindruckend, aber so hoch wie Marcel und Frank würde ich es ebenfalls nicht hängen. Wie die Klammereinschübe zeigen, hat es etwas Gekünsteltes. Außerdem stört mich die antikoloniale Soße, die der Autor am Ende über sein Buch gießt.“
„Womit er natürlich recht hat“, warf Marcel ein.
„Womit er überhaupt nicht Recht hat“, widersprach Lothar.
„Womit er auf jeden Fall insofern recht hat, als er eine Diskussion in Gang setzt“, schloss Frank. ein. „Und das gehört doch wohl auch zu den Vorzügen guter Bücher, oder?“
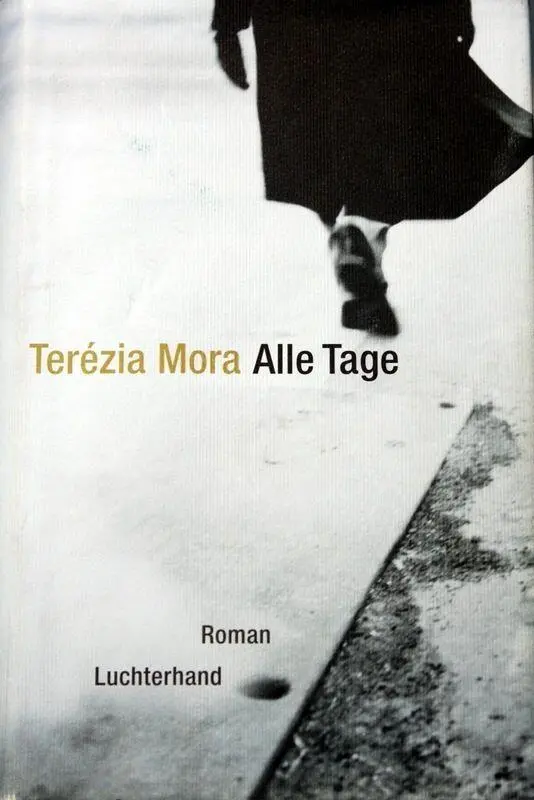
V
Terézia Mora:
Alle Tage
Bei der nächsten Sitzung war Marcel in angeschlagener Stimmung. Er hatte kleine Teller mit Cevapchichi-Kugeln, Soße und Brot vorbereitet, dazu gab es einen herben Amselfelder, Wasser und Säfte. Sein Deutsch-Leistungskurs hatte ihn bitter enttäuscht, und er hatte erkannt, dass er sich den Rest seines beruflichen Lebens mit einer Mehrheit von Schülern würde herumschlagen müssen, die kaum jemals freiwillig Texte lasen, die länger waren als eine durchschnittliche SMS. Dass Frank ihm erzählte, auf dem Gymnasium wäre es auch nicht viel besser, hatte ihn nicht wirklich trösten können. Zum ersten Mal kamen ihm Zweifel an seinem Lehrerberuf.
Elke bemerkte es, und es tat ihr leid. Zugleich wunderte sie sich über die Vielfalt der Stimmungen, die jeder von ihnen mit in den Lesekreis brachte. Aber sie konnte auch feststellen, wie zuverlässig Bücher diese Stimmungen zurückdrängten. Denn kaum hatte Marcel den Tisch abgeräumt und sich dem Buch „Alle Tage“ von Terézia Mora zugewandt, hellte sich sein Gesicht auf. Er blätterte hin und her, schüttelte und nickte abwechselnd mit dem Kopf und vertiefte sich in seine schriftlichen Vorbereitungen.
Diesmal versuchten sie sich die Handlung des Buches vor der Diskussion systematischer zu erschließen. Jeder hörte dem anderen so genau zu, wie er konnte, um hier und da Ergänzungen einzubringen. So ergab sich am Ende ein relativ einvernehmlicher Abriss der Handlung.
Im Mittelpunkt des Buches „Alle Tage“ stand Abel Nema, ein junger Mann aus einem nicht näher bezeichneten Land, in dem man unschwer das alte Jugoslawien erkennen konnte. Abel Nema besaß eine ausgeprägte Sprachbegabung, die es ihm erlaubte, zehn Sprachen zu lernen, allerdings war er unfähig sich zu betrinken, zu träumen und zu schmecken. Abels Vater verschwand, als Nema noch zur Schule ging und tauchte nie wieder auf. Mit seinem Jugendfreund Ilja verband ihn eine enge, im Kern homoerotische Beziehung, die aber nicht erwidert wurde. Von Ilja zurückgestoßen, verließ Nema seine Heimatstadt und wurde zum großen Schweiger, der eine Sprache nach der anderen lernte, aber selber immer weniger sprach. Weder Liebe noch Güte, weder Gemeinheit noch Niedertracht schienen an ihm hängenzubleiben, obwohl seine bloße Erscheinung auf die Figuren seiner Umgebung wie ein Katalysator wirkte. Dieser zentrale Charakter wird ergänzt durch eine ganze Galerie schräger Gestalten, die in dem Buch nacheinander ihren Auftritt haben: Konstantin Toti, der Vielredner, Anarchia Kingania, die Frau, die mit jedem schläft und nur Abel bemuttert, die Musiker Janda, Kontra und Andre, mit denen Abel auf eine unmögliche Musiktournee geht, das garstige Zigeunerkind Danko, das seinen Wohltäter ausraubt und viele andere mehr.
Erst in der Mitte des Buches lernt Abel Mercedes kennen, mit der er eine Scheinehe eingeht und von der er sich (Achtung: Zeitebene!) gleich am Anfang des Werkes scheiden lässt, eine Frau, die Abel nur deswegen unglücklich liebt, weil sie ihn an seinen Jugendfreund Ilja erinnert. Beiläufig wird erwähnt, dass Ilja in der Ferne einen schrecklichen Tod erleidet, woraufhin Abel durchdreht und in einer Nervenheilanstalt eingeliefert wird. Dort erscheinen ihm im Zustand des Delirierens alle Gestalten seiner Kindheit und Jugend, einschließlich seines entschwundenen Vaters. Aus dem Delirium aufgewacht und aus der Klinik entlassen, wird Abel von einer Zigeunerbande überfallen, halbtot geschlagen und mit dem Kopf nach unten an einer Stange aufgehangen. Diese Misshandlungen, die er nur mit Glück überlebt, „heilen“ Abel – plötzlich hat er alle Sprachen vergessen, träumt wieder, spürt Geschmacksempfindungen und ist in der Lage, sich auf einem geistig reduzierten Niveau mit seiner Umwelt auseinander setzen zu können.
Soweit der Abriss der Geschichte, die Marcel. Frank und Lothar zusammentrugen, während Elke kopfschüttelnd schwieg. Am Ende blickte sie sich mit großen Augen um und fragte: „Soll das eine Romanhandlung sein?“
„Die Handlung ist doch völlig unwichtig“, gab Frank schroff zurück. „Das Buch lebt nur von der Sprache.“
Marcel stimmte zu, lobte die Sprachkraft der Autorin, ihren abgehackten Erzählrhythmus und ihre Stummelsätze, die dazu führten, dass man die Sätze ungewollt im Kopf vollende, womit man zum Mitautor werde.
„Ja, ja“, rief Frank. „Das erinnert mich an Ulysses, wie überhaupt der in Dublin herumlaufende Bloom viel mit Abel Nema gemein hat. Auch Nema läuft durch die Straßen einer nicht näher gekennzeichneten Stadt, vergisst, wo er wohnt, kommt dauernd zu spät und landet verlässlich nur im Puff, der hier im Buch `Klappstühle´ genannt wird.“
Читать дальше