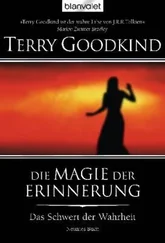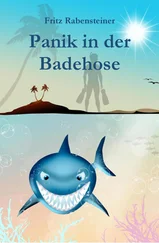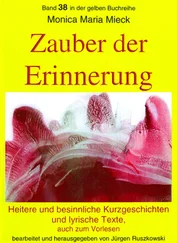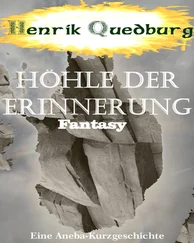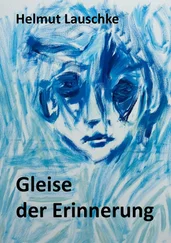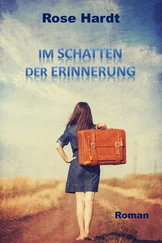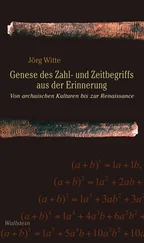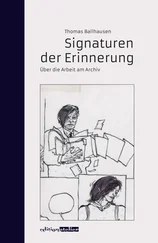Fritz Mierau - Keller der Erinnerung
Здесь есть возможность читать онлайн «Fritz Mierau - Keller der Erinnerung» — ознакомительный отрывок электронной книги совершенно бесплатно, а после прочтения отрывка купить полную версию. В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: unrecognised, на немецком языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:Keller der Erinnerung
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:4 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 80
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Keller der Erinnerung: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Keller der Erinnerung»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
Keller der Erinnerung — читать онлайн ознакомительный отрывок
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Keller der Erinnerung», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
Wir fanden in Jung den schlesischen Romantiker aus dem katholischen Neisse, der Joseph von Eichendorff liebte; wir fanden in ihm den „initiateur“ Fouriers, den ewigen Beginner, der überall bei der Hand ist, wo es einen gefährlichen oder unangenehmen Schritt zu tun gibt, der sich aber zurückzieht, sobald ihm Führerschaft aufgenötigt wird; wir fanden in ihm den „Lastträger“ Nietzsches, der nach langem Warten auf ein entlastendes Entgegenkommen schließlich jedermann erträgt und damit noch mehr trägt als er bisher schon getragen hat; und wir fanden in ihm Rimbauds Unerschrockenheit: „Nehmen wir alles auf, was an Lebenskraft und echter Zärtlichkeit naht.“
Da war bei aller aggressiven Strenge gegen sich selbst ein eher stiller, ein sanfter Jung, der Jung der Exerzitien des Spandauer Gefängnistagebuchs, der Jung des „Erbes“, seiner Auseinandersetzung mit dem Vater, der Jung der „Revolte gegen die Lebensangst“ und seiner „Deutschen Chronik“, die als „Der Weg nach unten“ erschien.
Dieser Jung begleitete uns bis in unsere Träume:
Traum von Franz Jung. Ich war bei ihm zu Gast. Warum weiß ich nicht. Überlegte gerade, daß ich ihm nicht zu lange zur Last fallen dürfte und sagte ihm, ich wolle – wahrscheinlich morgen – abreisen. Vielleicht auch nicht abreisen, sondern einfach nur bis morgen bleiben. Er hörte ruhig zu. Er war im ganzen heiter und gelöst. Sagte dann, Margot komme. Er freute sich darüber. Fügte hinzu, er möchte sich von Margot verführen lassen, lächelte. Ich merkte, er war schon woanders. Fürchtete wohl, aus einem Gespräch mit ihm könnte nichts werden. Daher sagte ich, ich hätte gern mit ihm gesprochen. Mir seien seine Gedanken vertraut aus dem, was er geschrieben hätte, aber ich möchte hören, wie es in seinem Munde klinge. Wo die Akzente liegen, wenn er spricht. Er stimmte zu, das schien ihm ein verständlicher Wunsch zu sein. Ich wollte ihn über die Religion befragen, das sagte ich aber nicht.
Manchem unserer Freunde schien der vertraute Umgang mit Jung zu weit zu gehen. Als wir die Impressionen von unserer ersten Englandreise 1988 – „Hausbauen in London“ – verschickten, in denen wir neben Jungs Häusern die „lindernden Häuser der Lehrer“ nannten: Swedenborg-Hall, Rudolf Steiner Bookshop, Linnean Society, die Tate-Gallery mit William Turner und das Teilhard-Centre, da verhehlte einer unserer Freunde nicht, daß er „davor warnen möchte, dem Franz auf allen Wegen in seinen mystischen Spiritualismus zu folgen …“. Er jedenfalls wolle, schrieb er am 25. Januar 1989 – „zumal in diesem Jubiläumsjahr – doch die ungelösten Ansprüche der Aufklärung nicht vergessen“.
Solchen von früh an gehegten Bedenken, die Jung unterstellten, er verweigere sich im entscheidenden Moment und ziehe sich ins Irrationale zurück, begegneten wir in unserem Entwurf mit einem Begriff, der Jungs Vorarbeit bei der „Auflösung des Totalitären“ genau faßte, mit dem Begriff des „Übersetzens“. Am 15. Dezember 1988 taucht er zum ersten Mal auf:
Das Arsenal der [von Jung] erarbeiteten Umgangsformen = Übersetzungsangebote befreien von dem Verdacht, Flucht, Rückzug, Ausweichen zu sein, und zwar aus Gründen der Bequemlichkeit oder Verantwortungslosigkeit.
Ins Positive gewendet ergibt sich dagegen: Umwege, um Distanz zu schaffen.
Jede Umgangsform hat ihre Akme …: als Korrespondenz, einmalige Begegnung, Blicke, Widmung. Daher Abbruch auf Höhepunkt keine Brüskierung.
Übersetzung in diesem Sinne meinte das gleichberechtigte Nebeneinander vieler Sprachen, meinte Autonomie der Sprachen bei prinzipieller Durchlässigkeit, meinte die Sprache wechseln als Gewähr für Kreativität, meinte den „Polyzentrismus“ aus der Notiz vom Ostersonnabend 1989.
Es stellte sich bald heraus, daß dieses Jung-Bild nur in einem Buch zu zeichnen sein würde. Ursprünglich war an eine Parallel-Biographie Walter Serner – Franz Jung gedacht. Als daher Elisabeth Wolken von der Deutschen Akademie Villa Massimo uns Anfang Mai zum Jahreswechsel 1989/1990 für drei Monate nach Rom einlud, dauerte es nicht lange, bis wir uns festlegten. Am 2. Juli 1989 trugen wir ins „Journal“ ein: „Am 1. Juli 1989 Entschluß, das Jung/Serner-Buch in Rom zu schreiben.“ Das geschah dann auch, geriet allerdings etwas anders als geplant. Immerhin: Das 1998 erschienene Buch „Das Verschwinden von Franz Jung“ ist zehn Jahre zuvor in unserem „Jung-Journal“ entworfen und in Rom begonnen worden.
Eine der letzten Eintragungen in unserem „Journal“ galt dem Bühnenbild zu „Heimweh“. Es schien uns zu massig, zu bunt, zu naturalistisch für dieses tänzerischste Stück Jungs. Reden hatte nichts genutzt. Oder doch? Im August war der Bescheid vom Ministerium für Kultur der DDR gekommen, wir sollten, wörtlich – „in Gottes Namen nach Rom fahren“. Wir starteten am 30. November. Klaus Metzger, der Dramaturg der Schaubühne, brachte uns für die Gespräche über Jung und „Heimweh“ ein Honorar an die Bahn. Es erlaubte uns, im Februar 1990 weiter in den Süden nach Foggia und San Giovanni Rotondo zu fahren, wo Jungs letzte Gefährtin, Anna von Meissner, wohnte. Jung hat von ihr in seinen Novellen „Die Verzauberten“ und „Sylvia“ erzählt. Wir fanden sie leicht. Sie wohnte noch in der Gegend, wo Jung sie vor dreißig Jahren zurückgelassen hatte, als er nach New York ging. Sie erschien uns wie eine Figur aus „Heimweh“.
Spandauer Tagebuch
Franz Jungs Exerzitien
Wenn je ein Tagebuch nicht als Literatur geschrieben wurde, dann das des Deserteurs Franz Jung. Hier wird nicht Offenheit inszeniert oder mit einer Form gespielt, nicht die Justiz angeklagt oder auf Kunst hin kalkuliert.
Dies ist ein Exerzitienbüchlein. Seine Mitte ist ein Satz von Pfingstsonnabend 1915, mit dem Jung weiß, daß „die Haft auch draußen dann noch bevorsteht“: „Und das befreit mich sogar von einer Sorge – ich kann getrost dem Leben draußen noch entgegengehen.“
Jungs Gefängnisse waren immer Verdichtungen dieser Haft: Spandau 1915, Breda 1920, Cuxhaven, Hamburg, Fuhlsbüttel 1921/22, Berlin 1936/37, Budapest 1944, Bolzano 1945. Er hat sie bewußt mit Übungen gefüllt und bestanden.
Das Training in Spandau, Meditation und Gewissenserforschung, war die erste, tiefste und folgenreichste seiner Übungen. Hier geht ihm die „Idee eines Lebenswerks“ auf: „Die Technik des Glücks. In 4 Stufen zu je 12 Kapiteln. Jede Stufe nimmt die ihr vorhergehende auf. Explosion. Steigerung. Atemholend weitersprechen.“
Von den Spandauer Exerzitien her zieht sich Jungs Versuch, die „Gemütswucht“ nicht zerflattern zu lassen: der Kampf mit der Sprachlosigkeit in der Beziehung zu seiner Frau Margot, Beobachtung der Mitgefangenen in vierzig Miniaturen, Lektüre, Pläne, die tägliche Balance zwischen Disziplinierung und Lockerung (Dänischlernen, Sport, Eß-Vorsätze). Das zusammen meint jene „Technik des Glücks“, die dann nicht nur die „Sechste Folge der Vorarbeit“ von 1917 und das gleichnamige Büchlein von 1921 bildet, sondern sein „Lebenswerk“ bis zur Autobiographie „Der Weg nach unten“, deren ersten Teil er unter den in Spandau gefundenen, eigenwillig übersetzten (oder einer eigenwilligen Übersetzung entnommenen) Satz des Thomas von Kempen stellt: „Cur quaeris quietem, cum natus sis ad laborem?“ – „Was suchst du Ruhe, wenn du zur Unruhe geboren bist?“ (Nachfolge Christi II,10).
Wie Jung für dieses Werk die Evangelien, Thomas, Nietzsche, Stirner, Spinoza, die Trivialromane und die Psychoanalyse in einer so systematischen wie lockeren Parallellektüre aufschließend sich gewinnt, für seinen Tag, seine Stunde, seine Not und seinen Jubel neu durchmacht, das ist die Übung dieses Büchleins, die das Ziel einleuchtend werden läßt: „Atemholend weitersprechen.“
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «Keller der Erinnerung»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Keller der Erinnerung» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «Keller der Erinnerung» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.