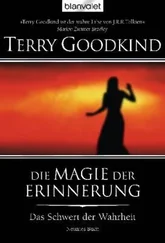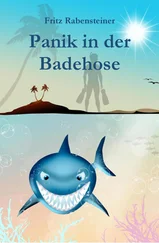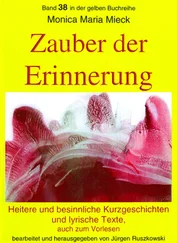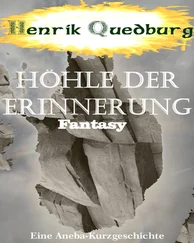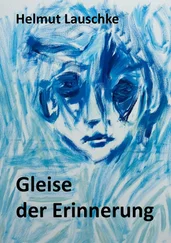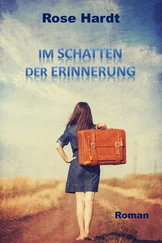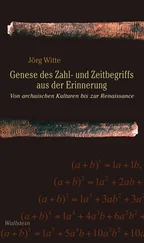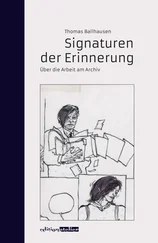Fritz Mierau - Keller der Erinnerung
Здесь есть возможность читать онлайн «Fritz Mierau - Keller der Erinnerung» — ознакомительный отрывок электронной книги совершенно бесплатно, а после прочтения отрывка купить полную версию. В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: unrecognised, на немецком языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:Keller der Erinnerung
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:4 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 80
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Keller der Erinnerung: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Keller der Erinnerung»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
Keller der Erinnerung — читать онлайн ознакомительный отрывок
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Keller der Erinnerung», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
Angesichts dieses Scheiterns beschlossen die Studenten Andrea Czesienski, Peter Finger und Peter Ludewig, die an der Betreuung von Cläre Jung in den siebziger Jahren tätigen Anteil genommen hatten, ihr zum bevorstehenden 89. Geburtstag eine Geburtstagszeitung zu widmen. In Anlehnung an die Neue Jugend, das Avantgardeblatt von 1917, mit dem Berlin-Dada begann und in dem auch ein Beitrag von Cläre Oehring (ungezeichnet) erschienen war, nannten sie die Zeitung Neueste Jugend: wie 1917 Format A2, 4 Seiten, 3-4 Spalten Text, neben Passagen von und über Cläre Jung und zwei Porträtfotos der Jubilarin, Cläre-Jung-Bilder und -Gegenbilder aus der Feder der drei Studenten, Vertretern der aufsässigen „neuesten Jugend“. Im Zentrum der Cläre-Jung-Texte ihr Credo aus einem ungedruckten Essay, an dem sie 1943 und 1953 geschrieben hatte: „Alle meine Arbeiten sind verschiedene Versuche über das gleiche Thema: die Eroberung des Menschen durch sich selbst, die Bekämpfung der Flucht in die Paradiesessehnsucht.“ Wie viele andere Dokumente des Archivs ist die Geburtstagszeitung den infamen „Ordnungsarbeiten“ des Inoffiziellen Mitarbeiters „Komin“ (Dr. Erwin Gülzow) zum Opfer gefallen.
Vermutlich war es gerade die Neueste Jugend, die in ihrer offenen Huldigung für die Kameradin und mit ihrer Komposition aus Biographie, Texten, Briefen, Fotos und den Cläre-Jung-Bildern und Gegenbildern ihrer Bekannten den ersten Anstoß zu Konzept und Struktur unserer künftigen Chronik gegeben hat.
Alle weiteren Unternehmungen der achtziger Jahre erbrachten dann, auch wenn manche wiederum scheiterten, immer neue Gewißheit über die lebendige Gegenwart der Kameradin Cläre Jung. Noch 1981 wird unser Vorschlag erwogen, unter dem Titel „Der Andere“ ein Buch mit Texten, Briefen und Bildern von Cläre Jung, Franz Jung, Otto Gross, Oskar Maria Graf, Max Herrmann-Neiße und Georg Schrimpf herauszubringen, das die Gemeinschaftsidee des Kreises um den Berliner Verlag Freie Straße (1915-1918) lebendig werden läßt. Erwogen und – verworfen. Eine vergleichbare kleinere Auswahl erschien 1985 in dem von Wolfgang Storch herausgegebenen Katalog zur Ausstellung „Georg Schrimpf und Maria Uhden“. 1986 interessierte sich die Verlegerin Renate Gerhardt für das von uns vorgeschlagene Buch „Die andere Biographie der Cläre Jung“ mit 250 Abbildungen zu 250 Texten – Auszügen aus Cläre Jungs Autobiographie und Briefen von und an Cläre Jung. Auch dieses Buch kam nicht zustande.
Nach so vielen vergeblichen Versuchen wirkte das Erscheinen der „Paradiesvögel“ 1987 in Hamburg wie eine Erlösung, wenn auch die Beschränkung auf die Zeit von 1911-1945 und der mißverständliche Titel das Bild von Cläre Jung verzeichnet. Die Anmerkungen und Kommentare, die wir beisteuerten, konnten der Verzeichnung nicht wehren. Die zehn Jahre nach 1945, die in der Hamburger Fassung fehlten, waren ja mit Cläre Jungs Wirken in der Sowjetischen Besatzungszone und der frühen DDR die Probe aufs Exempel des Lebensexperiments, und der unter rigoroser Selbstzensur geschriebene Text bezeugte die Fragwürdigkeit des von der Autorin behaupteten Gelingens dieses Experiments.
Dafür bescherte uns die Hamburger Fassung etwas Hochwillkommenes, nämlich Helga Karrenbrocks Essay „Über Cläre Jung“ mit einem Vorschlag zur Typologie des „Vorläufer“-Stils, der uns sogleich zu lebhaftem Widerspruch reizte und der schließlich unsere Chronik prägte:
Und ich bin mir immer noch nicht darüber klar geworden, wer oder was mir da gegenübertrat: ein archaisches mütterliches Prinzip oder ein Vorschein kommender Möglichkeiten. – So hat sie, unmerklich, sich selbst in die Waagschale geworfen, um unser abstraktes Politik-verständnis zu konkretisieren und das abstrakte Menschenverständnis in Frage zu stellen: als Experiment, als Vorarbeit.
Das schien uns der trotzig beschworenen Alltagslosigkeit, dem „ewig ohne Heute“ zu schnell gefolgt. Relikt oder Vorgriff – so lebte man nicht. Das war nicht Cläre Jungs Dasein. Und so legten wir Wert darauf zu zeigen, daß Cläre Jung als Kameradin im Grunde gegen ihre „Vorläufer“-Verse gelebt hatte. Was Franz Jung einmal als Hilfe- und Sorge-Syndrom bei ihr diagnostiziert hatte, war ihre besondere Weise, sich mit dem anderen zu verbinden, um ihn zu sich selbst zu bringen. Da hatte sie ihre Vorlieben und Abneigungen. Eine sanfte Stimme, ein schönes Gesicht konnten ihr erwünscht, ein Name konnte ihr, nur seines Klanges wegen, zuwider sein. Richard Oehring, ihren ersten Mann, empfand sie als zu schwach, seinen Selbstmord als Kränkung. Die Gleichgültigkeit Peter Jungs, des Sohns Franz Jungs aus dritter Ehe, angesichts des Todes seines Vaters traf sie so sehr, daß sie das Medaillon mit seinem Kinderbild, das sie stets getragen hatte, von Stund an nicht mehr trug. Helga Karrenbrock war es, die da das Äußerste an Bekenntnis aus Cläre Jungs Mund vernahm; sie schrieb uns während unserer Arbeit an der Chronik: Einmal
ergab es sich, daß ich so im Eifer der Überzeugung, daß die Menschheit durch Revolution mächtig zu beglücken sei, vor mich hinräsonniere: „Eigentlich mag ich die Menschen gerne. Und Du?“ (Kindergeplapper). Worauf sie nachdenklich, aber sehr bestimmt antwortete: „Nein“. Ich erinnere mich genau, daß das ein richtiger Schock für mich gewesen ist.
Schock, Entsetzen, Befremden, Unverständnis, Verwunderung oder Entzücken – jeder verband seinen Eindruck von Cläre Jung mit dem, was er gerade für sie tat, verband ihre Existenz mit seinem Schicksal. Da huldigte, diente, dankte oder widersprach er nicht einem „Prinzip“ von ehedem oder „Vorschein“ von Künftigem, sondern einer Person von heute. Auf diese Anwesenheit, die reale Präsenz kam es uns an und so beschlossen wir unseren chronikalischen Bericht mit einer Auswahl aus Zuschriften und Texten von Bekannten, die sich der unmittelbaren Begegnung mit ihr gestellt hatten.
„Es war die ungebrochene Kraft ihrer Augen, die mich faszinierte“, schrieb Eckhard Siepmann, der in seinem John-Heartfield-Katalog zu Cläre Jungs Beitrag über ihren Freund „Johnny“ zwei Bilder ihrer Augen stellte: das von Georg Schrimpf im Porträt „Cläre O.“ von 1916 und das auf einem Foto von 1975.
„Unvergeßlich ihre Augen, forschende Tiefe mit dem Widerschein der Sehnsucht“, sagte Roland März in seinem Essay über Georg Schrimpfs „Kameraden“ und bekannte kurz darauf ausdrücklich: „Sie haben ja gemerkt, daß der Text, über Schrimpf hinaus, eigentlich eine späte Danksagung an Cläre Jung sein sollte.“
Mit gleicher Intensität ist ihrer großen Leidenschaft, der Kettenraucherei, gedacht worden und zwar nicht nur in der Erinnerung an beifällige Förderung – durch großzügige Zigarillo-Sendungen – oder ironisch-verklärend „ein Aroma von Café Littéraire“, sondern ehrlich entsetzt – „sie hatte wie jeder auch unangenehme Seiten“.
Was diese so blickende und so rauchende Person bewirkte, machte sie zu der Kameradin, deren Unbeirrbarkeit sich keiner entziehen konnte. Im November 1978 schaffte sie es, zu Franz Jungs 90. Geburtstag einen Leseabend im Berliner „Club der Kulturschaffenden“ mit Maria Hertwig, Wieland Herzfelde und Titus Tautz zu arrangieren. Die Schauspielerin Ingeborg Medschinski, die aus Jungs „Weg nach unten“ las, hat sie dabei erlebt: „Sie war voller Freude, daß es gelungen war, zum Geburtstag von IHREM Franz so einen Abend zusammenzubringen.“ Vierzehn Jahre zuvor hatte Cläre Jung an gleicher Stelle einen Erich-Mühsam-Abend vorbereitet: „Unvergeßlich diese Stunde“, schrieb uns Else Levi-Mühsam 1991, „mit etwa 70 Freunden und anderen, alten und jungen, die diese Stunde als Bekenntnis ansahen zu Erich und wohl – was damals nicht ausgesprochen werden ‚durfte’ – zur Freiheit des schöpferischen Geistes.“
Cläre Jungs berlinischer Lakonismus hat ihr bei der täglichen Bewältigung ihrer DDR-Existenz glänzend geholfen. Als 1976 Dr. Kurt Hager, der ZK-Sekretär für Wissenschaft, Volksbildung und Kultur (der 1980 das Erscheinen ihrer Erinnerungen verbot) die Diskussion über den französischen Eurokommunismus mit dem Argument abtat, wir in der DDR hätten unseren Kommunismus in Kürze ohnehin sicher, resümierte Cläre Jung trotz ihrer Abneigung gegen alle Negativgespräche das Ereignis respektlos mit dem Satz, Hager „habe viel zu lange ‚gequatscht’“. Diese sarkastische Schärfe stand ihr für ihre tiefe Abneigung gegen die Bürokratisierung der Revolution durch Aufblähung der Apparate, Titelverleihung, Ordensorgien und Sprachzirkus stets zur Verfügung. Walter Fähnders erinnerte in seiner Analyse von Cläre Jungs Revolutionserzählung „Stanislaw Tscherwinsky“ (1932), in deren Zentrum die lebensgefährlichen Auswüchse dieser Bürokratisierung stehen, an den Anflug von „gepflegtem Anti-Autoritarismus“, den die Erwähnung des Dutzends Orden, Medaillen und Ehrenzeichen aus 20 Jahren der Rede der Berlinerin gab: „Wenn ich die alle anlege, seh ich ja aus wie Hermann Göring.“
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «Keller der Erinnerung»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Keller der Erinnerung» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «Keller der Erinnerung» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.