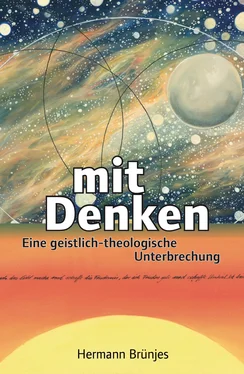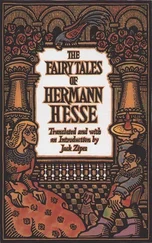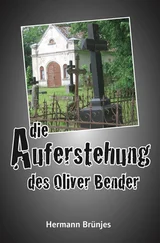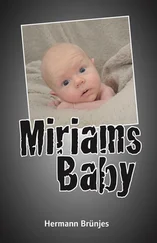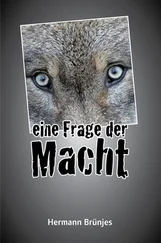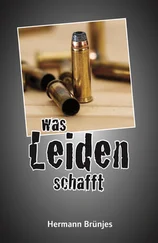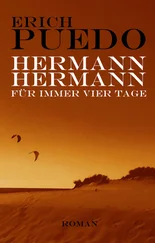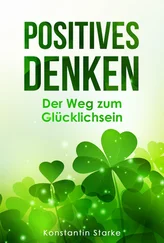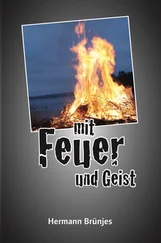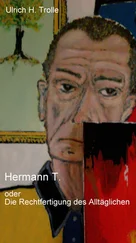Das Neue Testament spricht immer wieder von »metanoia«, Umkehr. Im Leben der Menschen ereignet sich in der Begegnung mit dem Evangelium und den Christen so etwas wie bei den Jüngern und Jüngerinnen zu Ostern. Zuerst sind da nur Zweifel, Fragen und Unglaube. Dann aber begegnet Gott seinen Menschen. Vertrauen und Glaube ereignen sich. Sie werden nicht aus religiösen Seelen oder Gefühlen, sondern allein aus Gottes Gegenwart geboren. »Maria!« Erst als der Auferstandene sie anredet, erkennt Maria Jesus und dessen unmittelbare Nähe (Joh. 20,16). Vor dieser Anrede sieht sie nur den Gärtner. »Offenbarung« nennen Theologen diesen Vorgang. Gott selbst zeigt sich. Die Bibel spricht vom »Heiligen Geist« – und damit ist nichts anderes gemeint als Immanuel. Gott ist nahe!
Warum also kann ich sagen: »Gott steht mir nahe!?«
Weil Gott selbst sich als nah erwiesen hat. Nicht weil ich ihm so nahe gekommen bin – sondern weil er zu mir gekommen ist. Und das immer und immer wieder. Gott sucht die Nähe zu mir sogar dann noch, wenn ich ihm zu entwischen drohe, wenn ich weglaufe, mich verstecke, nicht auf ihn höre, ihn verleugne ... Gott hört nicht auf, mir nahe zu sein.
Eigentlich geht es im Glauben erst zweitrangig um meine persönliche Beziehung zu Gott. Es geht vor allem um seine persönliche Beziehung zu mir. Ich stehe ihm nahe. Ich habe einen Platz in seinem Herzen. Er will ohne mich nicht sein, er hält es ohne mich nicht aus.
Immanuel – Gott ist nahe
Das ist zuerst eine Aussage über das Wesen Gottes und seine Haltung zu uns Menschen. Gott sucht die persönliche Nähe zu uns. Er begegnet uns in Jesus Christus nicht als Energiefeld, als Glaubensbekenntnis oder Wertekatalog, sondern als lebendige Person. Er hat Sehnsucht nach uns, sucht meine und unsere Nähe, will mit uns reden, uns spüren, uns sehen und »mit uns gehen«. Deshalb reden wir ja von der »Liebe Gottes«. Sie ist kein Prinzip und auch keine moralische Instanz menschlicher Ethik – sie ist Leidenschaft für uns und Ausdruck der Sehnsucht Gottes zu seinen Menschen.
Ich habe verstanden. Ich kann nicht davon ausgehen, dass sich die Menschen um mich herum Gott nahe fühlen. Wenn nicht jemand so etwas wie eine eigene Ostererfahrung gemacht hat, kann er oder sie das gar nicht.
Aber ich kann davon ausgehen, dass Gott selbst die Nähe zu jedem und jeder sucht. Er sehnt sich nach seinen Menschen und danach, dass sie seine Nähe wahrnehmen, daraus leben und sie erwidern.
✪ Was ist Ihnen besonders wichtig? Ein Austausch mit anderen bereichert – und da zeichnen Sie meinen Einstieg gerne mit ein.
Ich bin Menschen begegnet, die meinten: »Ich brauche keinen Gott!« Oder sie sagten: »Wozu braucht man Gott? Es geht doch auch ohne!« Manchmal waren solche Aussagen vermutlich vorgeschoben, um sich ein Gespräch oder das Nachdenken über Gott vom Hals zu halten. Manchmal waren sie aber auch sehr ehrlich gemeint. »Wozu brauche ich Gott?«
✪ Bevor Sie weiterlesen, lohnt sich eigenes Nachdenken. Was antworten Sie? Ein Austausch mit anderen kann Sie auch hier inspirieren.
In den meisten Gesprächen habe ich versucht, im Sinne der nächsten Kapitel auf diese Frage mit Argumenten zu antworten – allerdings mit mehr oder weniger »Erfolg«.
Nach dem Nutzen fragen
Meiner Meinung nach ist die Frage nicht nur erlaubt, sondern sogar geboten: Was habe ich von Gott und vom christlichen Glauben? Und was habe ich davon, wenn ich über all das nachdenke?
»Was habe ich davon?« So zu fragen werden wir von klein auf trainiert: Wenn ich etwas kaufe, wenn ich mich einem Verein anschließe, wenn ich eine Veranstaltung besuche, wenn ich wählen gehe, wenn ich einen Beruf ergreife oder auch nur einen Job annehme ... immer wieder muss und werde ich fragen: »Was habe ich davon?«
Warum also sollte das bei Gott anders sein? Die Frage nach dem, was etwas bringt, ist also unbedingt ernst zu nehmen.
Eine berechtigte Frage
Mich wundert nicht, dass die Leute sich von der Kirche und uns Christen abwenden, wenn uns diese Frage in Blick auf Gott und den Glauben sprachlos macht, wir sie nicht zulassen und keine Antworten geben. Ich bin überzeugt: Die Leute wollen, dass die Kirche nicht nur christliche Werte vermittelt, politisch mitmischt oder anspruchsvolle Kultur und Bildung bietet – vor allem anderen erwarten sie zu Recht, dass die Kirche ihnen Antwort auf die Frage gibt, was der Glaube bringt, was Gott zu bieten hat und warum man unbedingt Christ werden sollte. Auch unsere Gottesdienste gehen oft auf diese grundsätzliche Frage nicht ein. Sie werden so zu Insiderveranstaltungen für jene, die alle Antworten bereits zu kennen meinen und deshalb schon lange keine Fragen mehr stellen.
Die Antworten von »früher« (Anmerkung: Wann war das eigentlich? Zu Zeiten Jesu? Während der Reformationszeit? Nach dem Krieg? Als die Volkskirche noch Kirche des Volkes war?) reichen heute selten aus, um neugierig auf den Glauben zu machen und Menschen im positiven Sinn zu locken, sich Gott zu öffnen. Schon wenige Beispiele belegen, wie unsere »klassischen« Antworten auf die Frage, was der Glaube bringt, heute nicht mehr greifen:
»Jesus vergibt Sünden.« Auch wenn Schuld und Sünde durchaus ein Thema bleiben, es treibt nur wenige um. Was richtig und falsch ist, wird rein subjektiv entschieden. Jeder muss das selbst entscheiden – und man kann ja nichts dafür, wenn man »etwas falsch macht« (Interessant: Schuld und Fehler machen wird oft gleich gesetzt. Sollte Jesus zu der Ehebrecherin gesagt haben: »Geh und mache keine Fehler mehr!«?) Und »Schuld«, wer definiert das schon in einer Zeit und Gesellschaft, wo das Subjekt, also der Einzelne, in den Mittelpunkt gestellt wird und »jeder nach seiner Facon selig wird«?
Hatte Martin Luther noch die existenzielle Frage »Wie kriege ich einen gnädigen Gott?« So fragen wir vielleicht »Wie kriege ich einen gnädigen Lehrer, Chef oder Nachbarn?«. Aber Gott als »Richter«, als »letzte Instanz«, das ist bei vielen absolut nicht im Blick. Folglich ist auch das Angebot »Jesus vergibt Sünden« für viele nicht attraktiv.
Erst die intensive Auseinandersetzung, was mit »Sünde« eigentlich gemeint ist, kann zur Klärung beitragen, die einfache Auskunft, dass Gott Sünden vergibt, wird nicht als Gewinn abgebucht.
Ähnlich geht es mit dem »in den Himmel kommen« (und eben nicht in die Hölle), für Menschen in Luthers Zeiten noch äußerst attraktiver Ertrag des Glaubens. Heute sind wir ganz und gar auf unser Diesseits fixiert und definieren Ertrag aus dem, was wir hier und heute davon haben. Wenn uns da jemand vom Himmel erzählt und davon, dass nach dem Tod noch etwas auf uns zukommt, dann »vertröstet« er entweder aufs Jenseits, oder er macht uns Angst vor Sterben und Tod.
»Du wirst geliebt!« »Du wirst Teil einer großen Gemeinschaft!« »Du bekommst einen Sinn im Leben!« Wenn diese Antworten nicht näher erläutert werden, laden sie nicht unbedingt zum Glauben ein. Liebe kann man nicht behaupten, sie muss erlebt werden – und wenn immer mehr Menschen familien-, eltern- oder partnerlos leben, wird Liebe immer mehr zum leeren Begriff. Und wenn die Kirche sich als Gemeinschaft der Glaubenden versteht, dann muss man ihr das auch abspüren. Nur die Begrüßung als »liebe Gemeinde« und das vereinnahmende »Wir sind hier zusammen, um ....«, reichen da nicht aus. Und »Sinn« ist für viele eben das, was etwas bringt. Also bleibe ich mit Gott als Sinnangebot, ohne zu sagen, was er inhaltlich bringt, die Antwort schuldig.
Fazit: Die »alten« Antworten auf die Frage nach dem, was man von Gott und dem Glauben hat, bleiben oft genug leere Hülsen und schrecken eher ab, als dass sie Menschen, die in Distanz zu Gott leben, anlocken.
Читать дальше