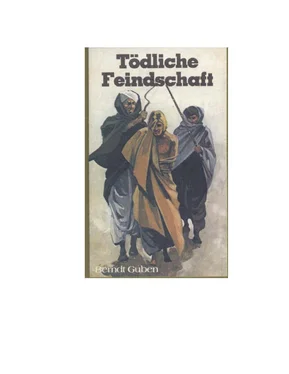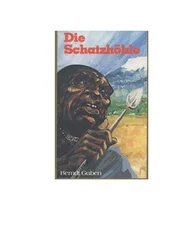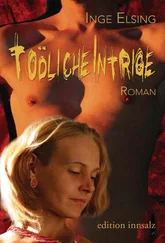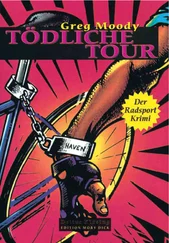»Mitternacht«, murmelte Michel, »es wird Zeit.«
Er erhob sich, dehnte und streckte sich wie eine Katze und fühlte sich voll von Tatendrang.
Der nächtliche Himmel war verhangen. Nur hier und dort blickte ein Stern durch die dichte Wolkendecke. Von dem Silberstreifen der abnehmenden Mondsichel war nichts zu sehen.
»Bueno«, murmelte Michel vor sich hin und stellte den Schemel unter das Fensterchen. Mitten in dieser Beschäftigung hielt er inne.
Er war reichlich verblüfft. Er stellte fest, daß er in spanischer Sprache dachte, soweit sich das Denken um jene Tätigkeit drehte, die er vollführen mußte, um in die Freiheit zu gelangen.
Jemand, der die Gedankentiefe des Pfeifers nicht besaß, wäre über eine solche Feststellung sicherlich mit einem Achselzucken hinweggegangen. Ihn aber stimmte sie nachdenklich. Man sollte, dachte er, der Muttersprache nicht einfach »Adieu« sagen. Sie war doch wesentlicher Bestandteil des eigenen Ich. Sicher, Deutschland als politischer Begriff war nichts. Aber Deutschland, von der Sprache, vom Geist, von der Kunst her gesehen, war viel.
Gestern, in einer Mußestunde, hatte ihm Jehu ein Pamphlet gebracht, das kürzlich erschienen war. Michels Interesse war wach geworden, als er in großen, einfachen Buchstaben, quer über den Umschlag gedruckt, die Worte »In Tyrannos«1 las. Das Büchlein enthielt nichts als ein
«Drama. Es hieß »Die Räuber« und war von einem gewissen Herrn Schiller geschrieben. Jehu erklärte, daß es bei seinem Erscheinen viel Staub aufgewirbelt habe. Und nach seiner Lektüre verstand Michel, weshalb. l »Gegen die Tyrannen« oder frei: »Tod den Tyrannen!
»In Tyrannos« war zwar lateinisch; aber die Sprache des Stückes war deutsch. Ein sehr beachtliches Stück, ein ungewöhnlich starkes Schauspiel.
»In Tyrannos«, dachte Michel und stieg auf den Hocker. Hart griffen seine Fäuste zu. Ein Ruck, und das Fensterchen war frei. Er legte das Gitter vorsichtig auf die Pritsche.
Dann griff er in die Tasche und holte eines der kleinen Lederbeutelchen hervor, die Ojo angefertigt hatte. Bevor er hinauskletterte, überzeugte er sich davon, daß die Lunte festsaß.
Den Beutel zwischen den Zähnen, zwängte er sich durch die Öffnung. Ein Satz, und er stand auf der Gasse.
Die Dunkelheit kam ihm zustatten. Jedes Geräusch vermeidend, schlich er zum Wachlokal. Hier spähte er durch das Fenster.
Der bärbeißige Sergeant saß an einem Tisch, hatte die Arme auf der Holzplatte verschränkt und den Kopf darauf gelegt. Neben ihm brannte flackernd eine Kerze. Über ihm, an der Wand, hing ein Schlüsselbrett. Michel zählte zwölf Haken, an denen je ein Schlüssel hing. Aber so sehr er sich auch anstrengte, er konnte weder Nummern über den Haken, noch Schildchen an den Schlüsseln erkennen, auf denen eine Nummer verzeichnet war.
Er hatte in Zelle acht gesessen. Von Eberstein war ihm bekannt, daß Richard sich in neun befand. Wenn er nun die Schlüsselhaken einfach von links nach rechts zählte und den neunten nahm, würde es dann der richtige sein?
Es war schwer zu sagen, nach welchem System die Schlüssel dort an der Wand hingen.
In den Schatten eines Mauervorsprungs gepreßt, überlegte er. Welchen Weg zur Befreiung Richards sollte er wählen?
Plötzlich fiel ihm siedendheiß ein, daß Richard, der gar nicht auf eine solche Befreiung vorbereitet war, vielleicht eine zu lange Schrecksekunde haben könnte. Für ihn galt es ja nicht nur, den Schritt aus dem Gefängnis zu wagen.
Wenn Richard floh, so war das Desertion. Und das wollte überlegt sein. Freilich, in Hamburg wartete Dieuxdonnés Schiff. Für Michel gab es keinen Zweifel, daß es ihm gelingen würde, unangefochten bis in die Hansestadt zu gelangen. Aber wollte denn Richard überhaupt den Weg in ein neues Leben antreten?
Den Pfeifer, der bisher so viele Situationen gemeistert hatte, verließ auf einmal der Mut. Das eigene Leben in die Hand zu nehmen, war eine Kleinigkeit. Aber bei einem anderen, fast Fremden, den man vor ein paar Tagen zum erstenmal nach langen Jahren wiedergesehen hatte, und mit dem einem eigentlich nichts verband als das Wissen um die Verwandtschaft, lag die Sache anders.
Michel schlich sich an der Mauer entlang, bis er das Fenster seiner Nachbarzelle erreicht hatte.
Er suchte nach einem Stein, fand ihn, reckte sich an der Mauer hoch und schlug die Scheibe ein.
Dann hielt er den Atem an. Angestrengt lauschte er.
»He«, rief drinnen jemand, »was ist da los?«
Michel erkannte die Stimme Richards.
Er faßte in die Gitter und zog sich daran hoch.
»Richard, hörst du mich?«
»Oh, Ihr seid es?«»Ja. — Ich war neben dir eingesperrt und habe mich befreit. Soll ich dich herausholen?«
Der junge Premierleutnant schwieg. Er mochte mit einem Entschluß ringen. Das war, so plötzlich vor die Stimme wieder :
»Und was soll dann werden? — Glaubst du — — glaubt Ihr, daß ich fliehen soll?«
»Ich weiß es auch nicht«, flüsterte Michel. »Dein Leben würde sich entscheidend ändern. Aber du mußt selbst entscheiden.«
»Ja, wenn ich hierbleibe, bekomme ich Festung.«
»Wirklich?«
»Ja, Eberstein wird darauf bestehen.«
»Und Rechtsmittel gibt es nicht, die du gegen ein solches Urteil einlegen könntest?«
»Kaum«, kam es zögernd. »Ja, wenn du — wenn Ihr nicht selbst belastet wäret, so würde ich Euch bitten, den Regimentskommandeur aufzusuchen und ihm alles vorzutragen. Vielleicht würde er auf einen erfahrenen Mann, wie Ihr einer seid, hören.«
»Sag du«, zischte Michel. »Wie heißt der Regimentskommandeur?«
»Graf Köcknitz, er ist Oberst.«
»Wo kann ich ihn erreichen?«
Die Antwort von drinnen kam; aber Michel verstand sie nicht mehr. Während des ganzen Gesprächs hing er im Klimmzug an dem Gitter. Die Anstrengung verursachte Ohrensausen. Und so hatte er die Schritte, die von rechts nahten, überhört.
»He, Er da, was tut Er da?« drang eine schneidende Stimme an sein Ohr.
Der Pfeifer ließ sich fallen. Einige Schritte von ihm entfernt stand ein älterer Offizier.
Wenn er jetzt die Wache alarmiert, dachte Michel, dann war alles umsonst. Mit einem panthergleichen Satz stürzte
Dieser war viel zu erschrocken, um sich zur Wehr zu setzen. Michel zischte:
»Muckt Euch nicht, mein Herr. Wenn Ihr mich verratet, ist es aus mit Euch.«
Er lockerte den Griff ein wenig. Der Offizier blieb still, versuchte jedoch, die klammernden Hände unwillig von sich zu schütteln.
»Was wagt Er?«
»Nichts als meine Freiheit. Ich bin soeben aus diesem albernen Gefängnis ausgebrochen und habe keine Lust, mich wieder einsperren zu lassen. Hoffentlich versteht Ihr diesen Standpunkt.
Begleitet mich ein Stück, damit ich weiß, daß Ihr mir nicht inzwischen die Wache auf den Hals hetzt. Scheinen ohnehin keine guten Wächter zu sein. Sie schlafen wie die Murmeltiere. Sonst hätten sie den Krach längst hören müssen.«
»Er ist ein unverschämter Kerl, Er begibt sich sofort wieder in Arrest!«
»Redet leiser, Mann«, fuhr ihn Michel ungeduldig an. »Kommt jetzt. Wenn wir weit genug entfernt sind, könnt Ihr Euern Weg unbehelligt fortsetzen.«
»Mann, Er hat einen Oberst Seiner Hoheit vor sich.«
»Oberst oder nicht. — Los, kommt!«
Michel hakte den sich sträubenden Offizier einfach unter und zog ihn mit sich. Nach einer Weile gab dieser seine Widerspenstigkeit auf und ging neben dem Pfeifer her durch die dunklen Straßen.Als sie sich so weit entfernt hatten, daß keine Gefahr mehr bestand, meinte Michel:
»Nett von Euch, daß Ihr für einen Flüchtenden Verständnis hattet. Jetzt könnt Ihr gehen.«
Aber nun schien der Oberst nicht zu wollen.
»Wer seid Ihr?« fragte er höflicher.
»Meinen Namen werdet Ihr morgen sowieso erfahren; denn es wird sich ja herumsprechen, daß ich ausgebrochen bin. Aber verlaßt Euch darauf, Eure Landsknechte kriegen mich nicht. Ich heiße Michel Baum.«
Читать дальше