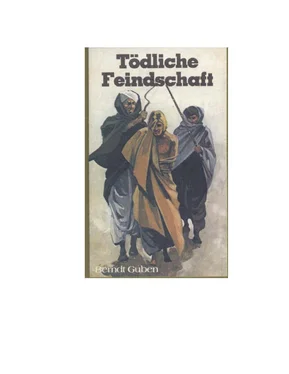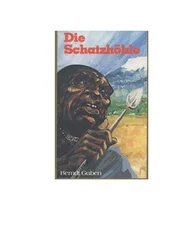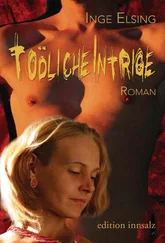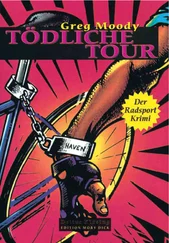Richard Baum war nicht schlecht. Nur leichtsinnig. Vor sich selbst entschuldigte er seinen Leichtsinn mit dem Gefühl echter Freundschaft, das er für Rudolf von Eberstein empfunden hatte.
Er erhob sich und ging unruhig in der Zelle auf und ab.
Wenn ihm je ein Mensch gesagt hätte, daß Rudolf von Eberstein so schlecht sei, er hätte es nicht geglaubt und hätte seinen Freund verteidigt. Und doch hatte dieser Kerl ein ganzes Haus von Lügen um sich herum aufgebaut. Er schien sich nicht im geringsten Skrupel darüber zu machen, daß er dem Onkel Andreas die Geschichte vom Tod seines Sohnes aufgebunden hatte. Es gehörte schon ein sehr hartes Herz dazu, einem alten Mann, der erklärlicherweise an dem einzigen Sohn hing, derartiges anzutun.
Richard Baum hielt es für ein so giftiges Bubenstück, daß er es kaum begreifen konnte.
Onkel Andreas war immer gut zu ihm gewesen. Er hatte gesorgt für ihn wie für den eigenen Sohn. Alles, was Richard war, verdankte er dem Oheim. Und nun hatte sein bester Freund, eben diesem Oheim, einen solchen Schmerz zugefügt.
Es war unfaßlich. Unfaßlich war schließlich auch, daß er, Richard Baum, hier in der Zelle saß, und einem Gerichtsurteil entgegenwartete, zu dem die Initiative von Rudolf von Eberstein ausgegangen war.
Der Teufel mochte ihn holen.
Richard fand auch Muße, über das nachzudenken, was der Vetter ihm bei der ersten Begegnung über das Offiziersdasein schlechthin und das Heldentum im besonderen gesagt hatte. Langsam verstand er die Ablehnung des anderen.
So sehr, wie Richard auch an dem Beruf hing, so sehr wünschte er jetzt, fern von allem zu sein.
Und was würde nun werden, wenn er die wahrscheinliche Festungshaft verbüßt hatte? Sollte er sich nach Preußen wenden, um dort, in der Armee des Großen Königs, das Offizierspatent zu erwerben?
So, als ob ihn jemand beobachtete, schüttelte er den Kopf.
Das gütige Gesicht des Onkels schien plötzlich in der Zelle zu sein. — Richard schöpfte neue Hoffnung. Onkel Andreas würde ihm weiterhelfen. Der alte Mann hatte einen Blick für die Dinge, wie sie wirklich waren. Sein weltoffener Verstand würde den richtigen Weg sehen, den der Neffe zu gehen hatte.
52
Michel und Ojo gingen einer sonderbaren Beschäftigung nach. Der Pfeifer hatte eine Feile vor sich auf dem Tisch liegen. In der rechten Hand hielt er einen scharfkantigen Diamanten, mit dem er die Rillen auf der Oberfläche der Feile nachzog.
Indessen war Ojo damit beschäftigt, Schwarzpulver in einen Lederbeutel zu schütten und eine Substanz hinzuzufügen, die bei der Verbrennung starken Rauch entwickelte.
Als er den Beutel gefüllt hatte, wog er ihn lachend in der Hand.
»Wird einen schönen Gestank verursachen«, meinte er.
»Ja, wenn es dazu kommen sollte.«
»Oh, Señor Doktor, ich glaube diesem Eberstein kein Wort. Er wird irgendeine Teufelei ausgeheckt haben, um Euch zu hintergehen. Ich würde mir überlegen, ob ich die Verabredung einhielte.«
»Richard muß aus dem Gefängnis heraus. Das bin ich meinem Vater schuldig. Der Junge hat nichts Böses getan.«
»Aber wir haben doch schon so oft andere aus dem Gefängnis befreit, ohne dafür zu bezahlen und ohne einen so gefährlichen Weg zu gehen.«
»Du magst recht haben, Diaz, wir haben es auch noch nie mit deutschen Gefängnissen zu tun gehabt. Die Leute sind hier gewissenhafter als anderswo auf der Welt. Und selbst wenn es wirklich gelingen sollte, dann müßte man darauf vorbereitet sein, schlagartig zu verschwinden und nichts zurückzulassen, woran sie sich rächen könnten. Ich kann aber meinem alten Vater keine Flucht zumuten. Und dann ist schließlich auch noch Charlotte da, die ich auf keinen Fall gefährden möchte.«
»Schon recht, Señor Doktor. Nur, was wird, wenn sie Euch einfach hinterrücks über den Haufen knallen?«
»Das werden sie nicht tun. — Ich weiß nicht, ich habe den Eindruck, daß Rudolf von Eberstein alles tut, was sein Alter sagt. Und der Alte hat so etwas wie eine Gauner-ehre. Vielleicht hält er sein Wort. Dennoch, wenn sie irgend etwas gegen mich im Schilde führen, so sollen sie mich wenigstens nicht unvorbereitet finden. — Bist du fertig?«
»Mit dieser Bombe, ja. Aber ich möchte Euch doch den Vorschlag machen, Euch nicht mit einer zu begnügen. Ihr könnt zwei, drei Stück leicht in Eurer Kleidung verbergen.«
»Gut, fertige noch zwei an.«
Sorgfältig prüfend fuhr Michel mit der Hand über das Profil der Feile. Er schien von dem Ergebnis befriedigt zu sein. Jedenfalls legte er sie zur Seite und zog aus einem Schrank einen sehr langen, wenn auch dünnen, so doch haltbaren Lederriemen hervor. Dann entledigte er sich seiner Oberkleidung und wickelte sich dieses Seil in sauberen Windungen um seinen Oberkörper. Dabei zog er es nicht zu fest an, damit er Spielraum zum Atmen hatte.
Nach einer Weile meinte Ojo:
»Ich bin fertig, Señor Doktor.«
»Dann geh hinüber und frage Jehu, ob er einen Wagen besorgt hat.«
»Bueno.«
Ojo erhob sich und verließ das Zimmer.
53
Der Zeiger der Kirchturmuhr von Sankt Martin rückte auf die volle Stunde zu. Eberstein saß ungeduldig wartend im Wachlokal. Im ganzen gesehen war seine Laune ausgezeichnet.
Auch der Soldaten hatte sich eine merkwürdige Unruhe bemächtigt.
»Also nochmals, Sergeant«, nahm Eberstein das Wort, »keine Gewehre. Schärft den Leuten ein, daß sie die Pistolen so verstauen sollen, daß man sie nicht sehen kann. Dennoch müssen sie jederzeit griffbereit sein; denn der, den es zu fangen gilt, ist ein kluger Fuchs. Er war schon hundertmal in solchen Situationen. Wir müssen höllisch aufpassen, wenn wir den Deserteur schnappen wollen.«
»Jawohl, Herr Major.«
»Gut.«
In diesem Augenblick schlug es vier Uhr. Eberstein erhob sich hastig und ging nach draußen.
Auf der Straße war weit und breit niemand zu sehen.
»Verdammt«, murmelte Eberstein vor sich hin, »der Kerl scheint doch zu klug zu sein, in die Falle zu gehen. Nun, dann ist er jedenfalls seine zweitausend Dukaten los.«
In diesem Moment wurde am Ende der Straße eine Gestalt sichtbar. Es war der Pfeifer.
Ein befriedigtes Aufleuchten ging über die Züge Ebersteins.
»Ihr seid pünktlich«, sagte er, als der Pfeifer heran war.
Michel nickte und sah ihn durchdringend an, so, daß es Eberstein unter diesem sezierenden Blick ungemütlich wurde.
»Kommt«, sagte er, »Euer Vetter wartet schon.«
»Überlegt Euch gut«, meinte Michel leise, »was Ihr tun wollt. Wenn Ihr irgendeine Teufelei im Schilde führt, so ist es um Euch geschehen.«
Eberstein bemühte sich, keine Reaktion auf diese Drohung zu zeigen. Barsch fragte er:
»Seid Ihr bewaffnet? — Ihr müßt die Waffen abgeben.«
»Spart Euch Eure dummen Fragen. Ihr seht, daß ich nichts bei mir habe. Ich bin klug genug, um zu wissen, daß ich nicht bewaffnet in ein Gefängnis hinein darf.«
»Gut, gehen wir.«
Sie betraten die Wachstube.
»Sergeant«, befahl der Major, »bringt diesen Mann in die Zelle des Premierleutnants Baum.
Gebt acht, daß er die Sprechzeit von einer halben Stunde nicht überschreitet.«
»Jawohl, Herr Major«, war die militärisch-knappe Antwort des Sergeanten.
Michel ging voran, der Sergeant mit zwei Leuten hinter ihm drein. So heischte es die Gefängnisordnung. Vor einer Zellentür blieben sie stehen.
»Aufschließen«, befahl der Sergeant seinen Leuten barsch.
Die Tür schwang zurück. In der Zelle war es so dunkel, daß man kaum die Hand vor den Augen sehen konnte.
»Premierleutnant Baum«, sagte der Sergeant um eine Nuance höflicher, »Ihr habt Besuch.
Redezeit dreißig Minuten.«
Michel trat einen Schritt vor. Da erhielt er plötzlich einen Stoß in den Rücken und taumelte in die Zelle. Er war auf ähnliches gefaßt gewesen. Er hatte mit allem gerechnet. Blitzartig fuhr er herum und starrte in die Läufe dreier Pistolen und in das grimmige Gesicht des Sergeanten.
Читать дальше