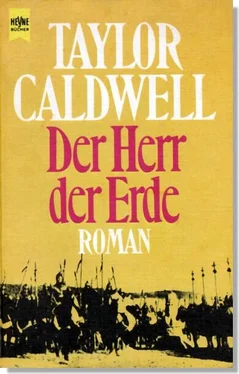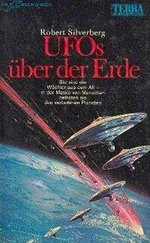Subodai schwieg. Dann blickte er zum Himmel empor. „Es ist Abend“, sagte er. „Wir werden hier unser Nachtlager aufschlagen.“
Einer seiner Offiziere kam nähergeritten, um Subodais Befehle entgegenzunehmen. Jamuga betrachtete neugierig das mächtige Heer, das gekommen war, um einen wehrlosen Mann festzunehmen. Er sah die dunklen, drohenden Gesichter der Krieger und bemerkte, daß sie den Blick abwendeten, wenn er sie ansah.
Jamugas Nasenflügel weiteten sich, und das Herz begann einen haltlosen Galopp in seiner Brust. Ein Sturmwind der Angst und bösen Vorahnung fegte über ihn hinweg. Er wandte sich Subodai zu und sah, daß er anscheinend ganz darin versunken war, seinem Pferd das Sattelzeug abzunehmen. Nicht eine Stimme wurde laut, als die Krieger das Nachtlager aufschlugen.
Jähe Angst bemächtigte sich Jamugas. Er vermochte kaum zu atmen. Er näherte sich Subodai und sagte:
„Warum hier unser Lager aufschlagen? Wir haben noch ein bis zwei Stunden Tageslicht vor uns, und der Rückweg ist nicht beschwerlich.“
Subodai sah ihn lange an und seine Züge wurden weich.
„Meine Leute sind müde. Ich halte es für das beste zu schlafen, ehe wir weiterreiten.“
Ihre Blicke tauchten ineinander. Subodais Blässe vertiefte sich noch, und einen Augenblick hatte Jamuga das unglaubliche Gefühl, daß Tränen in Subodais Augen standen. Aber das war ausgeschlossen; es war nichts weiter als das Spiegelbild des brennenden Sonnenunterganges.
Subodai legte Jamuga die Hand sanft auf die Schulter. „Du wirst mit mir essen, Jamuga, und wir werden im gleichen Zelt schlafen. Ich habe dir viel zu sagen.“
Jamuga schöpfte neue Hoffnung, und sein unklarer, wortloser Schreck lichtete sich. Tiefe Ruhe erfaßte ihn. Subodai war sein Freund, und er vertraute ihm vollständig.
Keiner der beiden Männer konnte viel essen, als ihnen das Mahl vorgesetzt wurde. Aber Subodai trank, und Jamuga folgte seinem Beispiel. Die bittere Kälte der Wüstennacht umgab sie, aber das Lagerfeuer war warm, und jenseits des Feuerscheins lagen die dunklen Umrisse der in ihre Mäntel gehüllten schlafenden Krieger, und dahinter standen die angepflockten Pferde. Von allen Menschen und Tieren waren Jamuga und Subodai die einzigen, die nicht schliefen, mit Ausnahme der Wachen, die in der Finsternis nicht zu sehen waren.
Der Wein und die Gegenwart seines Freundes machten Jamuga gesprächiger, als er es für gewöhnlich war. Er erzählte Subodai von seinem Volk, seiner Frau und seinen Kindern. Während er sprach, wurde er zu jemandem, der vor einem Richter für all das bat, was ihm teuer war. Subodai hielt den Weinbecher in der Hand und hatte lauschend den Kopf gesenkt, daß Jamuga nur einen Teil seines schönen Gesichts sehen konnte.
„Ich glaube, eine Lebensart gefunden zu haben, die echt und schön ist“, sagte Jamuga. „Ich habe meinem Volk Frieden und Zufriedenheit gegeben. Es ist harmlos, treu und großzügig. Es verlangt von seinen Nachbarn nichts als Freundschaft. Ich bedaure, daß du meine Leute nicht sehen wirst, Subodai.“
Der bewegte sich. „Hast du etwas gesagt?“ fragte Jamuga und neigte sich näher, um das Gesicht des anderen zu sehen.
Subodai hob seinen Becher und trank. Dann blickte er Jamuga ernst und freundlich an. „Ich sagte nichts, Jamuga.“
Jamuga fuhr fort, von seinem Volk zu berichten, und Subodai hörte ihm zu. Zeitweise brach Jamugas Stimme unter innerer Erregung, und unwillkürlich rang er die Hände. Seine Stimme war der einzige Laut unter dem Mond, und es schien, als lauschte ihm die ganze Erde.
Nach einer Weile hörte er zu sprechen auf. Er war unbeschreiblich müde, aber wieder erfüllte ihn tiefe Ruhe, denn die Schilderung dessen, was er liebte, durchdrang ihn neuerlich mit dem süßen Bewußtsein seines Opfers.
Subodai sagte noch immer nichts. Und nach kurzer Pause erkundigte Jamuga sich nach seinem früheren Volk. Er hatte bisher noch nicht nach Temudschin gefragt, und Subodai hatte nicht vom Khan gesprochen.
Subodai schienen Jamugas Fragen eine unendliche Erleichterung zu bedeuten. Er sagte: „Leider ist vor wenigen Tagen Kurelen gestorben und kurz darauf Houlun.“
Jamuga war tief betroffen. Und dann sagte er schlicht von seinem alten Blutsbruder: „Temudschins Herz wird schwer sein, denn Kurelen war wie ein Vater zu ihm, und trotz vieler Streitigkeiten liebte er seine Mutter.“
Er wartete ungeduldig darauf, daß Subodai von Temudschin erzählen sollte. Er begriff selbst nicht, weshalb sein Puls zu jagen begonnen hatte, als erwarte er den Namen eines Menschen, der ihm unsagbar teuer war.
Aber Subodai sagte nichts. Seine Miene war unergründlich. Jamuga konnte sich diesen Ausdruck nicht erklären. Beinahe gegen seinen Willen sprach er wieder von Temudschin. „Er ist doch gesund, nicht wahr?“
„Er ist gesund“, erwiderte Subodai beinahe unhörbar.
Dann senkte sich wieder das Schweigen auf sie. Das Lagerfeuer war herabgebrannt. Das Mondlicht schwamm wie geisterhaftes Wasser über der düsteren Gegend. Die Luft wurde kälter, und ein oder zwei Pferde in der Nähe wieherten ängstlich auf. Und die beiden Männer saßen Seite an Seite, waren in wehmütiges Nachdenken versunken, und das hellrote Licht des Feuers lag in den Falten ihrer Mäntel und auf ihren Gesichtern.
Auf unerklärliche Art wußte Jamuga jetzt, daß sich in Subodai ein entsetzlicher Kampf abspielte, etwas, das einer Erschütterung seines ganzen Seins gleichkam. Weder mit einem Blick noch einer Bewegung verriet Subodai sich, aber Jamuga ahnte diesen Kampf. Seine Seele sprang zitternd auf, als sähe sie einen unbarmherzigen Feind. Seine Muskeln wurden starr wie Eisen; er hätte sich um nichts in der Welt bewegen können. Eiskalter Schweiß brach ihm aus, und er hatte einen bitteren Geschmack im Munde.
Und Subodai, der mit gebeugtem, abgewandtem Kopf neben ihm saß, sah aus, als ob er schliefe.
Mehrmals versuchte Jamuga zu sprechen, aber jedes Mal erstarb ihm die Stimme in der Kehle. Schließlich sagte er schwach und durch spröde, eiskalte Lippen: „Subodai, du hast mir etwas verschwiegen!“
Subodai seufzte. Er schien in seinem Mantel einzuschrumpfen. Dann hob er den Kopf und sah Jamuga mit dem Ausdruck grenzenloser Verzweiflung an.
„Du hast recht, Jamuga. Ich habe dir nicht alles gesagt.“
Jamuga ballte die Fäuste, daß sich seine Nägel ins Fleisch gruben, aber er sagte gefaßt: „Ich bin kein Weib. Sage mir, was du mir zu sagen hast.“ Die Fahlheit des Todes breitete sich auf seinem Gesicht aus.
Subodai erwiderte sanft: „Ich bin gekommen, um dich gefangenzunehmen, Jamuga, und dich unverletzt bei Temudschin abzuliefern, wo dich deine Bestrafung erwartet.“
Jamuga nickte. Er hatte das Gefühl, ersticken zu müssen. „Das weiß ich!“ rief er. „Aber was sonst noch?“
Subodai benetzte seine bebenden Lippen. „Dieses, Jamuga: ich habe den Befehl, all deine Untertanen zu töten, und nur die jungen Frauen und die Kinder, die nicht größer als ein Karrenrad sind, zu verschonen und mit mir zurückzuführen.“
Jamugas Gesicht verfiel zusehends, daß es aussah wie das eines Toten. Dann stieß er plötzlich einen grauenhaften Schrei aus wie ein zu Tode getroffenes Tier. Bei diesem Laut wachten die Pferde auf und wieherten entsetzt, und mehrere Männer stützten sich auf die Ellbogen, blinzelten und tasteten nach ihren Waffen.
Jamuga packte Subodai am Arm und schüttelte ihn heftig.
„Das lügst du! Nicht einmal Temudschin wäre einer solchen Untat fähig! Du lügst, Subodai!“
Subodai betrachtete die Hand auf seinem Arm und legte nach einem Augenblick seine eigene darauf. Er spürte ihren totenähnlichen Schweiß, die angespannten Sehnen, die sich wie in letzter Zuckung strafften.
„Jamuga, ich lüge nicht“, sagte er in mitleidigem Ton. „Ich wollte zu Gott, es wäre eine Lüge.“
Читать дальше