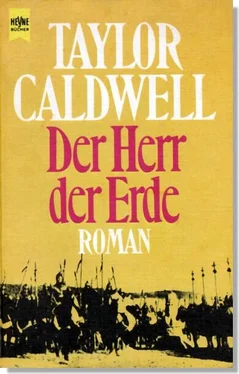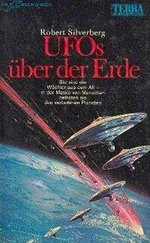Jamuga neigte den Kopf und brach in lautes Schluchzen aus, das grauenhaft anzuhören war. Subodai legte den Arm um ihn. Mitleid und Schmerz durchbohrten ihn wie ein Messer. Er hatte ihm keinen Trost zu bieten und vermochte nur, seinen Freund stumm zu umarmen.
Plötzlich schüttelte Jamuga mit ungestümer Bewegung den Arm ab. Wieder gruben sich seine Finger in Subodais Fleisch.
„Aber du bist doch kein Ungeheuer, Subodai! Du kannst doch diese wehrlosen Menschen nicht kaltblütig ermorden!“
Subodai seufzte. „Ich habe meine Befehle. Ich muß gehorchen. Ich muß immer gehorchen.“
„Aber nicht, wenn es um ein Verbrechen geht!“ schrie Jamuga und klammerte sich in maßloser Erregung an seinen Freund und rüttelte ihn. „Du kannst Temudschin sagen, daß du zur Niederlassung meines Volkes gekommen bist und entdecken mußtest, daß meine Leute geflohen sind und keinerlei Spur hinterlassen haben!“
Subodai fühlte, wie sich ihm Jamugas Hände gleich Eisenklammem ins Fleisch krallten. Aber er konnte Jamuga nur in unendlicher Qual ansehen.
„Ich habe meine Befehle, Jamuga, und du weißt, daß ich immer nur lebte, um zu gehorchen.“
Jamuga starrte ihn an. Der Wahnsinn glühte in seinen Augen. Dann hob er die Hand und schlug Subodai mit aller Kraft ins Gesicht. Wieder und immer wieder schlug er zu. Und Subodai rührte sich nicht. Er blickte Jamuga nur traurig und verstehend an, obwohl seine Wange dunkelrot anlief und Blut aus seinen Mundwinkeln floß. Schließlich packte er Jamugas Hand beim Gelenk und hielt sie fest.
„Jamuga“, sagte er unglücklich, „du weißt, daß dir das nichts nützt.“
Verzweifelt brach Jamuga zusammen und weinte. Das Haupt sank ihm auf die Brust. Subodai gab seine Hand frei und hörte sich das steinerweichende Schluchzen an. Die widerstreitendsten Gefühle huschten über sein zerschlagenes, blutendes Gesicht. Immer wieder seufzte er tief auf. Einmal hob er die Hand, wischte sich das Blut von seinen Lippen und starrte seine rotgefärbten Handrücken verständnislos an.
Dann war Jamuga still. Die Verzweiflung hatte ihn verstummen lassen. Reglos, mit herabgesunkenem Kopf, saß er da. Vorsichtig blickte Subodai sich um. Er zögerte. Dann legte er die Lippen an Jamugas Ohr und flüsterte:
„Hör mich an, Jamuga. Du hast gesagt, dein Volk ist unbewaffnet. Er erwartet uns nicht. Man wird es abschlachten wie die Lämmer. Ich gestatte dir, deinen Leuten noch heute nacht einen Boten zu schicken, der sie vor unserem Anrücken warnt, und sie eindringlich bittet, sich auf ihre Verteidigung vorzubereiten. Dann werden sie zumindest wie Männer fallen, die für sich und ihre Familien kämpfen.“
Jamuga hob den Kopf. Mit ersterbenden Augen sah er Subodai an.
„Sie haben kaum Waffen“, sagte er mit gebrochener Stimme.
„Trotzdem werden sie mit dem wenigen kämpfen, das sie besitzen.“ Nach kurzer Pause sagte er müde: „Das ist alles, was ich dir anbieten kann. Für mich ist es auch kein Vergnügen, unbewaffnete Menschen zu töten.“
Er stand auf, trat zu einem Schlafenden, versetzte ihm mit ungewohnter Brutalität einen Stoß, hieß ihn aufstehen und sein Pferd satteln. Dann kehrte er zu Jamuga zurück und nahm wieder neben ihm Platz. Er öffnete seine Reisetasche und entnahm ihr ein derbes Stück Pergament und eine Feder. Beides legte er auf Jamugas Knie. Jamuga starrte das Schreibzeug blicklos an und rührte keinen Finger.
„Ich habe nur eine Bitte, Jamuga“, sagte Subodai ernst, „und die lautet: Wenn wir uns dem Lager deines Volkes nähern, wirst du nicht versuchen, deinen Leuten zu helfen, denn ich habe den Befehl, dich unversehrt zu Temudschin zu bringen. Du mußt mir dein Wort geben, sonst ziehe ich mein Angebot zurück.“
Jamuga griff mit starren Fingern nach der Feder. Jedes Leben war aus seinem Gesicht gewichen. „Ich gebe dir mein Wort“, sagte er und begann zu schreiben. Die Schriftzeichen waren unbeholfen und zittrig.
Er beschwor sein Volk, sich bis zum letzten Tropfen Blut zu verteidigen, da der mörderische Feind heranrücke.
„Ich weiß, Ihr habt wenig Waffen, um Euch zu wehren, aber ich flehe Euch an, wie Männer für alles, was uns teuer ist, zu kämpfen. Das ist alles, was ich für Euch zu tun vermag. Und ich beschwöre Euch, mir meine Schuld an Eurer Tragödie zu verzeihen. Auf Knien beschwöre ich Euch, meiner nicht in Bitterkeit zu gedenken, sondern in dem Bewußtsein, daß ich Schmerz und Tod mit Euch teile.“
Er hob die Feder. Beinahe wäre sie seinen Fingern entglitten, aber er war sichtlich noch nicht zu Ende.
Wieder begann er zu schreiben, und jetzt zitterte seine Hand derart, daß die Schriftzeichen kaum leserlich waren:
„An Yesi, meine Gemahlin: Meine einzig Geliebte, verzeihe mir Dein Geschick. Ich weiß, daß die Frauen und Kinder unseres Volkes als Sklaven in Temudschins Lager gebracht werden sollen. Und ich bitte Dich aus ganzem Herzen, dies nicht mit Dir und meinen Kindern geschehen zu lassen. Wir werden uns wiedersehen, Geliebte. Deine christliche Religion hat Dich das gelehrt. Jenseits dieser Finsternis werde ich Dich und meine Kinder wieder umarmen. Bis morgen, meine innigst geliebte Frau.“
Er übergab Subodai das Pergament, der es ohne zu zaudern las.
Der des Lesens unkundige Krieger stellte sich nun zur Befehlsentgegennahme. Subodai reichte ihm den Brief, heftete den Blick auf ihn und sagte leise und deutlich:
„Dies ist eine Botschaft des Tarkhans Jamuga Sechen, in der er sein Volk aufruft, sich widerstandslos zu ergeben. Übergib diese Nachricht den alten Männern, die lesen können.“
Der Krieger salutierte, schnellte auf dem Absatz herum und entfernte sich. In der tiefen Stille vernahmen sie den Hufschlag seines Pferdes, das in der Nacht entschwand.
XXI
Sein tiefes Mitleid bewog Subodai, Jamuga nicht zu gestatten, ihn und seine Krieger in das Lager der Naimanen zu begleiten. Er wußte, daß der Anblick dessen, was sich dort abspielen würde, dem Unseligen das Herz brechen mußte.
Deshalb ließ er Jamuga mit einem kleinen Trupp Kriegern zurück, um auf seine Wiederkehr zu warten.
Jamuga hatte aufgehört zu weinen. Er lauschte Subodais letzten, mitfühlenden Worten, aber verriet mit keinem Zeichen, daß er sie gehört hatte. Er machte bereits den Eindruck eines Toten. Die unerschütterliche Ruhe der Hoffnungslosigkeit hatte sich über ihn gesenkt. Subodai nahm an, daß seine Seele gestorben sei und nur das schwache Fleisch in den letzten Zuckungen der bewußtlosen Auflösung übrig war. Seine Augen waren glasig, sein Atem ging langsam und unregelmäßig. Er saß inmitten einer Gruppe von Kriegern, hatte den Blick starr auf den Boden gerichtet und ließ die Hände schlaff zwischen den Knien hinabhängen.
Subodai erteilte den Befehl, Jamuga jede Annehmlichkeit angedeihen zu lassen, die er wünschte. Er wußte, während er schweren Herzens davonritt, daß Jamuga nichts mehr essen und auch nie wieder ausruhen würde.
Die zurückbleibenden Krieger waren ärgerlich und beklagten sich mit aufsässigen Blicken auf Jamuga untereinander darüber, daß sie nicht an der Hatz teilnehmen durften, auf die sie sich schon so gefreut hatten. Sie befürchteten, nur die Überreste der Beute und die häßlichsten Weiber zu bekommen. Schließlich aber beruhigte sein Aussehen sie doch. Als ob wir einen Toten bewachten, murmelten sie. Einige tuschelten, daß sein Geist entschwunden sei und vielleicht ein fremder, böser Geist von seinem Körper Besitz ergreifen würde. Deshalb betrachteten sie ihn aus furchtsamen Augen.
Der Tag verstrich. Die unruhigen Krieger jagten in der unmittelbaren Umgebung auf Wild. Sie boten Jamuga Speise und Trank an, aber er blickte sie an, ohne sie wahrzunehmen. Stunde um Stunde wälzte sich vorbei, und er saß reglos, mit starrem, verglastem Blick und hängender Unterlippe. Sein Brustkorb hob sich kaum unter seinem Atem. Die Krieger ergötzten sich rund um ihn an Glücksspielen, lachten und sangen heiser. Aber er hörte sie nicht, und schließlich verstummten auch sie in abergläubischer Angst.
Читать дальше