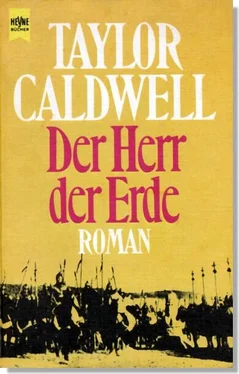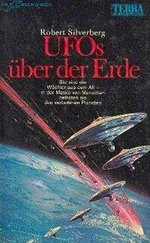Nach langer, lähmender Stille, in der Houlun und ihr Sohn wie erstarrt auf Kurelen blickten, brach Houlun in schrille, durchdringende Schreie aus. Sie warf sich neben ihren Bruder und hob seinen Kopf hoch. Blut floß über ihre Hände. Schlagartig verstummten ihre Schreie. Sie sah in die toten, weit aufgerissenen Augen. Dann schrie sie neuerlich auf. Sie drückte das Haupt ihres Bruders an ihre Brust, und ihr Körper wurde naß von seinem Blut. Sie griff nach seinen Händen, drückte sie an ihre Lippen und küßte sie in leidenschaftlicher Hingabe. Sie küßte sein Haar, seine Wange, seine erkaltenden Lippen. Ihr langes, grauschwarzes Haar fiel über ihn und verbarg mitleidig seinen grauenhaften Anblick und seine Augen. Sie schien den Verstand verloren zu haben. Sie schloß ihn wie ein kleines Kind in die Arme, stöhnte, schaukelte kniend hin und her und brach in die sonderbarsten Klagen aus:
„Mein Liebling! Mein Herzallerliebster! Wen habe ich denn außer dir geliebt? Du, der du Teil meines Fleisches und meiner Seele gewesen bist? Nur dich, mein Geliebter, nur dich! Sprich mit mir, sag mir wieder, daß du mich liebst, mein Bruder, mein Geliebter, mein Einziger!“
Temudschin stand wie eine Bildsäule, betrachtete die grauenhafte Szene, vernahm die Worte seiner außer Rand und Band geratenen Mutter, lauschte ihren Schreien. Ihr leidenschaftlicher Singsang gellte ihm in den Ohren. Sie war eine Frau, der man den Geliebten erschlagen hatte, eine Mutter, die hemmungslos den Tod ihres Sohnes beklagte. Sie war die fleischgewordene Verzweiflung, das Sinnbild all jener, die je geliebt hatten und beraubt worden waren. Temudschin schloß krampfhaft die Augen. Die wehklagende, leiderfüllte, irre Stimme stach in sein Hirn. Es war mehr, als er ertragen konnte.
Er trat ins kalte, blaue Tageslicht hinaus. Seine Beine wurden kraftlos wie Wasser. Sein Kopf drehte sich, und sein Blick wurde trübe. Das Herz pochte ihm schmerzhaft in der Brust.
Er fand den Weg zu Kokchus Jurte.
Rasch und stockend sagte er:
„Mein Onkel Kurelen war in meiner Jurte und hat einen Schwächeanfall erlitten. Dabei ist er gestürzt und hat sich den Hinterkopf eingeschlagen. Geh du zu ihm und zu meiner Mutter, die dich braucht.“
Kokchu war auf seinem Diwan gelegen und hatte sich von seiner jungen Lieblingstänzerin fächeln lassen. Langsam erhob er sich. Er starrte Temudschin an, sah das düstere, blau unterlaufene Gesicht, die wilden Augen. Er sah, daß der Khan zitterte und ein Tropfen Blut auf seiner zerbissenen Unterlippe stand.
„Ich gehe“, sagte er mit seidenweichem Mitgefühl und griff nach seiner kleinen Silberdose mit den Amuletten. Noch immer aber vermochte er den neugierigen Blick nicht von Temudschins Antlitz zu lösen.
Und dann durchschaute der schlaue Priester plötzlich alles. Ein hämisches Licht wetterleuchtete über sein Gesicht. Aber er neigte den Kopf in geheuchelter Ergebenheit und Trauer und ging, um Temudschins Befehl zu erfüllen.
In Temudschins Jurte lag Houlun bewußtlos quer über den Körper ihres Bruders hingestreckt, und ihr Gewand war von seinem Blut durchtränkt. Als er versuchte, ihre Arme zu lösen, waren sie starr wie Stein. Man trug sie in ihre Jurte und überließ sie der Obhut ihrer Dienerinnen.
Als sie um Mitternacht wieder das Bewußtsein erlangte, erkannten die Dienerinnen entsetzt, daß sie den Verstand verloren hatte. Sie tobte, brüllte, lachte unaufhörlich, und raufte mit ihren Dienerinnen, die versuchten, sie mit Gewalt auf ihr Lager zu drücken. Die ganze Nacht hindurch hallte die Zeltstadt von ihren Schreien wider, und die Frauen erschauerten und drückten ängstlich ihre Kinder an sich.
Bei Anbruch der Morgendämmerung übermannte die Erschöpfung sie, und sie schien zu schlafen. Als ihre Dienerinnen jedoch erleichtert und müde die Pelzdecke über sie ziehen wollten, entdeckten sie, daß sie tot war.
XIX
Jamuga berief alle Männer seines Clans, ob alt oder jung, zu sich. Er sah sie mit bleicher, bekümmerter Liebe an, und da erkannten sie, daß ihn tiefe Sorgen quälten. Sie erwiderten seinen Blick und versuchten, ihm mit ihren entschlossenen Mienen neuen Mut einzuflößen.
Er berichtete ihnen von Temudschins Befehl und seiner eigenen Antwort. Dann wartete er und sah sie in ängstlichem Flehen an. Sorge, Furcht, Tapferkeit, Verwirrung und Mißtrauen glitten über ihre Gesichter. Sie murmelten untereinander. Und Jamuga wartete noch immer und rang ganz offen die Hände.
Dann machte sich ein alter Mann zum Sprachrohr der anderen:
„Herr, du hast das einzige getan, was zu tun war, und dein Volk ehrt und liebt dich dafür.“
Jamuga lächelte. Tränen stiegen ihm in die Augen.
„Ich danke euch allen“, sagte er demütig. Ihr Lächeln war Balsam für ihn. Sie umdrängten ihn wie eine lebendige Mauer und berührten ihn schüchtern und linkisch, um ihre eigene aufrechte Gesinnung auf ihn überströmen zu lassen.
Dann hob er abermals zu sprechen an, und diesmal klang wachsende Wehmut aus seinen Worten:
„Einmal hat mir jemand gesagt, daß es mehr braucht, als ein bloßes angewidertes Zusammenzucken des Bauches, um die Welt zu retten. Ich glaubte ihm nicht. Ich dachte, daß ein Volk, das den Frieden will und liebt, auch schon ausreichend gesichert ist. Ich dachte, wenn ein Volk nur gut ist, in Brüderlichkeit lebt und keinen Hader sucht, dann kann es auch von keiner Schlechtigkeit bedroht sein und es bedarf nicht der Waffen und der Kriegskunst. Wenn ein Volk seine Nachbarn mit Wohlwollen betrachtet und sie gerecht, ehrenhaft und barmherzig behandelt, dann können seine Nachbarn es niemals angreifen, sondern müssen es in Frieden lassen. Wer keinen Krieg und keine Eroberung sucht, sondern zufrieden lebt, der war meiner Meinung nach ein unbedrohter Mensch. Er brauchte sich nur seinem eigenen Haushalt und seinen eigenen Herden zu widmen, um begehrliche Blicke abzuwehren, und wenn er sich auf seine eigenen Angelegenheiten beschränkte, so würde seine Umgebung ihn vergessen.“
Er seufzte traurig auf. „Ich habe mich geirrt, meine Brüder. Ich sehe jetzt, daß man den Frieden genauso entschlossen verteidigen muß wie jeden anderen Schatz. Tyrannen kann man nur mit einem Heer begegnen, das kräftiger als ihr eigenes ist. Um vor Angriffen sicher zu sein, muß man zuerst Sorge tragen, so mächtig zu werden, daß keiner den Angriff wagt. Manchmal ist es nötig, daß die Menschen ihr Leben im Kampfe lassen, um den Frieden der Welt zu sichern. Für Gerechtigkeit, Freiheit und Beschaulichkeit müssen die Menschen manchmal zu den Waffen greifen und ihr Leben für die Sicherheit ihrer Kinder opfern.
In meinen weltfremden Träumen habe ich das nicht erkannt. Allein der ehrliche Wunsch nach dem Frieden müßte genügen, dachte ich. Durch meine irrige Annahme habe ich euch alle in schwere Gefahr gebracht. Ich habe euch wehrlos dem Feind ausgeliefert. Ich habe den Frieden zerstört, weil ich das Schwert haßte. Ich habe über eure Frauen und Kinder den möglichen Tod und die Sklaverei heraufbeschworen. Ich bin euer wahrer Feind, ich der an euch schuldig Gewordene.“
Aufgerichtet stand er vor ihnen und weinte.
„Ich habe euch der Möglichkeit beraubt, euer Heim und eure Weiden zu verteidigen. Ich habe eure Herzen mit Sanftmut erfüllt und euch das militärische Wissen vorenthalten. Deshalb sind wir wie ein fetter Wurm, der hilflos den Schnabel des Geiers erwartet.“
Der alte Mann, der vorher schon der Wortführer gewesen war, kniete vor Jamuga nieder und hob die Hände hoch.
„Wie dem auch sei, Herr, sind wir bereit, jetzt für den Frieden zu kämpfen.“
Jamuga legte ihm die Hand auf die Schulter.
„Nein“, sagte er gramerfüllt, „dazu ist es zu spät. Womit wollt ihr kämpfen? Mit euren nackten Händen, die einzig an den Pflug gewöhnt sind? Wollt ihr den Schwertern der rachedurstigen Feinde sinnlos eure ungeschützte Brust entgegenhalten? Meint ihr, daß eure Tapferkeit genügt, um euch vor den geschulten, grausamen Horden des anrückenden Feindes zu schützen? Selbst wenn ein Mann mutig wie ein Tiger und furchtlos wie ein Falke ist, wird ihm das nichts nützen, wenn er keine Waffen besitzt.“
Читать дальше