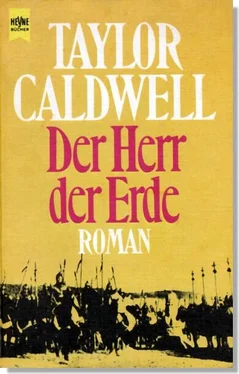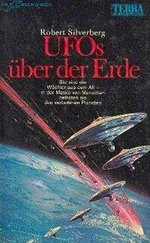Die Nacht zog herauf. Die Krieger schliefen. Nur ein einziger hielt bei Jamuga Wache. Aber der rührte sich noch immer nicht. Unverändert hockte er da, als wäre er in sitzender Stellung gestorben. Er legte sich nicht nieder. Er sprach kein einziges Wort und seufzte nicht einmal. Als der Morgen dämmerte, warf er sein strahlendes Licht auf Jamugas kaltes, eingefallenes Gesicht, das wie das Antlitz eines Toten wirkte.
Die Krieger staunten, daß er noch lebte. Ein oder zwei der weniger Blutdürstigen wurden sogar von ungewohntem Mitleid gestreift. Noch nie waren sie Zeugen so tiefer Verzweiflung geworden. Sie hofften, daß er zu jammern oder zu weinen beginnen würde. Dann hätten sie sich etwas erleichtert gefühlt.
Der Tag verging und wieder wurde es Nacht, und Jamuga wartete noch immer starr wie ein Bildwerk. Niemand konnte ahnen, ob er wachte, schlief oder bewußtlos war. Bei Einsetzen des Morgengrauens waren jene, die ihn bedauert hatten, bitter enttäuscht, daß er noch immer lebte.
Jetzt bereiteten sie sich auf die Rückkehr ihres Generals und ihrer Kampfgenossen vor. Ein oder zwei erkletterten eine Bodenwelle und spähten nach Osten. Über ihrem erregten Rätselraten vergaßen sie Jamuga, ihre Angst und ihr widerwilliges Bedauern. Wieder beschwerten sie sich, daß sie nicht mitkommen hatten dürfen und hänselten sich gegenseitig mit der Vorhersage, daß sie bloß die alten Vetteln und die schäbigen Reste der Beute bekommen würden. Sie ergingen sich in Mutmaßungen über die Schönheit der Naimanerinnen und machten derbe, obszöne Witze. Ein Mann jammerte, daß all seine Frauen aussähen wie Eselinnen. Er hatte gehofft, ein oder zwei hübsche Mädchen von den Naimanen zu ergattern.
„Bestimmt wirst du noch eine Eselin bekommen“, verspotteten ihn seine Kameraden.
Um sich die Zeit zu vertreiben, hielten sie Ringkämpfe und Säbelgefechte ab. Ihre Stimmen hatten bereits den gehässigen Ton echter Streitsucht angenommen. Ihre Unruhe wuchs, und ihre Angst vor Jamuga schwand. Laut verhöhnten sie ihn und weideten sich an dem ihm bevorstehenden Geschick.
„Wenn seine Frau schön ist, wird sie mit unserem Gebieter schlafen und diesen bleichen Schatten vergessen“, sagte der eine. „Sie wird ihm Söhne gebären und keine Ziegen.“
Aber noch immer hörte und sah Jamuga nichts. Das bellende Gelächter rührte ihn nicht. Stündlich verfiel sein Gesicht mehr, und immer stärker ähnelte er einem Toten.
Und dann, bei Sonnenuntergang des dritten Tages, brach ein Späher in begeistertes Geschrei aus. Die Krieger kehrten zurück. Der Posten berichtete, daß hinter ihnen eine große Anzahl von Jurten rumpelte, daß viele Pferde und eine umfangreiche Herde mitkam. Seine Kameraden liefen ihnen entgegen. Sie brüllten und polterten vor Begeisterung.
Sie vernahmen Jamugas schwachen, spitzen Schrei nicht, bemerkten nicht, daß er sich taumelnd erhob und schwer gegen die Flanke des weißen Felsens lehnte, der sie vor dem unausgesetzten Wind beschützt hatte. Sein gespenstisches, hageres Gesicht zuckte, seine ausgetrockneten Lippen bebten. Heiser schnappte er nach Luft; seine abgezehrten Finger faßten nach dem brüchigen Stein, und er schwankte.
Subodai ritt an der Spitze der breiten Kette siegreicher Krieger, Karren, Herden und Pferde. Er hielt den Kopf gesenkt und schien in schmerzlicher Betäubung dahinzureiten. Aus den Karren hinter ihm klang unaufhörliches Wimmern und Schluchzen.
Sobald er sich der Bodenwelle näherte, blickte er auf und sah Jamuga. Er biß sich auf die Lippen und gab seinem Pferd die Sporen. Angelangt, sprang er ab und rannte nach vorn. Die Krieger stürmten ihm brüllend entgegen, um sich unter die Rückkehrenden zu mengen. In dem Durcheinander näherte Subodai sich Jamuga, sah ihn rasch und bedauernd an und legte ihm den Arm um die Schultern.
Jamuga holte tief und schluchzend Atem. Verzweifelt klammerte er sich an seinen Freund und rief gebrochen: „Meine Frau? Meine Kinder?“
Subodai schloß die Augen. Er konnte den Anblick dieses Gesichts nicht ertragen.
„Tröste dich“, sagte er behutsam. „Sie sind nicht hier.“
Jamuga taumelte gegen ihn. Sein Körper erzitterte unter heftigem Schluchzen. Aus seiner Brust löste sich ein tiefes Stöhnen, als bräche ihm das Herz. Subodais Arm schlang sich fest um ihn, und sein schönes Antlitz wurde finster und ingrimmig wie in fürchterlichem Zorn.
„Du bist krank“, sagte er mitfühlend. „Komm, du mußt dich in einer der Jurten niederlegen.“
Jamuga schüttelte den Kopf. Seine Erschöpfung vertiefte sich, daß Subodai das Gewicht seines Körpers abstützen mußte.
„Dann wirst du neben mir reiten.“
Er wollte, daß Jamuga an der Spitze des Zuges ritt, damit er möglichst wenig von dem ständigen Wehklagen der Gefangenen hören sollte. Jamuga verstand ihn, und wieder schüttelte er den Kopf.
„Ich reite zum Schluß“, murmelte er schwach. „Ich habe dieses Elend verschuldet. Meine Ohren müssen sich mit den Schreien jener füllen, denen ich so entsetzliches Unrecht angetan habe.“
Subodai fürchtete, daß Jamuga die Ankunft in Temudschins Lager gar nicht mehr erleben würde. Er setzte Jamuga seine eigene Trinkflasche mit Wein an die Lippen. Mechanisch schluckte Jamuga. Aber sein schmerzerfüllter Blick schweifte über Subodai hinweg und nahm nichts als den Karrenzug und das entsetzliche Wehklagen zur Kenntnis.
Halb trug, halb zerrte Subodai den Taumelnden zu einem Pferd und half ihm beim Aufsitzen. Der Worte nicht mächtig, saß Jamuga in stummer Qual vornübergebeugt auf dem Pferd. Subodai sprang auf seinen Hengst und ergriff die Zügel von Jamugas Roß. Er war in tiefster Besorgnis und wußte, daß er Jamuga um jeden Preis aus seiner Teilnahmslosigkeit reißen mußte.
„Dein Volk ist in tapferem Kampf gefallen“, sagte er. „Es hat sich so meisterhaft verteidigt, daß ich eine stattliche Zahl meiner besten Leute verloren habe.“
Jamuga sah ihn an. „Das ist mir kein Trost“, sagte er schwach.
Die riesige Karawane setzte sich in Bewegung.
In seinem Sattel zusammengekauert, hörte und bemerkte Jamuga nichts als das Wimmern der Frauen und Kinder, die in den Karren mitgeführt wurden.
Und Subodai ritt neben ihm, hielt die Zügel seines Pferdes und sah bitter und todernst vor sich hin.
„Ich lebe nur, um zu gehorchen, nur um zu gehorchen“, wiederholte er sich selbst in hypnotischer Litanei, als versuchte er, das Tosen der ihn bestürmenden Gedanken zu übertönen.
XXII
Im Morgengrauen rannte ein Offizier zu Temudschins Jurte.
„Subodai rückt an!“
Temudschin hatte geschlafen. Nun war er schlagartig wach. Er knöpfte seinen Rock zu und zog sich die Stiefel an. Hutlos trat er ins klare Morgenlicht, und das rote Haar fiel ihm wie eine feurige Löwenmähne auf die Schultern. Längs eines purpurroten Berges war die Karawane deutlich zu erkennen. Temudschin beschattete seine Augen und betrachtete die Karawane lange Zeit. Dann kehrte er in seine Jurte zurück und setzte sich auf sein Lager.
Er bewegte sich nicht und starrte blicklos vor sich hin.
Eine dunkelrote dicke Ader pulsierte heftig wie eine schlanke, zuckende Schlange an seiner Stirn.
Nach langer Zeit wurde die Eingangsklappe der Jurte zurückgeschlagen, und Subodai trat blaß und ruhig ein. Er salutierte und stand hölzern vor seinem Khan.
„Ich bin zurückgekehrt“, meldete er still. „Ich habe die Naimanen besiegt und deine Befehle ausgeführt. Ich habe Jamuga Sechen als Gefangenen mitgebracht.“
„Du hast dich wacker gehalten“, erwiderte Temudschin mechanisch nach langer Pause. Dann versank er wieder in Schweigen und sah Subodai an.
Subodai sagte: „Jamuga Sechen liegt im Sterben. Ich habe ihn in meine Jurte tragen lassen, damit er die so bitter benötigte Ruhe hat. Aber er wird nicht schlafen.“
Читать дальше