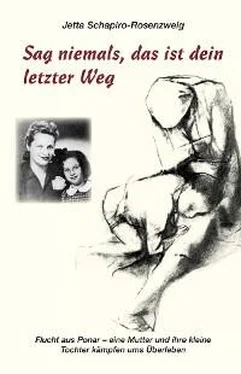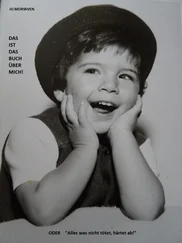Wir hatten wenig Kontakt nach außen. Außer Wladek sahen wir nur Lolka Feldstein, die jeden Abend zu uns kam. Sie hatte einen Bruder im Ghetto, aber sie durfte es nicht wagen, mit ihm Kontakt aufzunehmen. Durch sie waren wir von der äußeren Welt nicht ganz abgeschnitten und wussten, was um uns herum passierte. Am wichtigsten war uns natürlich die Lage im Ghetto.
In der Familie war Tante Jannina unser einziger Trost. Durch sie hörten wir alles über meine kleine Tamar, ihre Appetitlosigkeit, ihre Schlagfertigkeit und überhaupt über ihre Entwicklung. Außer für sie sorgte Tante Jannina noch für ein jüdisches Mädchen, dem sie arische Papiere besorgt hatte, und deren Schwester, die in einem Dorf lebte.
Diese beiden Mädchen waren eigentlich unsere Tanten. Das kam so: Unser Opa war sein ganzes Leben lang ein Bauer und führte ein arbeitsreiches, schweres Leben. Als seine Frau starb war er schon 74 Jahre alt. Seinen Weizen ließ er immer im Nachbarort mahlen, der Bauer dort war ein frommer Jude. Dieser hatte eine viel jüngere Frau. So jung und schön sie war, hatte sie doch einen schlechten Ruf und man sagte, ihre Kinder hätten viele Väter. Mein Opa mied sie und spuckte bei ihrem Anblick verächtlich auf den Boden. Als nun aber ihr Mann gestorben und sie eine Witwe war, fing mein Opa an, sie zu besuchen und er brachte Gemüse und Obst von ihr mit. Eines Tages erhielten wir von ihm durch Bauern aus dem Dorf eine Fuhre Kartoffeln für den ganzen Winter, Gemüse und Obst. Durch sie erfuhr mein Vater, dass der Opa in seinem Alter diese Frau geheiratet hatte. Das brachte meinen Vater in Rage und er wollte von Opa gar nichts mehr annehmen. Es stellte sich aber heraus, dass die Witwe all ihre Kinder gut untergebracht hatte. Mit 45 Jahren heiratete sie unseren Opa und bekam noch zwei Kinder mit ihm, zwei Mädchen. Das eine hieß Sara Guta, das andere Meitke Guta. Das Verhältnis zum Opa wurde wieder besser. Er bat auch meine Mutter, sich der Mädchen etwas anzunehmen, damit sie keine Gojim würden und damit sie etwas lernten. Zumindest Lesen und Schreiben sollte man ihnen beibringen. Er bat sie so lange, die Kinder zu sich zu nehmen, bis sie einwilligte. Meinem Vater war das gar nicht recht, da er immer noch über den Opa verärgert war. Aber eines Tages kam ein Bauer und brachte uns die beiden blonden Mädchen. Mutter sagte: »Kinder, seid doch nett zu ihnen, es sind doch eigentlich eure Tanten.«
Sie hatten sogar eine gewissen Ähnlichkeit mit uns. Doch sie standen in der Ecke und waren ziemlich verstört. Meine Schwester Mizia umarmte sie gleich und gab ihnen auch von unseren Spielsachen ab. Sie waren beide sehr schüchtern und sprachen nur untereinander. Vor uns hatten sie Angst und blieben am liebsten in der Küche. Dort unterhielten sie sich mit den Dienstboten. Mutter bestellte für sie Privatlehrer, um sie für die Schule vorzubereiten, aber sie wollten gar nichts lernen, wir fanden sie richtig »vernagelt«. Wir Kinder versuchten ihnen beizubringen, dass sie lernen sollten und wollten mit ihnen diskutieren. Doch es half alles nichts. Mutter gab sie dann zu einer kinderlosen Familie, die sie betreute – gegen Zahlung natürlich. Als sie 12 und 13 Jahre alt waren und immer noch nicht lernen wollten, beschloss meine Mutter, dass sie einen Beruf erlernen sollten. Wir Kinder sahen sie jetzt nur noch gelegentlich am Sonntag und hatten keinen vertraulichen Ton mehr mit ihnen, schließlich waren wir ja auch erwachsener geworden.
Als mein Opa 84 Jahre alt geworden war, erkrankte er – zum ersten Mal in seinem Leben. Der Arzt sagte, das Leben im Dorf sei zu schwer für ihn geworden. Also kam er zu uns. Vater hat ihm verziehen und er blieb bei uns wohnen. Zwischen ihm und dem Personal kam es wegen der jüdischen Speisegesetze öfter zu Unstimmigkeiten. Von meiner Mutter bekam er jede Woche Geld, aber das trug er immer sofort auf die Bank, als Aussteuer für seine Töchter. Sie besuchten ihn regelmäßig an jedem Schabbat3. Da sie ja Tante Janninas Stiefschwestern waren, besorgte diese ihnen arische Papiere. Eine von ihnen beschäftigte sie als Dienstmädchen bei sich, die andere wurde im Dorf auf ihre Kosten untergebracht.
Das Dienstmädchen hieß Helene (Halinka), sie war immer sehr gut zu unserer Tochter in der Zeit, als diese bei Tante Jannina untergebracht war. Sie hat den Krieg überlebt und lebt jetzt in Schaulen und wir sind noch immer mit ihr in brieflicher Verbindung. Die andere Schwester haben wir nach dem Krieg nicht mehr gesehen.
Unser Opa ist mit 90 Jahren gestorben. Bis zu seinem Tod brauchte er keine Brille und hat auch nie einen Stock benutzt. Bis zuletzt hatte er seine eigenen Zähne. Er trug allerdings eine Brille, jedoch ohne Gläser. Wenn man ihn fragte warum, so antwortete er: »Um meine Augen zu schützen.« Wenn die Leute herausbekämen, dass er noch sein gutes Sehvermögen habe, so dachte er, würden sie ihm Böses wünschen und das könnte schlecht für ihn ausgehen. Er vergötterte unsere Mutter und ist mit ihrem Namen auf den Lippen gestorben.
Nun wende ich mich wieder unserem Leben im Kloster zu. Jeden Tag erreichten uns neue schlechte Nachrichten. Es hieß, die Klöster würden durchsucht. Die Bauern wurden daran gehindert, ihre Lebensmittel ins Kloster zu bringen, sie wurden durchsucht und ihre Waren wurden ihnen abgenommen. Trotzdem mussten wir nicht Hunger leiden, denn die Schwestern teilten mit uns jeden Bissen. Schwester Lucia pflegte immer optimistisch zu sagen: »Kinder, nur die Hoffnung nicht verlieren, wir werden Hitler noch überleben!«
Das Versteck im Klosterdach
Jonas und Jascha hatten inzwischen ein Versteck für uns gefunden. Es befand sich unter dem Dach des Klosters. Mit Holzlatten verbauten sie die Dachkante, so dass ein Hohlraum entstand, in dem wir uns wohl verstecken konnten. Tag und Nacht arbeiteten sie daran und trugen auch schon einen Teil unserer Sachen hinauf. Von außen war nichts zu erkennen und vor den inneren Eingang hatten sie ein Fass Wein gestellt, über das man hinwegklettern musste. Der Eingang war eine versteckte Klappe in der Decke, die den Fußboden unseres Verstecks bildete. Von unten konnte man diese Klappe nicht sehen; sie wurde von unten geöffnet und von oben verschlossen. Zwei Wochen haben sie daran gearbeitet. Außer uns und den vier Nonnen wusste niemand davon.
Es war schon Ende März, eine Woche vor dem Passah-Fest3. Plötzlich hörten wir Bomben explodieren – Wilna wurde bombardiert. Größere Putzteile flogen von den Wänden, die Gefahr war groß. Wir durften nicht mit den Nonnen in den Bunker flüchten, damit sie unsere Gegenwart nicht bemerkten. Die Oberin und Schwester Lucia waren noch bei uns. Wir wollten sie überreden, in den Bunker hinabzugehen, aber sie wollten uns nicht verlassen.
Читать дальше