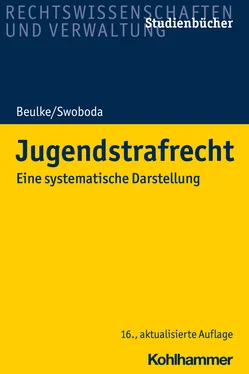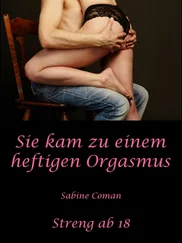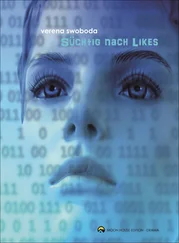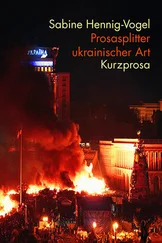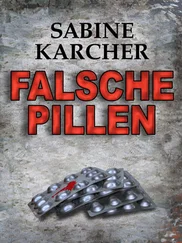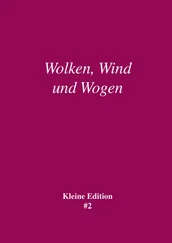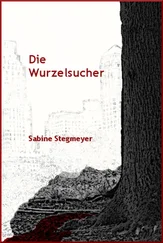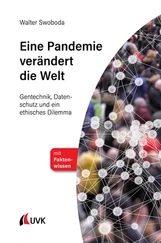71Eine besondere Form jugendlicher Gewaltkriminalität stellen seit Jahren die bis zu Mord, Brandstiftung und schwerem Landfriedensbruch gesteigerten Ausschreitungen rechts-, aber z. T. auch linksextremistischer Straftäter dar. Ab Mitte der 90er Jahre häuften sich Fälle, in denen Ausländer Opfer rechtsextremistischer Gewalt wurden. In den 90er Jahren waren an diesen Straftaten auch Jugendliche und Heranwachsende stark beteiligt, heute sind Jüngere eher bei islamistischen und linksextremen Straftaten involviert. Bei rechtsmotivierten Straftaten ist hingegen eine Altersverschiebung dahingehend zu verzeichnen, dass rechtsmotivierte Gewalt mehrheitlich von Erwachsenen begangen wird. 143Bei schweren extremistischen Straftaten junger Täter wird es nur selten eine Alternative zur Jugendstrafe geben, allein wegen des Gedankens des angemessenen Schuldausgleichs. Außerdem bedarf es einer nachhaltigen erzieherischen Einwirkung auf den jungen Straftäter im Rahmen des Strafvollzugs. Diese scheint zumindest bei jugendlichen Mitläufern extremistischer Gewaltdelinquenz Aussicht auf Erfolg zu haben. 144Auf jeden Fall aber müssen im Vorfeld etwaiger Straftaten intensive Präventionsprogramme ansetzen. 145
Andererseits muss nicht jedes missbilligenswerte Verhalten zu schweren Straftaten hochstilisiert werden; vielmehr sollte stets mit „gelassener Entschiedenheit“ reagiert werden. 146
V.Problematik der hohen Rückfallquoten
72Zu den negativen Aspekten der modernen Jugendkriminalitätsentwicklung gehört auch, dass der Anteil der vorbelasteten Täterbei den straffälligen Jugendlichen und Heranwachsenden stetig zugenommen und sich inzwischen auf einem hohen Niveau eingependelt hat. Er betrug bei den Jugendlichen 1954 noch 13,4 %, im Jahre 1965 aber 18,9 %. Bei den Heranwachsenden stieg er im gleichen Zeitraum von 22,2 % auf 26,8 %. Für 2003 besagt die Verurteiltenstatistik, dass von allen nach Jugendstrafrecht verurteilten Jugendlichen und Heranwachsenden 43,5 % bereits mindestens eine frühere Verurteilung aufwiesen. 147Im Jahr 2018 waren sogar 37,6 % der nach Jugendstrafrecht Verurteilten mit mindestens einer Vorverurteilung belastet. Die Prozentsätze der Vorbelasteten liegen dabei bei den Raubdelikten und einzelnen Diebstahlsqualifikationen wie z. B. dem Wohnungseinbruchsdiebstahl oder dem Bandendiebstahl besonders hoch. Etwa 47,1 % der wegen eines Raubdelikts Verurteilten waren vorbestraft, beim räuberischen Diebstahl sogar 48,7 % und beim schweren Raub 55,1 %. Beim einfachen Bandendiebstahl waren 34,6 % der nach Jugendstrafrecht Verurteilten bereits zuvor mindestens einmal wegen einer anderen Straftat verurteilt worden, beim schweren Bandendiebstahl sogar 46,3 %. Von den wegen Wohnungseinbruchsdiebstahls und Privatwohnungseinbruchsdiebstahls (§ 244 I Nr. 3, IV StGB) nach Jugendstrafrecht Verurteilten waren 45,5 % bereits vorbestraft.
VI.Untersuchungen zur legalpräventiven Wirksamkeit des Jugendstrafrechts
73Zahlreiche kriminologische Untersuchungen haben sich mit der Überprüfung der Wirksamkeit des Jugendstrafrechtsim Hinblick auf eine Rückfallvermeidung befasst. 148Noch aber ist die Forschung auf diesem wichtigen Gebiet noch nicht ausgereift und damit auch noch nicht zu für die Kriminalpolitik bedenkenlos verwertbaren Ergebnissen gelangt. Die in den folgenden Kapiteln dieses Buches enthaltenen Zahlen der Bewährungsstatistik bei einzelnen Sanktionen (dazu Rn. 379, 438, 483 ff.) sind daher mit Vorsicht und erheblichen Vorbehalten aufzunehmen. Zum einen liegt ein Teil der dort vorgestellten Untersuchungen bereits längere Zeit zurück, zum anderen konzentrieren sich die Rückfalluntersuchungen ganz überwiegend auf freiheitsentziehende Sanktionen, insbesondere Jugendstrafe und Jugendarrest. Vergleichbare Ergebnisuntersuchungen über ambulante Sanktionen (z. B. Erziehungsmaßnahmen, Geldauflagen, Arbeitsauflagen, Betreuungsweisungen) sind kaum zu bekommen, so dass auch statistisch abgesicherte Aussagen darüber, ob den einen oder den anderen Sanktionen ceteris paribus ein größerer Erfolg beschieden ist, nicht möglich sind. Darüber hinaus werden die Begriffe von „Erfolg“ und „Rückfall“ in diesen Studien unterschiedlich interpretiert. Ein Teil der Untersuchungen wertet jede neue registrierte Straftat als Rückfall, während der andere Teil nur neue Straftaten und Sanktionen von einigem Gewicht als echten Rückfall ansieht. So wird man nur mit größter Zurückhaltung zu einer Art „Stufenleiter“ des Erfolgs bzw. Misserfolgs der Maßnahmen gelangen, die sich aus empirischen Untersuchungen ergibt (Tabelle 5).
Tabelle 5:Legalbewährung nach jugendstrafrechtlichen Sanktionen 149
| Verhängte Sanktionen und Maßnahmen |
Rückfallquote in % |
|
|
2004–2007 (3 Jahre) |
2004–2010 (6 Jahre) |
2010–2013 (3 Jahre) |
| Einstellungen gem. §§ 45, 47 JGG |
38,0 |
46,0 |
34,4 |
| Sonstige jugendrichterliche Maßnahme nach JGG |
54,0 |
63,0 |
52,1 |
| Jugendstrafe ohne Bewährung |
70,0 |
81,0 |
64,5 |
| Jugendstrafe mit Bewährung |
64,0 |
75,0 |
61,4 |
| Jugendarrest |
67,0 |
76,0 |
63,7 |
74Vergleicht man die mitgeteilten Ergebnisse mit parallelen Studien, gelangt man zwar zu einer großen Schwankungsbreite, der „Aufwärtstrend“ der Rückfallquote mit steigender Intensität der Maßnahme bleibt jedoch erhalten. Eine besonders harte Sanktionierung bietet also keine Gewähr für einen größeren Erfolg. Im Einzelfall wird vielmehr die Wahl des milderen Reaktionsmittels möglich sein, ohne dass sich damit die Rückfallwahrscheinlichkeit erhöht. Das Jugendstrafrecht leitet aus dieser durchaus nicht neuen Erkenntnis die besondere Bedeutung des Subsidiaritätsprinzips ab (dazu näher unter Rn. 723). Der Jugendrichter soll nur dann zu der nächstschwereren Sanktionsform greifen, wenn er sie für unverzichtbar hält. Insbesondere ist nie bestritten worden und wird von der Praxis auch beachtet, dass die Jugendstrafe wirklich nur als ultima ratio unter den Rechtsfolgen erheblicher Jugendstraftaten eingesetzt werden darf (s. unten Rn. 440). Daraus kann jedoch nicht der Schluss gezogen werden, dass die empirischen Forschungsergebnisse den Jugendrichter dazu zwängen , die jeweils mildere Sanktion zu wählen. 150Die aus der Rückfallstatistik abgeleitete Erkenntnis, dass sich mit steigender Sanktionsschwere die zukünftige Legalbewährung eines Täters nicht verbessert, ist nur einer von mehreren Gesichtspunkten, der in die richterliche Sanktionsfindung einfließt. Für den konkreten Fall ist er unter Umständen nicht einschlägig oder wird durch andere Erwägungen überlagert. Auch ist zu bedenken, dass eine schlechtere Bewährung der schwerer sanktionierten Probanden schon deshalb erwartungskonform ist, weil der Richter eine Vorselektion vornimmt und bei günstigerer Prognose gerade mildere Reaktionen bevorzugt. Probanden aus dem Jugendarrestvollzug und in noch viel stärkerem Maße Probanden aus dem Jugendstrafvollzug stellen zumeist eine negative Auslese unter den jugendlichen und heranwachsenden Straftätern dar. Regelmäßig sind sie im Zeitpunkt ihrer Verurteilung auch bereits mehrfach auffällig geworden. Bei ihnen kann es deshalb nicht verwundern, dass ihre Rückfallquote besonders hoch ist. Mit der Behauptung, die Ergebnisse der wissenschaftlichen Rückfallforschung belegten eindeutig die zumindest gleich große Wirksamkeit des „leichteren“ Eingriffs, werden alle anderen Kausalfaktoren in unzulänglicher Weise ausgeklammert, obwohl menschliches Verhalten auf einer unendlichen Fülle von lebensbestimmenden Einflüssen basiert. Niemand garantiert Strafverfolgungsorganen, dass dieser Jugendliche auch im konkreten Fall sich ebenfalls zumindest gleich gut bewähren wird, wenn auf intensivere Maßnahmen verzichtet wird. Mittlerweile haben auch erste Untersuchungen die Vermutung einer größeren Legalbewährungschance bei Ausweitung informeller Sanktionen sehr eindrucksvoll widerlegt. Bareinske 151z. B. nutzt die in der Freiburger Kohortenstudie gewonnenen Daten, um in einer regional begrenzten Vergleichsstudie den Effekt der Ausweitung informeller Sanktionen auf die Gesamtlegalbewährungsrate zu untersuchen. Die Wahrscheinlichkeit einer erneuten Straffälligkeit sinkt seinen Ergebnissen zufolge auch dann kaum, wenn vermehrt informelle Sanktionen verhängt werden. Allerdings gilt dann weiterhin gemäß dem Gebot der Verhältnismäßigkeit, dass bei leichter Jugendkriminalität bei zu erwartender gleicher Präventionswirkung der informellen Erledigung der Vorzug zu geben ist.
Читать дальше