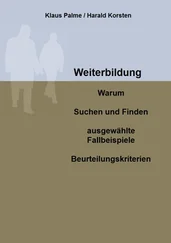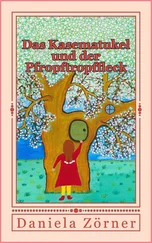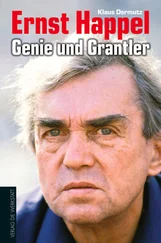In der ambivalenten Stellung, die Arnold den Leidenschaften zuschreibt, wird der Widerspruch in der Struktur der bürgerlichen Gesellschaft deutlich. Auf der einen – der wirtschaftenden – Seite ist die Intensität der Leidenschaften Indikator für Unternehmergeist, Gewinnstreben, Mut zum Risiko, Reichtum und Luxus und damit für die Größe und Freiheit der Nation; hier werden die Leidenschaften zudem durch eine »gesunde Philosophie« und durchs Christentum legitimiert. Auf der anderen – der privatinnerlichen – Seite ist die Zeche dafür zu zahlen; hier tragen die Leidenschaften, die Bedürfnisse, nicht nur viel stärker das Risiko des Wahnsinns in sich, sondern hier figurieren sie immer schon als Anlaß, zur Moralisierung des menschlichen Verhaltens aufzufordern, hier geht es um das Verbot der Extreme, um das Einhalten der moralischen Norm, um die Wahrheit, die in der Mitte, im Durchschnitt liegt. Abweichendes Verhalten – ob als Narr und Sonderling oder als Genie – ist gleichsam mit der Strafe der Erkrankung, des Wahnsinns, der »medical insanity« bedroht. Da aber die Disposition zu den verschiedenen moralischen Abweichungen allgemein ist, stellt gerade das Konzept der »moral insanity« – im Gegensatz zur »medical insanity« und nur graduell von dieser zu unterscheiden – eine universale Bedrohung dar, der sich kein Glied der Gesellschaft entziehen kann. Dies sei exemplifiziert an der »appetitive insanity«: Es leidet derjenige an ihr, der unbedingt einem Bedürfnis Genüge tun will, auch wo das den Umständen nach nicht adäquat ist; »sie befällt insgemein solche, die im ledigen Stand, und unter dem äußeren Zwang einer erkünstelten Bescheidenheit geilen Gedanken verliebter Sehnsucht nachhingen, da doch Gesetze, Gewohnheit und Religion sie davon hätten abhalten sollen«, also die, »die eine heimliche, verbotene Flamme in sich ernährten«. 83
1809 ließ Arnold einen 3. Band folgen: Observations on the Management of the Insane , Ergebnis einer 42jährigen Erfahrung der Irrenbehandlung, wobei der Unterschied in der Heilungsquote zwischen seinem Privathaus und der öffentlichen Anstalt sich wie 3:2 zu 2:1 verhielt. Die soziale Differenz, die sich hierin ausdrückt, wird noch deutlicher, wenn Arnold einerseits für Humanität und »mild and indulgent treatment« plädiert, andererseits aber offen bekennt: »Chains should never be used but in the case of poor patients, whose pecuniary circumstances will not admit of such attendance as is necessary to procure safety without them.« 84
c) Funktionalisierung der Hysterie
Es ist die Entwicklung nachzutragen, die die Bedeutung von Hysterie bzw. Spleen seit 1750 genommen hat, d. h. derjenigen minder schweren Nervenstörungen, die schon vor dieser Zeit Bürgerrecht erlangt hatten. 1746 erschien von John Andrée das erste Buch speziell über Epilepsie; als Gründer und Arzt des »London Infirmary« hatte er erstmals Gelegenheit, über diese Kankheit ausgedehnte Erfahrungen zu sammeln. Auch auf diesem Gebiet bedingte also eine praktische Einrichtung die ersten wissenschaftlichen Fortschritte. Jedenfalls führte das dazu, daß man Hysterie deutlicher von der schwereren und eher organisch anmutenden Epilepsie abzuheben verstand, wenngleich diese Differenzierung letztlich noch über 100 Jahre in Anspruch nehmen sollte. Weiter erschien 1796 G. B. Morgagnis, des größten Anatomen seiner Zeit, Werk über die Befunde von über 700 Sektionen. Es machte klar, daß man sich bei Annahmen über die körperliche Fundierung der Krankheiten des Geistes und der Nerven kritisch zurückzuhalten hatte.
Wichtiger noch ist eine Spaltung der medizinischen Vorstellungen, die gerade um die Jahrhundertmitte hervortritt. Die Spirits repräsentierten noch eine nahezu metaphysische Einheit der körperlichen und nichtkörperlichen, der äußeren und inneren Phänomene. Sie werden jetzt allmählich ersetzt durch Modelle der Nerventätigkeit, die – im Verein mit den Fortschritten physiologischer Experimente – stärker an der Physik orientiert sind: an der Bewegung fester und flüssiger Materie, an Tonus und Spannung/Erschlaffung elastischer Fasern, an der Vibration gespannter Saiten. Auf der einen Seite werden so die Voraussetzungen dafür geschaffen, daß die medizinischen Fächer zu einer einheitlichen Wissenschaft von den Gesetzen des menschlichen Körpers und seiner Störungen werden. Auf der anderen Seite entwickelt sich an denselben physikalischen Begriffen eine – von ihrer Funktion der Erklärung körperlicher Vorgänge sich abhebende – bildhaft – symbolische Bedeutung. Die »Natur« des Menschen wird doppeldeutig, zerfällt in eine innere und äußere. Die »innere Sicht«, die Sydenham noch für die somatisch-psychosozialen Spirits behauptete, löst sich von der Körpersphäre, deren Funktionen nun einer äußeren Erklärung verbleiben, und wird zunehmend zu einer – psychologischen – Betrachtung mit unmittelbarem und subjektivem Wahrheitsgehalt. Für »Seele«, »Empfindung«, »Sympathie«, »Sensus communis«, »Leidenschaft« gilt das Äußerlich-Sichtbare nur noch als Mittel oder als Analogie, um das Innerlich-Unsichtbare erkennen zu können. Auch der Begriff der »Konstitution« wird zu einem Instrument, mit dem man anhand äußerer Zeichen psychisch-innere Dispositionen ablesen kann. Wie sehr die Leidenschaften ihr Kriterium an moralischen Normen statt an Naturgesetzen finden, war bei Arnold das Thema. Wie sehr z. B. das Modell der Elektrizität Vorstellungen über das Innere des Menschen und auch diesbezüglichen praktischen Absichten dienlich sein kann, deuteten wir bei Wesley an. Wie die an physiologischen Experimenten geprägten Begriffe der Sensibilität und Irritabilität Hallers ärztlichen und weltanschaulichen Bedürfnissen zuliebe verändert wurden, war im Extrem an J. Brown zu sehen. Zugleich bilden all diese begrifflichen Verinnerlichungen eine Vorlage der literarischen Romantik in England.
In dieser Bewegung steht Robert Whytt (1714-1766), der den Ruf der schottischen Medizin als Vorgänger Cullens begründete, der 1751 eine erste, von Spirits weitgehend befreite somatisch-neurologische Medizin schuf und der 1765 das einzige bedeutende Buch über Hysterie der 2. Jahrhunderthälfte schrieb. Als »Neurologe« entdeckte er nicht nur einige höchst wichtige Reflexe: die Pupillenreaktion auf Licht, Pupillenstarre nach Zerstörung der Vierhügelregion des Gehirns, Nies-, Würg-, Husten-, Blasenentleerungsreflex, Erektion und Ejakulation. 85Gerade gelegentlich seiner Reflex-Experimente kam er zu klareren Vorstellungen-von der Beziehung der Muskelbewegung zur Sensibilität. Insbesondere fand er in diesem Zusammenhang zu der Annahme, daß Bewegung durch einen Nervenimpuls, auch ohne Anstoß durch einen höheren Willen oder einen äußeren Reiz, in Gang gesetzt werden kann; d. h. es gibt »vital« oder »involuntary motions« ohne »express consciousness«, also ohne eine dirigierende Instanz wie die Seele. Dann gibt es auch nicht – getrennt voneinander – eine anima = »vital or sentient soul«, die wir mit den Tieren gemein haben, und einen rein menschlichen Animus = »the seat of reason and intelligence«, sondern »there seems to be in man one sentient and intelligent PRINCIPLE, which is equally the source of life, sense and motion, as of reason«. 86Es ist dieses – bei Whytt stets abstrakt bleibende – »Prinzip«, das es ihm erlaubt, die traditionelle Trennungslinie zwischen menschlich-bewußten und tierischunbewußten Funktionen durch eine andere zu ersetzen, die, wie Hunter und Macalpine meinen, eine neurophysiologische von einer psychologischen Betrachtungsweise scheidet 87, wobei beide – die eine äußerlich, die andere innerlich – die Gesamtheit der Funktionen des Menschen als einen eigengesetzlichen, gleichsam geschlossenen Kreislauf zu beschreiben in der Lage sind.
Nicht anders ist es bei Whytts Analyse der Hysterie und der Hypochondrie, die er – die eine die Frauen, die andere die Männer betreffend – als »nervous disorders« identifiziert. Ihre Ursache ist »an uncommon weakness, or a depraved or unnatural feeling, in some of the organes of the body«, wobei kennzeichnend die Vielzahl und die Entferntheit der kranken Organe voneinander sind, was nur durch eine gesteigerte Beweglichkeit der körperlichen Beziehungen (besonders der Frau eigen, die daher häufiger erkrankt) zu erklären ist, d. h. durch übergroße »sympathy«, »consensus«. Letztere existieren in den Organen, sind aber zugleich eine Form der Sensibilität und werden durch das Nervensystem vermittelt. Die andere Ursache der »nervous disorders« ist daher »a too great delicacy and sensibility of the whole nervous system«. 88Diese Eigenschaften des Nervensystems sind zugleich psychische, ja moralische Kategorien, und Foucault bemerkt mit Recht: »From now on one fell ill from too much feeling; one suffered from an excessive solidarity with all the beings around one. One was no longer compelled by one’s secret nature; one was the victim of everything which, on the surface of the world, solicited the body and the soul. And as a result, one was both more innocent and more guilty.« 89Denn einerseits werden die Kranken durch die nervliche Irritation, durch ihre schwache und delikate Konstitution in körperliche und unbewußte Reaktionen, ja bis zur Bewußtlosigkeit getrieben. Andererseits kann die Krankheit in einem viel tieferen Sinne als natürliche Strafe für eine Schuld angesehen werden, gerade weil die Ratio nicht mehr eine unabhängige Instanz ist, deren Irrtum einzusehen und zu korrigieren ist. Wo das Ausmaß des Gefühls die Kapazität der Nervenirritation übersteigt, wird der bloße Irrtum zum moralischen Fehler, kann die private Lebensführung in ihrer Gesamtheit zur Sünde an der Natur werden, die hier als bürgerliche Norm der Natürlichkeit erscheint 90und gleichzeitig als körperliche Natur und als Bereitschaft zu abnormer Reaktion zur Instanz moralischer Strafandrohung wird. In ein derartiges säkularisiert-bürgerliches Schuld-Strafe-Verhältnis, das im Dienst einer sich selbst regulierenden Sozialordnung steht, können alle Bedürfnis-Ansprüche, Leidenschaften und Vorstellungen eintreten, besonders aber jeder Mißbrauch, alles »Unnatürlich«-Extreme: das Leben der Städter, Romanlektüre, Theaterbesuch, Diätfehler, Wissensdurst, sexuelle Leidenschaft und jene Gewohnheit, die ihrer Kriminalität wegen nur in Umschreibungen ausgesprochen wurde: die Onanie. Es versteht sich, daß gegenüber der »moral insanity« bei Arnold, die mit dem Wahnsinn droht, diese Konzeption der Hysterie eine unmittelbarere Wirkung hat, da sie schon bei dem unscheinbarsten Ansatz der Selbstbeobachtung und Selbstverständigung als ein Faszination und Zwang ausstrahlendes Interpretationsschema zur Verfügung steht.
Читать дальше