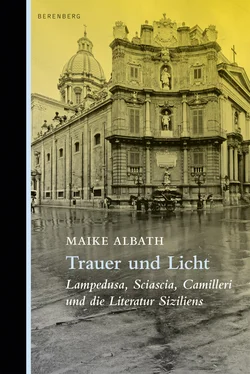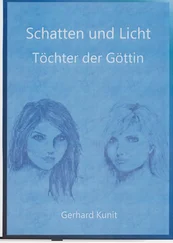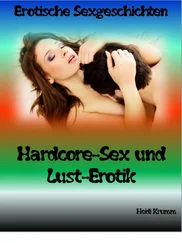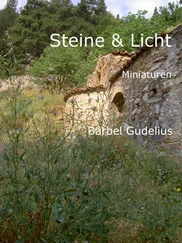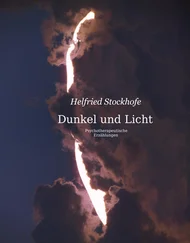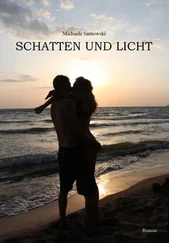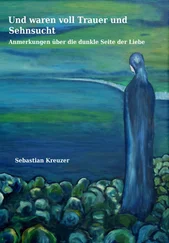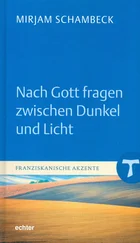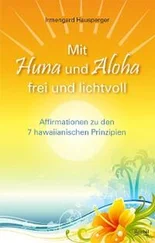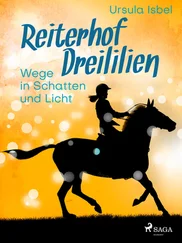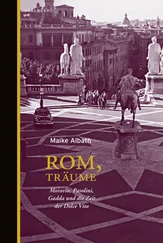Maike Albath - Trauer und Licht
Здесь есть возможность читать онлайн «Maike Albath - Trauer und Licht» — ознакомительный отрывок электронной книги совершенно бесплатно, а после прочтения отрывка купить полную версию. В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: unrecognised, на немецком языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:Trauer und Licht
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:4 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 80
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Trauer und Licht: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Trauer und Licht»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
Trauer und Licht — читать онлайн ознакомительный отрывок
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Trauer und Licht», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
Bis 1943 schlief er in dem Zimmer, in dem er am 23. Dezember 1896 geboren worden war, nur vier Meter entfernt von dem Bett, in dem seine Mutter in den Wehen gelegen hatte. Dass Tomasi in seinen Kindheitserinnerungen ausgerechnet über sein Schlafzimmer eine Verbindung zu seiner Mutter herstellt, ist verräterisch und deutet schon auf das besondere Verhältnis zwischen ihm und der für ihre Attraktivität berühmten Beatrice hin. »An keinem Ort der Erde, dessen bin ich sicher, hat sich der Himmel je in einem so wilden Blau ausgebreitet wie über unserer eingefriedeten Terrasse, niemals hat die Sonne ein weicheres Licht geworfen als das, welches durch die halb geschlossenen Fensterläden des Grünen Salons drang«, beschrieb Giuseppe Tomasi seine Eindrücke. Auch das Boudoir der Mutter hat sich ihm tief eingeprägt. »Seine Mutter Beatrice hat ihn vergöttert«, erzählt mir sein Adoptivsohn Gioacchino, während ich neben den großflächigen Gemälden flämischer Meister eine Bleistiftzeichnung von Picasso entdecke: Sie zeigt Lanzas flamboyante Großmutter und ist in Biarritz entstanden. Wir schlendern weiter durch die Zimmerfluchten.
»Giuseppe Tomasi war erst ein paar Tage alt, als seine Schwester Stefania mit drei Jahren an Diphtherie starb. Seine Mutter redete ihn von da an oft mit weiblichen Kosenamen an und verwendete feminine Pronomen. Die Geburt eines Sohnes, also eines Stammhalters, war für eine adlige Familie von enormer Bedeutung. Beatrice hatte damit ihre Hauptaufgabe erledigt. Giuseppe wurde unfassbar verwöhnt«, erklärt Gioacchino. Um ihn herum wimmelte es von willfährigen Hausangestellten und Verwandten. Sein Vater war eher harsch und streitbar, was Beatrice noch enger an ihren Sohn band. Das Kind wurde in weiße Kleidchen gesteckt, gehegt und gepflegt, geherzt und gefüttert. Auf einem Foto von 1898 steht er mit Puffärmeln, weißen Söckchen und rosettengeschmückten Schühchen an einen Rokokotisch gelehnt, im Arm eine Holzpuppe, und schaut etwas verdutzt in die Kamera. Als Sechsjähriger wird er dann doch eher wie ein Junge zurechtgemacht: Stirn an Stirn mit seiner Mutter, die ein tief dekolletiertes Kleid trägt, posiert er für den Fotografen. Beatrice Mastrogiovanni Tasca Filangeri di Cutò, genannt Bice, erregte mit ihrer Garderobe immer wieder Aufsehen: viel zu freizügig für ihre bigotten Großtanten, die den größten Teil des Tages mit Rosenkränzen verbrachten. Außerdem fuhr sie Fahrrad, ein Skandal! Giuseppes Mutter war nicht nur modebewusst, sondern auch klug und belesen. Sie kam aus einer aufgeschlossenen Familie mit normannischen Vorfahren, was in der Erziehung etwas galt; gemeinsam mit ihren Schwestern hatte sie hervorragende Hauslehrer gehabt. Als 1958 der Leopard erschien, kursierten sogar Gerüchte, sie sei die tatsächliche Urheberin des Romans.
Staubkörner tanzen im Licht, als wir den Ballsaal betreten. Die Ausmaße sind enorm. Um 1900 riss Palermo mit seinen mondänen Gepflogenheiten und dem milden Winterklima die europäischen Adligen in einen Begeisterungstaumel. Manche richteten sich gleich für mehrere Monate ein. Die Einwohnerzahl war von knapp 222.000 im Jahr 1861 auf 330.000 gestiegen, und Palermo war zur fünftgrößten Stadt Italiens avanciert. Immerhin rund zwanzig Palazzi boten noch ein Gesellschaftsleben im alten Stil. Hundert Jahre zuvor hatten noch 200 Familien in der Stadt residiert, aber dem deutschen Kaiser Wilhelm II., Vittorio Emanuele von Savoyen, Eduard VII. von Großbritannien und der Zarin Alexandra reichte es zur Freizeitgestaltung, ebenso wie etlichen Königen aus Skandinavien und vom Balkan, und auch den Palermitanern selbst. Im Palazzo Butera nebenan war der Tisch sicherheitshalber immer für zwanzig Gäste gedeckt. Es gab Bälle, Empfänge, Theater und Opernaufführungen. Im Palazzo Rudinì wurde ein Kino eröffnet, das Beatrice Tomasi regelmäßig besuchte. In der Zeitschrift Torneo war von nichts anderem als adligen Familien die Rede, ihren Festen, den Diners für einen guten Zweck, den Saisoneröffnungen im Teatro Massimo und den Kleidern der Damen. Wer ging wohin und mit wem? Die Fürstin Tremoille Torremuzza veranstaltete jeden Donnerstag künstlerisch-literarische Abende, man aß im Hotel des Palmes zu Mittag, am nächsten Tag war jour fixe in einem anderen Palazzo, oft wurde bis zum Morgen getanzt. Alles, was Rang und Namen hatte, fand sich ein: die Marchese d’Avola, die Baronesse Chiaromonte Bordonaro Gardner, Signorina Trigona Bordonaro, Signorina Maria Cutò, Bianca Alliata di Pietratagliata, Emma Notarbartolo di Villarosa, die Fürstin und der Fürst Gonzaga, der Baron Raimone, der Graf di Sampieri, um nur einige zu nennen. Der ein oder andere Marineoffizier war auch dabei. Man fuhr ausschließlich Kutsche, und die Damen verließen ihre Kaleschen nie. Gingen sie einkaufen, brachte der Geschäftsinhaber alles Gewünschte zur Kutsche, wo es dann begutachtet wurde, geprüft und betastet. Eventuell ließ man es sich nach Hause schicken. Anschließend aß man Eis, und auch da blieben die Fürstinnen in der Kutsche sitzen. Auf dem Bürgersteig an einem Tisch – undenkbar, das war etwas für Dienstmädchen.
Auf die Besucher aus dem Ausland muss Palermo trotz vieler Neubauten liebenswert altmodisch und gemächlich gewirkt haben, denn von industrieller Revolution war hier wenig zu spüren. Zwar hatten sich im 19. Jahrhundert einige Unternehmerfamilien etabliert, der erfolgreichste war Vincenzo Florio. Meistens aber erkannten nur die Zugezogenen das geschäftliche Potenzial der Gegend. So gut man sich hier auf die Etikette verstand, Geldverdienen galt als unfein, auch für die Tomasis. Zuerst waren es die Engländer gewesen, die eher zufällig eine folgenreiche Entdeckung machten und den Marsala erfanden. Der Geschäftsmann Joseph Woodhouse hatte 1773 einer Ladung Wein, die aus Marsala nach Großbritannien unterwegs war, zu Konservierungszwecken für die einmonatige Verschiffung reinen Alkohol hinzugefügt: zwei Liter pro hundert Liter. Das aromatische Getränk fand reißenden Absatz, und zehn Jahre später hatte Woodhouse die Herstellung professionalisiert, sich in Spanien und Portugal über die Reifung belehren lassen und etliche Bauern unter Vertrag, die nun statt Oliven und Weizen Wein anpflanzten. Außerdem baute er in Marsala einen langen Schiffskai und pflasterte die Straße. Vor allem die großen Bestellungen von Admiral Nelson verliehen Woodhouse Reputation, aber bald lief ihm ein anderer Engländer den Rang ab. Benjamin Ingham wurde zum großen Marsala-Magnaten, etablierte Handelsbeziehungen mit den USA, schlug auch Zitrusfrüchte um. Sein Neffe Joseph Whitaker setzte die Dynastie fort.
Vincenzo Florio hatte in der Via Materassai die florierende Drogerie seines Vaters übernommen, war dann mit Ingham ebenfalls in den Marsala-Vertrieb eingestiegen und hatte später mit dem Partner ein Unternehmen für Schwefelhandel gegründet. Hinzu kamen Tuchmachereien, eine Gießerei und eine Thunfischfabrik, in der neue Konservierungsmethoden in Öl erprobt wurden. Florio war seiner Zeit weit voraus. Er verband kaufmännisches Geschick mit Risikobereitschaft und einem Gespür für neue Geschäftsfelder und hatte damit in Sizilien nur wenig Konkurrenz. Die nationale Einigung ließ seinen Einfluss noch steigen, 1864 wurde er zum Senator ernannt. Die Familie besaß eine Handelsflotte mit 99 Schiffen und bot auch Personenverkehr an. 1880 weihte der Sohn Ignazio Florio (1838–1891), ebenfalls Senator, den hochmodernen Ozeandampfer Vincenzo Florio ein, der – ohne jede staatliche Subvention – eine direkte Verbindung nach New York ermöglichte. Es waren die Jahre, in denen Sizilien wegen der mangelnden wirtschaftlichen Entwicklung in den ländlichen Gebieten von großen Auswanderungswellen erfasst wurde. Zwischen 1896 und 1900 verließen bei einer Einwohnerschaft von knapp dreieinhalb Millionen 107.000 Personen die Insel. Zwischen 1906 und 1910 steigerte sich die Anzahl auf 442.007 Emigranten. Die Bevölkerung wuchs bis 1911 auf über 3,8 Millionen an, die Armut nahm zu, da auch unter der gesamtitalienischen Regierung immer noch keine umfassende Bodenreform in Angriff genommen worden war. Dafür wurden die Unternehmer immer reicher. Der Umsatz mit den Schiffspassagen war enorm, aber auch in anderen Sparten knüpfte Ignazio Florio an den Erfolg seines Vaters an; das junge Italien brauchte Investoren. Eine Textilfabrik hatte er zu einem Musterunternehmen ausgebaut, mit Wohnungen für die 180 Arbeiterinnen, einem Kindergarten, Gratis-Abendschulen und einer Kreditanstalt. Ausgerechnet diese fortschrittliche Einrichtung musste er wegen der billigen Baumwolle aus Übersee 1878 wieder schließen. Sonst aber prosperierte das Florio-Imperium: die Marsala-Produktion, Schwefel, Thunfischfang – Ignazio hatte kurzerhand die ägadischen Inseln gekauft –, Fischkonservenfabriken, eine Porzellanfabrik kamen noch hinzu. Über sechstausend Arbeiter und Angestellte waren bei der Familie beschäftigt; Palermo wurde mitunter »Floriopoli« genannt. Um 1900 gehörten die Florios zu den wohlhabendsten Familien Italiens, ihr Reichtum war märchenhaft und wurde regelmäßig in den Gesellschaftsblättern Revue des Deux Mondes und Sicile Illustrée dokumentiert. Sie reisten in Begleitung von Personal und vielen Freunden wie den Tomasis in einem eigenen Eisenbahnwaggon, der wie eine Wohnung eingerichtet war, fuhren nach Wien, Sankt Moritz, Chamonix, Warschau und Sankt Petersburg, dann nach London, Madrid, Berlin, Budapest und immer wieder nach Paris, wo sie selbstverständlich ebenfalls ein großes Haus besaßen. Für Ignazio Florio junior war es ein Leichtes, das von seinem Großvater und Vater angehäufte Vermögen durchzubringen. Dies war die Atmosphäre, die Giuseppe Tomasi als Kind prägte.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «Trauer und Licht»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Trauer und Licht» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «Trauer und Licht» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.