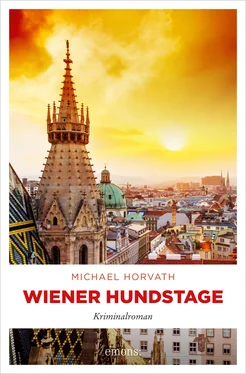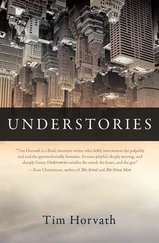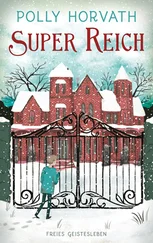Da ich Horst Fiedler von der »Donauwelle« erst in einer halben Stunde erwartete, knöpfte ich mir die Artikel über Bischof Konrad Immermann vor. Ich bestellte Tonic und sautierte Salbeileber im Basmatireisring, die sich als das entpuppte, was ich Hühnerleber mit Reis nennen würde und ganz passabel schmeckte, solange man sich nicht durch den Preis den Appetit verderben ließ.
Beim Essen las ich. Das mag ungehörig sein, spart aber Zeit. Frank hatte recht gehabt. Die Medien ließen kein gutes Haar auf dem ohnehin nur spärlich bewachsenen bischöflichen Haupt. Die Blätter waren voll mit bissigen Beschreibungen Immermanns und noch bissigeren Kommentaren zu seinen Vorstellungen; selbst aus dem konservativen Lager kam hin und wieder gedämpfte Kritik. Das war nicht weiter verwunderlich, schien es doch Immermanns erklärtes Ziel zu sein, das Zweite Vatikanum zu annullieren. Was ihm offensichtlich vorschwebte, war eine Rückkehr ins Goldene Zeitalter, als die Kirche noch eintausend Jahre jung und die Erde eine Scheibe war. Frauen als Ministranten? So weit kommt’s noch! Priesterehen? Da sei GOtt davor. Nein; das war schon ein Kirchenmann der guten alten Schule Anno Domini fünfzehnhundert, ganz knapp, bevor dieser ketzerische Wittenberger Trunkenbold seine häretischen Thesen an die Kirchentür nagelte.
Allerdings ging seinem heilsamen Wirken gänzlich die Naivität seines Chefs Heinrich Grunert ab, der mit feinsinnigen Exzerpten über den geografischen Standort der Hölle, eindringlichen Beschreibungen der vielen Ränke, die Satan beim Verführen Minderjähriger zum sündhaften Lebenswandel ins Spiel bringt, Wallfahrten, Bittprozessionen und Marienbeschwörungen seinen lebenslangen Kreuzzug gegen den Gottseibeiuns führte – Immermanns Stärke lag in einem anderen, kriegerischen, wenn auch durchaus intellektuellen Bereich. Dieser frohe Botschafter war so etwas wie Grunerts schwere Reiterei, ein eherner Kürassier des HErrn, dessen sprichwörtliche Streitlust öffentliche Provokationen sonder Zahl verursachte, die, wie böse Zungen behaupteten, vor allem dazu dienten, ihn in die Medien zu bringen. Er war der anerkannte Großmeister im Wortklauben, Haarspalten, Niederwalzen und Weghören, wenn’s unbequem wurde; und wenn er erst seine segensreiche Trickkiste auspackte, um Weiß in Schwarz zu verkehren und vice versa, dann kam man aus dem Staunen gar nicht mehr heraus.
Seine letzte Entgleisung hatte ihn allerdings ins mediale Out gedrängt – eine historische Interpretation (um ein mildes Wort für das zu finden, was eine ehemalige Präsidentschaftskandidatin »Geschichtsklitterung« genannt hatte), der man weder kühne Originalität noch Sinn für dramaturgische Brisanz absprechen konnte. Das Kirchenvolksbegehren in einem Atemzug mit jener »Abstimmung« von 1938 zu nennen, die den Anschluss Österreichs ans Dritte Reich legalisieren sollte, war zwar aus seiner Position heraus durchaus folgerichtig und konsequent gedacht, hatte ihm aber in breitesten Kreisen den Ruf eines Antidemokraten von rechtem Schrot und Korn eingetragen. Als ob »demokratische Kirche« nicht ohnehin ein Oxymoron wäre.
Schlag ein Uhr, auf die Minute genau, stand Franjo Bregović an meinem Tisch und grinste auf mich herunter. Nachdem er seine Bestellung losgeworden war, holte er ein Päckchen Marlboro aus der Brusttasche seines grasgrünen Poloshirts und paffte genüsslich vor sich hin.
»Horst Fiedler lässt sich entschuldigen«, sagte er nach einer Weile. Seine Stimme hörte sich an, als spräche er den ersten Satz des Tages, brüchig und heiser und wie aus den Tiefen einer stillgelegten Kohlenmine hervorgeholt. »Er ist … Er hat den Abend gestern nicht so gut vertragen.«
Ich lachte und zuckte mit den Schultern. Erst beim zweiten Hinsehen bemerkte ich dunkle Schatten unter seinen Augen; von den Schnurrbartenden gingen zwei tiefe Linien weg, die aussahen, als wären sie mit dem Schnitzmesser eingekerbt und heute Morgen wieder nachgezogen worden.
Als der Kellner sein Bier brachte, sagte er »Danke« auf eine Art, die einen spüren ließ, dass er es ernst meinte. Er widmete dem Krug einen entrückten, fast ekstatischen Blick aus seinen traurigen Augen, als hielte er nach langen Jahren der Suche endlich den Heiligen Gral in Händen, und tat einen zögerlichen ersten Schluck. Sein Profil entspannte sich.
»Es hat gestern wohl noch länger gedauert«, sagte ich.
»Wie? Oh, ja«, sagte er mit ernstem Gesicht.
Ich kam zur Sache. »Ich sag es Ihnen besser gleich«, begann ich. »Das Cover für die aktuelle Ausgabe der ›Donauwelle‹ können Sie wohl vergessen. Ich war gerade in Toms Studio. Der Exekutor ist dabei, die ganze Einrichtung abtransportieren zu lassen. Ich hab versucht, mit ihm zu reden. Wollte ihn dazu bringen, dass er mich danach suchen lässt. Leider war ich noch nie besonders gut darin, mit diesen Typen umzugehen. Er ließ mich rausschmeißen.«
Wider Erwarten lachte Franjo. »Ich hätte sicher auch nicht mehr Glück gehabt«, sagte er. Plötzlich trat ein boshaftes Funkeln in seine Augen. »Und Horst Fiedler mit seinem schwarzen Kopftuch hätte die Erzengel-Luzifer-Show abgezogen und wäre gleich verhaftet worden.«
Wir lachten beide.
»Was werden Sie jetzt machen?«, fragte ich. »Kennen Sie einen anderen Grafiker?«
Er hob die breiten Schultern. »Vielleicht kennt Horst jemand. Ich habe für dieses Heft genug getan. Ihr Freund Thomas … wann wird der wieder zurück sein?«
»Sehen Sie, das ist der Punkt. Ich weiß es nicht. Ich bin mir nicht einmal sicher, ob er selbst es weiß.«
»Der Exekutor«, sagte Franjo und nickte so verständnisvoll, wie das nur einer zustande bringt, der die ganze widerliche Prozedur selbst einmal erlebt hat. Vielleicht war es diese Geste, die mich zu einem Fehler verleitete, der einen Menschen das Leben kosten sollte.
Ich sagte: »Das ist es nicht. Tom vermutet, dass ihn die Polizei im Visier hat.« Als Antwort auf Franjos fragenden Blick sagte ich: »Mordverdacht. Eine Journalistin wurde umgebracht, mit der er ein paar Wochen ein Verhältnis hatte. Zeugen haben ihn am Tatort gesehen, was er selbst nicht einmal abstreitet.«
Bregović beugte sich vor, legte die Unterarme auf den Tisch und gab Rauchzeichen von sich. Er sagte nichts, er wartete.
»Er rief mich gestern an, wollte, dass wir uns treffen. Aber er kam nicht. Seither herrscht auf seiner Seite Funkstille.«
Franjo nickte, während er bedächtig seine Zigarette ausdämpfte. »Davon habe ich gelesen«, sagte er. »Ortbauer. Sie hat die Sache mit Kardinal Grunert groß rausgebracht. Ein riesiges – heißt es Spektakel? – in den Medien.«
»Ja, das war es. Tom hat am Telefon behauptet, er hätte eine Tasche – in den Nachrichten war von einem Aktenkoffer die Rede – von ihr übernommen, kurz vor oder kurz nach ihrem Tod.«
»Denken Sie, dass er …«
»… Sarah umgebracht hat? Unsinn«, sagte ich und grinste freudlos. »Als Liebespaar waren die beiden eine Katastrophe. Aber sie blieben auch nach der Trennung in Kontakt. Und immerhin hat sie Tom so sehr vertraut, dass sie ihn um Hilfe bat. Hat ihm erzählt, sie wäre einer ganz heißen Angelegenheit auf der Spur.«
»Und jetzt versuchen Sie herauszufinden, wer es getan hat, wenn nicht Ihr Freund«, stellte er fest. »Wie wär’s mit einem Bier?«
»Dann sind wir sehr schnell wieder dort, wo wir gestern aufgehört haben.«
Ein schräges Grinsen zog sein rechtes Schnurrbartende hoch. »Wie Sie meinen. Ich wollte nicht aufdringlich wirken.«
»Ich hab nicht Nein gesagt.«
Nachdem der Ober zwei Krügel gebracht hatte, fragte Franjo: »Was war in dem Koffer?«
»Die richtige Frage. Ich weiß es nicht genau.« Ich erzählte ihm vom Grunert-Foto, von den verschwundenen Disketten und von der gelöschten Festplatte. Das Golf-Turnier amüsierte ihn, doch eine Lösung hatte er auch nicht parat. Warum auch.
Читать дальше