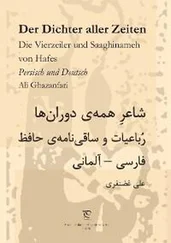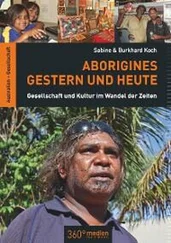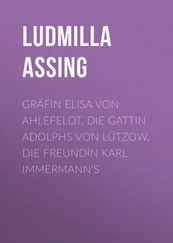Karl Adolph
Von früher und heute
Wiener Skizzen
Saga
Von früher und heute. Wiener Skizzen
© 1924 Karl Adolph
Alle Rechte der Ebookausgabe: © 2016 SAGA Egmont, an imprint of Lindhardt og Ringhof A/S Copenhagen
All rights reserved
ISBN: 9788711570029
1. Ebook-Auflage, 2016
Format: EPUB 3.0
Dieses Buch ist urheberrechtlich geschützt. Kopieren für andere als persönliche Nutzung ist nur nach Absprache mit Lindhardt und Ringhof und Autors nicht gestattet.
SAGA Egmont www.saga-books.com– a part of Egmont, www.egmont.com
Niemals kam der Vater abends um sieben Uhr heim, ohne sich erst in der Küche gründlich das von Maschinenfett und Russ geschwärzte Gesicht sowie die noch viel schwärzeren Hände zu reinigen. Nach diesem Verfahren, eines zivilisierten Europäers würdig, erschien er in dem gemieteten kleinen Kabinett, wo sich aus einem der darin befindlichen zwei Betten zwei magere Kinderarme dem Eintretenden entgegenstreckten.
Denn nichts als diese Ärmchen vermochte der Kleine zu bewegen. Die Beine waren und blieben steif für alle Ewigkeit. So hatte es eine unerbittliche Notwendigkeit der Natur angeordnet, und in dem Sinne nahmen es die Ärzte, nahm es schliesslich der Vater und ganz unbewusst der kleine Dulder selbst, der niemals im Leben (es war ja noch so kurz, kaum vierjährig) das gelernt, was man strampeln heisst. Er konnte nur in Sehnsucht seine kleinen Arme gebrauchen.
Den ganzen lieben langen Tag lag er in seinem Bette, wenn ihn nicht die um geringes Geld dazu gemietete Quartierfrau heraushob, in das Zimmer trug und auf das alte Sofa setzte, um mittlerweile im Kabinett die Betten von Vater und Kind zu „machen“.
Mein kleiner, aber trotz alledem lustiger Dulder vergnügte sein kaum vierjähriges Dasein, so gut es ging, mit seinen Spielsachen. Ach, wie sahen die aus! Da waren darunter einige Ausschneide- und Ankleidebildchen, eine Eisenbahn, die zur Weihnachtszeit (wenn ich einem gewissen Herrn Kohn glauben darf) zum Selbstkostenpreis siebzig Heller gekostet, eine zerbrochene Rechenmaschine, ein unvollständiges Zusammenlegebild, einige alte, zusammengetragene, geschenkte, zerfetzte Bilderbücher und dann Überbleibsel eines von wem immer geschenkten Ankersteinbaukastens. Zu erwähnen wäre noch ein Tennisball, ein geflickter Gummiball und eine fast unmögliche Puppe. Derart war sie nämlich an Armen und Beinen mitgenommen worden. Auch hatte sie die Perücke verloren und erwies sich als ein mit einem Kahlkopf versehenes kleines Ungetüm.
Wenn der Vater erschien, kreischte das Würmchen laut auf vor Freude über das Erscheinen seines einzigen und liebsten Freundes und breitete ihm sehnend die mageren Ärmchen entgegen.
Und dann lächelte der ernste, sonst fast niemals lächelnde Mann und beugte sich über das Bett, um sein Kind zu betasten und seinen rauhen, struppigen, von Maschinenöl duftenden Bart über dessen Gesicht zu breiten, was er küssen nannte. Und in diesem Augenblick war lallende und unbewusste, verschwiegene Religion in beider Herzen.
Das waren die Feier- und Weihestunden des Vaters. Ich vermag nicht anzugeben, wie klein das Kabinett war, wie dürftig, wie dumpfig — aber ich kann mit aller Beruhigung und Herzensfreude sagen: es waren zwei glückliche Menschen darinnen.
Es war nicht allzu lange, dass deren drei waren ... Der Vater brachte gewöhnlich das Abendessen mit oder liess es von der Quartierfrau aus dem nächsten Gasthause holen. Dazu trank er ein Glas Bier, dann machte er es sich bequem, zündete seine Pfeife an, und nun wurde es erst recht vergnügt, indem Vater und Sohn sich ansahen, der erste schweigsam, der andere in der Sprache redend, die wohl Engel sprechen müssen, einfach lallend, oft kreischend, kurz, mit der Sprache des Kindes, das weiter nichts ausdrücken kann als die ernstesten, erhabensten und reinsten Dinge, die wir später alle nicht mehr verstehen: Freude, Dankbarkeit und Liebe.
Und das war so bis zum heutigen Tage geblieben.
Aber heute hatte der Kleine, nachdem ihn sein Vater, wie gewöhnlich, lange Zeit paffend angestarrt, dessen rauhe, schwarze Hand mit seinen kleinen Händchen umfasst und die Aufforderung getan:
„Vatta, tsäl ma a Tsicht.“
Es hiess wirklich nichts anderes, als der Vater solle eine Geschichte erzählen. Der aber war über die neue Zumutung ganz starr und sah seinen Sprössling mit einer Miene an, die nur höchstes Erstaunen ausdrückte. Woher war dem Kleinen eine solche Idee angeflogen gekommen?
Darüber zerbrach sich der Ältere (bildlich genommen, denn solche Ausdrücke darf man beileibe nicht ernst nehmen) den Kopf. Aber der Junge beharrte auf seinem Verlangen.
Die Ursache dieses war, dass sich die Quartierfrau bei der Umlagerung des kleinen, plauderlustigen und neugierigen Menschenkindes zu einer Art von Erzählung eines Märchens verstiegen hatte. Und wie alles Wurzel schlägt, ob Unkraut oder gedeihliches Korn, also hatte das Märchen Wurzel geschlagen und drängte nach Ausbreitung auf dem einzigen Nährboden, den es besitzt, dem einer kleinen Kinderseele.
„Vatta, tsäl ma a Tsicht ...“
Die Mahnung war eine so dringende, dass der Vater von dem Wolkenheim des Erstaunens glatt auf dem Boden der Wirklichkeit ankam und endlich begriff, dass die Zeit des gegenseitigen väterlichen Anstarrens und kindlichen Kreischens einer anderen gewichen war: der eines geistigen Austausches.
Und plötzlich stand das Märchen hinter dem schweigsamen Manne, und seine Berührung verlieh ihm Worte. Nicht glänzende, von oratorischem Geiste getragene. Nein, so zusammengestoppelte Worte, wie sie ein einfacher Geist für einen noch einfacheren zu finden vermag.
Dabei half eine schon lang vergessene Erinnerung an eine Frau, die ihm vor vielen Jahren derlei erzählt, und diese Frau war eine Nachbarsfrau gewesen, da er selbst noch so klein, mutterlos und verlassen in seinem Bette lag wie heute sein Kind.
Also begann er:
„Es war amal a grosser Ries’ ...“
„Du, Vatta, was is a Ties’?“
„A Ries’ is so gross ...“
„Wie toss denn?“
„No, a Ries’ is halt recht gross ... So wia der Stephansturm.“
Es war eine jedenfalls äusserst glücklich gewählte Vergleichsform, da der Kleine den Stephansturm nie gesehen’ noch beschreiben gehört hatte. Aber sei es, weil er ein Wiener war — er gab sich mit der Auskunft zufrieden.
„Und was hat der Ties’ ’tan?“
„No ... der Ries’ is amal in’ Wald gangen ...“
„Vatta, was is a Ald?“
„A Wald ... ja, a Wald, das san lauter Bam’.“
„Bamm?“
„Ja, wasst, solche Bam’ wia in’ Park, wo m’r manchmal hingengan.“
„Und wia viel Bamm?“
„O je! So viel ... No ja, halt lauter Bam’. Und der Ries’ is in dem Wald an’ Zwergl begegn’t ...“
„Vatta, was is a Wergl?“
„A Zwergl? Der is so viel klan.“
„Techt tlan?“
„Recht klan. So klan ... no, so klan wia du.“
„To tlan? ... Und was hat der Wergl ’tan?“
„Ja ... der Zwergl hat den Riesen begegn’t.“
„Und was hat der Wergl und der Ties’ ’tan?“
„Dö san halt in’ Wald spaziert und san so ’gangen, immer weiter ’gangen. Do hat der Ries’ g’mant, i hab’ an’ Hunger. Schau’n m’r, dass m’r wo a Hütten finden.“
„Was is a Itten?“
„Das is a klan’s Haus. Und da san s’ zu an’ Haus ’kumma, da ha’m s’ an’klopft. Auf das schaut beim Fensta a alte Hex’ aussi und fragt: Wer is dada?“
„Vatta, was is a Ex?“
Der Erzähler blieb diesmal dem Unterbrecher eine Antwort schuldig und fuhr in seiner Erzählung voll Eifer fort:
„Der Ries’ hat g’sagt, mir san dada. Und der Zwergl hat aa g’mant: Mir san dada und ha’m an’ Hunger. Und die Hex’ hat g’sagt: Nur der Zwergl kann in mein Haus eini, denn für’n Ries’n hab’ i kan’ Platz. Und da hat der Ries’ zum murr’n ang’fanga und die Hex’ a alte Hex’ g’schimpft. Und der Zwergl is in die Hütt’n ganga, zu der Hex’, und hat den Ries’n ausg’lacht. Die Hex’ hat eahm viel zum ess’n geb’n ...“
Читать дальше