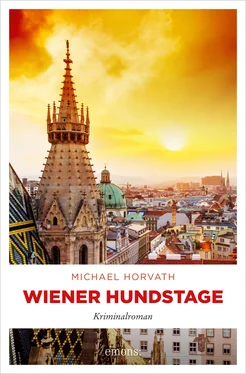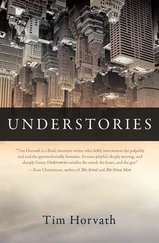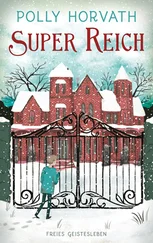Michael Horvath, 1963 in Wien geboren, war Anfang der neunziger Jahre Chefredakteur des Magazins »Buchkultur«. Neben Büchern veröffentlichte er zahlreiche Artikel, Essays und Interviews in diversen österreichischen Zeitungen und Magazinen.
Alle Figuren in diesem Roman sind selbstverständlich frei erfunden; sollten sie Züge von tatsächlich lebenden Personen tragen, so kann es sich dabei natürlich nur um reinen Zufall handeln. Das gilt auch für die Handlung, was allein schon daraus ersichtlich sein mag, dass sich in dem klar umrissenen Roman-Zeitraum vom 10.7. bis zum 16.7.1995 Dinge zutragen, die historisch zu einem anderen Zeitpunkt stattgefunden haben. Es ist dies also, noch einmal gesagt, ein reines Produkt der Phantasie. Versprochen.
Im Anhang findet sich ein Glossar.

Lust auf mehr? Laden Sie sich die »LChoice«-App runter, scannen Sie den QR-Code und bestellen Sie weitere Bücher direkt in Ihrer Buchhandlung.
© 2020 Emons Verlag GmbH
Alle Rechte vorbehalten
Umschlagmotiv: Christian Thür/photocase.de
Umschlaggestaltung: Nina Schäfer, nach einem Konzept von Leonardo Magrelli und Nina Schäfer
Umsetzung: Tobias Doetsch
Lektorat: Carlos Westerkamp
eBook-Erstellung: CPI books GmbH, Leck
ISBN 978-3-96041-649-4
Originalausgabe
Unser Newsletter informiert Sie
regelmäßig über Neues von emons:
Kostenlos bestellen unter
www.emons-verlag.de
Meinem Vater gewidmet
Wer mit Ungeheuern kämpft, mag zusehn,
dass er nicht dabei zum Ungeheuer wird.
Und wenn du lange in einen Abgrund blickst,
blickt der Abgrund auch in dich hinein.
Friedrich Nietzsche, »Jenseits von Gut und Böse«, 146
Alles begann mit einer bezahlten Rechnung. Kurz vor Mitternacht betrat ich meine Wohnung, riss die Fenster auf, um den Mief von zwei Wochen gegen heiße, abgashaltige Wiener Luft einzutauschen, und stellte fest, dass auf die viel geschmähte Post eben doch Verlass war: Mein Telefon war wieder aufgesperrt worden. In einer seltenen Anwandlung von Verantwortungsbewusstsein und Rechtschaffenheit hatte ich vor dem Urlaub alle ausständigen Rechnungen eingezahlt. Hätte ich es nicht getan, wäre die Leitung noch immer tot gewesen. Und alles wäre anders gekommen. Vielleicht.
Mit einem Glas Isle of Jura ließ ich mich auf die Couch fallen und knöpfte mir die Post vor. Der Alkohol kam an. Er kam phantastisch an. Nach zweiwöchiger Abstinenz sang jeder Schluck ein Lied. Es war eine Ballade. Eine schottische Single-Malt-Ballade. Orwell hätte diesen Whisky geliebt, wenn er getrunken hätte, und was für Orwell recht war, ist für uns billig. »Drink me«, schien er zu flüstern. Wer könnte da schon widerstehen?
Ich zog die beiden Belegexemplare des »Wiener Boten« vom letzten Montag aus dem Poststapel. Sie brachten das Interview mit dem deutschen Kirchenkritiker Karlheinz Deschner so, wie ich’s geschrieben hatte. Nichts geändert, nichts gekürzt. Das lag daran, dass der zuständige Redakteur zum Zeitpunkt der Abgabe in Urlaub gegangen war. Sogar den Titel »Écrasez l’infâme« hatten sie übernommen. Wer sollte den verstehen? Wenn Kainrath aus Thailand zurückkommt, gibt es Ärger, dachte ich. »Ich rede mich zum Volltrottel, um aus meinen Freiberuflern«, kein Witz, er sagte wirklich »Freiberufler«, »Journalisten zu machen, und dann fallen Sie mir in den Rücken.« Das würden seine Worte sein.
Ich schmiss das Blatt auf den Tisch, verschob die Durchsicht meiner Post auf morgen und drehte den Fernseher auf. Während ein B-Western mit Kip Kendall in den letzten Zügen lag, warf ich die Schmutzwäsche in die Waschmaschine und brachte das Programm zum Laufen. Es ist schön, wenn Strom da ist, um die Dinge in Bewegung zu setzen. Das wird einem viel zu selten bewusst.
Kip brachte seinen mexikanischen Kontrahenten sauber zur Strecke, stieg auf sein treues Pferd und ritt, einsam, aber unbesiegt, dem Abspann entgegen, der im neuen ORF grundsätzlich nicht mehr gezeigt wurde. Nach der Werbung folgten die Spätnachrichten, die sonst immer einen herrlichen Hintergrund abgaben, um langsam dabei einzudösen. Diesmal nicht. Diesmal hatten die flotten Leute von der »Zeit im Bild« eine Meldung auf Lager, die mich förmlich aus dem Sessel hob. Und mir einen Haufen Schwierigkeiten einbringen sollte.
Ich bekam es nicht sofort mit. Erst als ich Namen und Gesichtszüge zur Deckungsgleiche gebracht hatte, ging mir auf, von wem da die Rede war. Sarah Ortbauer war eine Journalistin, die ihr Arbeitsfeld ganz auf das Gebiet der sogenannten Skandalberichterstattung verlegt hatte. Dafür gibt es in diesem Land eine ganze Menge Material, und wer bereit ist, im Dreck zu wühlen, der kann mit den erstaunlichsten Funden rechnen. Ortbauer war diesbezüglich völlig hemmungslos gewesen und hatte, begabt mit einem bemerkenswerten Gespür für Unrat, Hausputz bei der Hautevolee der Korruption abgehalten – bei Männern, mit denen man sich besser nicht anlegte. Irgendwann einmal hatte sie mir erzählt, dass sie ihr Aussehen – Marke »kleines Mädchen, das keiner Fliege was zuleide tun kann« – als Waffe einsetzte, um dann mit ihrer zweiten Klinge, einem analytischen Verstand, den Feind kunstgerecht zu tranchieren. Wer sie gekannt hatte, konnte dieser Selbsteinschätzung nur zustimmen. Sogar auf dem flimmernden Funkfoto war ihr Schulmädchengesicht unverkennbar, auch wenn es weniger attraktiv aussah als im wirklichen Leben. Vielleicht lag das daran, dass sie nicht mehr lebte. Und Leichen sind selten fotogen.
Es war nicht gerade so, dass wir uns nahegestanden wären. Wir kannten uns von ein paar zufälligen Treffen in Lokalen, die wir beide mochten; von Festen, die gemeinsame Bekannte gegeben hatten; von zwei, drei belanglosen, unverbindlichen Plaudereien unter Schreiberlingen. Auf eine distanzierte Art werden wir uns wohl gemocht haben; befreundet waren wir nicht gewesen. Doch sie war immerhin eine Kollegin, und tote Kolleginnen waren eine neue Erfahrung für mich, eine, auf die ich gerne verzichten konnte. Umso mehr, wenn ihr plötzliches Ableben auf Mord zurückzuführen war.
Die vierunddreißigjährige Journalistin Sarah Ortbauer wurde gestern in den frühen Abendstunden im Stadtpark ermordet. Zeugen haben einen mittelgroßen Mann mittleren Alters beobachtet, der mit einem schwarzen Aktenkoffer vom Tatort weglief. Bei der Mordwaffe handelt es sich nach ersten Aussagen des Pressesprechers der Wiener Kriminalpolizei um eine kleinkalibrige Faustfeuerwaffe. Das Tatmotiv ist vorläufig unbekannt. Weitere Einzelheiten über den Mordfall Ortbauer bringen wir morgen in der »Zeit im Bild« …
Anhand dieser Beschreibung würden sie den Täter natürlich bald haben. Blieben grob geschätzt nur mehr zweihunderttausend Tatverdächtige. Was jedoch den Aktenkoffer anging, so kannte ich zwar ein paar Leute, die so ein Ding freiwillig nie anrühren würden – ich selbst etwa gehöre zu dieser Spezies –, doch die waren wohl eher in der Minderzahl. Dann das vorläufig unbekannte Tatmotiv. Nun, bei einer Journalistin der Kategorie Ortbauer konnte das tatsächlich alles sein, wenn auch die Variante »bewaffneter Raubüberfall mit tödlichem Ausgang« wahrscheinlicher war als »Rache des Paten an neugieriger Reporterin«. Denn: »Wien darf nicht Chicago werden«, hat ein freiheitlicher Abgeordneter einmal charmant formulieren lassen. Wie auch immer, die Angelegenheit war alles, nur nicht mein Job. Zumindest dachte ich das damals.
Das Telefon klingelte lauter als die Glocke der braun-weiß gefleckten Leitkuh, die mampfend über eine sattgrüne obersteirische Wiese schwankte; es brachte mich dazu, meine friedvollen Traumgefilde zu verlassen, um einem harten, fordernden Montagmorgen ins stahlblaue Auge zu blicken. Es war neun Minuten vor sechs. Ich sah noch einmal auf das Ziffernblatt, um mich von der Richtigkeit dieses elenden Umstands zu überzeugen. Welcher Verrückte rief um diese gottverlassene Zeit an? Ich schaffte es, den Hörer bis ans linke Ohr zu bringen, dann ging der Text los.
Читать дальше