1.Aufteilung in Tatbestandsmerkmale
78Der erste Schritt, die Benennung der jeweils isoliert zu untersuchenden Tatbestandsmerkmale, ist relativ unproblematisch. Denn die einzelnen Tatbestandsmerkmale stehen regelmäßig im Gesetz. Ganz selten einmal kommt es vor, dass die Rechtspraxis im Hinblick auf einen ganz bestimmten Tatbestand ein sog. ungeschriebenes Tatbestandsmerkmalentwickelt hat. Dies ist – trotz des Grundsatzes „nulla poena sine lege scripta“ – zulässig, da es sich dabei regelmäßig um eine zusätzliche Voraussetzung handelt, die die Strafbarkeit des ansonsten zu weit geratenen Tatbestandes einschränkt und somit zugunsten des potentiellen Täters wirkt. Wann dies der Fall ist, muss regelmäßig „gelernt“ werden, beschränkt sich jedoch auf wenige Ausnahmefälle.
Bsp.:Der Betrug, § 263 StGB, setzt sowohl einen täuschungsbedingten Irrtum als auch einen eingetretenen Vermögensschaden des Opfers voraus. Als Bindeglied – und als Abgrenzung zu anderen Delikten, wie z. B. dem Diebstahl – ist es jedoch notwendig, dass der Schaden dabei auf einer freiwilligen Vermögensverfügung des Opfers beruht. Denn im Gegensatz zum genannten Diebstahl stellt der Betrug ein „Selbstschädigungsdelikt“ dar. Da dies jedoch nicht ausdrücklich im Gesetz steht, ist die Vermögensverfügung als ungeschriebenes Tatbestandsmerkmal in § 263 StGB „hineinzulesen“.
79Es wurde bereits festgestellt, dass ein Tatbestand regelmäßig aus objektiven und subjektivenElementen besteht, die entweder im objektivenoder im subjektiven Tatbestandgeprüft werden. Dabei ist zu beachten, dass (zumindest bei Vorsatzdelikten) im subjektiven Tatbestandstets der Vorsatz zu prüfen ist, der über § 15 StGB in jeden Tatbestand mit hineinzulesen ist. Dadurch ergibt sich folgender zwingender Aufbau des Tatbestandes beim vorsätzlichen Vollendungsdelikt:
 Prüfungsschema
Prüfungsschema
I. Tatbestand
1. objektiver Tatbestand
Prüfung der einzelnen objektiven Tatbestandsmerkmale (jeweils: Definition und Subsumtion)
2. subjektiver Tatbestand
– Feststellung des Vorsatzes hinsichtlich jedes einzelnen objektiven Tatbestandsmerkmals
– Prüfung der sonstigen subjektiven Tatbestandsmerkmale (z. B. besondere Absichten)
II. Rechtswidrigkeit
III. Schuld
80In einer juristischen Klausur müssen somit im ersten Schritt der Tatbestandsprüfung nicht nur die einzelnen Tatbestandsmerkmale voneinander getrennt, sondern es muss zudem festgestellt werden, welche Merkmale objektivund welche Merkmale subjektivsind.
Bsp.:So enthält der objektive Tatbestand des Diebstahls, § 242 StGB, insgesamt vier Merkmale: als Tatobjekt eine (1) Sache, die (2) beweglich und für den Täter (3) fremd sein muss, sowie als Tathandlung (4) die Wegnahme. Im subjektiven Tatbestand ist (5) zuerst ein Vorsatz bzgl. dieser objektiven Tatbestandsmerkmale erforderlich, der Täter muss also wissen, dass er eine Sache, die beweglich und für ihn fremd ist, wegnimmt. Daneben ist (6) als weiteres (geschriebenes) subjektives Tatbestandsmerkmal notwendig, dass der Täter die Absicht hat, sich diese Sache rechtswidrig zuzueignen.
Als zweiter Schritt folgt nun die Definitionder einzelnen Tatbestandsmerkmale. Diese „Auslegung“ ist eine der wesentlichen Aufgaben des Juristen. In der Ausbildung bzw. in juristischen Klausuren ist es ratsam, zumindest die wichtigsten Definitionen zu „wissen“. In der Rechtspraxis finden sich diese Definitionen in den gängigen Kommentaren zum StGB. Wenn das juristische Verstehen eine Kombination von Fleiß und juristischem Gespür darstellt, ist an dieser Stelle die Ebene des Fleißes angesprochen. Zumindest die gängigen Definitionen sollten also „gelernt“ werden. Natürlich kann im Rahmen einer Klausur zu jedem Tatbestandsmerkmal eine eigene Definition entwickelt werden. Dies ist jedoch sehr zeitintensiv. Zudem wird auch der fähigste Jurist in einer zwei- oder fünfstündigen Klausur kaum einmal exakt diejenige Definition „treffen“, die sich in der Rechtspraxis in jahrzehntelanger harter Diskussion durchgesetzt hat.
Bsp.:So finden sich beim Straftatbestand des Diebstahls folgende Standarddefinitionen 34: Als Sachewird „jeder körperliche Gegenstand i. S. des § 90 BGB“ angesehen. Fremdist eine Sache, „die zumindest auch im Eigentum eines anderen steht“. Eine Sache ist beweglich, „wenn sie von ihrem bisherigen Standort körperlich fortbewegt werden kann“. Unter Wegnahmeversteht man „den Bruch fremden und die Begründung neuen, nicht notwendigerweise tätereigenen Gewahrsams“. Zueignungschließlich bedeutet, dass „der Täter sich eine eigentümerähnliche Herrschaftsmacht über eine Sache anmaßt, indem er entweder die Sache selbst oder den in ihr verkörperten Sachwert dem eigenen Vermögen einverleibt, wobei er sich die Sache zumindest vorübergehend aneignet und den Eigentümer dabei dauerhaft enteignet“ (da die Zueignung in § 242 StGB lediglich beabsichtigt sein muss, also im subjektiven Tatbestand zu prüfen ist, muss diese objektiv nicht vorliegen, es reicht also eine hierauf gerichtete entsprechende Absicht des Täters aus). – Teilweise ist es sogar notwendig, einzelne Begriffe dieser Definitionen ihrerseits wiederum zu definieren. So versteht man unter dem Begriff des Gewahrsams(als Definitionsmerkmal des Begriffs der Wegnahme) „das von einem Herrschaftswillen getragene tatsächliche Herrschaftsverhältnis“.
82Als nächster Schritt folgt dann die Subsumtiondes vorliegenden Lebenssachverhalts unter die zuvor festgestellte Definition des jeweiligen Tatbestandsmerkmals. Geprüft werden muss also – wiederum jeweils getrennt nach den einzelnen Tatbestandsmerkmalen –, ob der konkrete Fall unter die jeweilige Definition „passt“. Wenn, wie bereits erwähnt, das juristische Verstehen eine Kombination von Fleiß und juristischem Gespür darstellt, ist hier nun Letzteres angesprochen. Denn es würde ein sinnloses – und nie endendes – Unterfangen darstellen, „lernen“ zu wollen, inwieweit sämtliche in Frage kommenden Lebenssachverhalte unter die gefundenen juristischen Definitionen zu subsumieren sind. An dieser Stelle muss nun argumentiertwerden. Insbesondere juristische Klausuren sind so konstruiert, dass es selten „eindeutige“ Fälle gibt, für die nur eine Lösung denkbar ist.
Bsp.:Anton zertrampelt aus Verärgerung über den zunehmenden Tourismus in seinem bayerischen Heimatdorf eine von der Gemeindeverwaltung gespurte Langlaufloipe. Bei der Prüfung, ob er hierdurch eine Sachbeschädigung, § 303 StGB, begangen hat, muss als erstes geprüft werden, ob eine Langlaufloipe eine „Sache“ ist. Wie beim Diebstahl, so versteht man auch bei der Sachbeschädigung unter einer Sache einen „körperlichen Gegenstand i. S. des § 90 BGB“ (= Definition). Die Sache muss aber – nun im Gegensatz zum Diebstahl – nicht beweglich sein, da § 303 StGB dieses Tatbestandsmerkmal nicht enthält. „Schnee“ ist nun als körperlicher Gegenstand anzusehen, fraglich ist jedoch, ob dies auch für „gespurten Schnee“ gilt, denn Anton beschädigt bzw. zerstört hier ja nicht den Schnee als solches, sondern die Loipe (= Subsumtion). Hier müssen nun Argumente gesammelt und eine Entscheidung getroffen werden. Ein „richtig“ oder „falsch“ gibt es dabei nicht. Selbst die Gerichte sind bei dieser Frage schon zu unterschiedlichen Ergebnissen gekommen. 35
Читать дальше
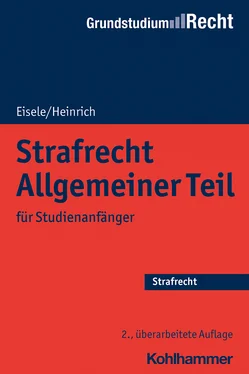
 Prüfungsschema
Prüfungsschema










