Bsp.:Peter zertrümmert einen Kristallglasaschenbecher auf Josefs Kopf. – Hier ist der Tatbestand der gefährlichen Körperverletzung, §§ 223, 224 Abs. 1 Nr. 2 StGB, erfüllt. Stand der Aschenbecher nicht in Peters Eigentum, liegt zudem eine Sachbeschädigung, § 303 StGB, vor.
61 c)Um zu einer Bestrafung zu gelangen, muss die Erfüllung des Tatbestandes zudem rechtswidrigsein. Denn nicht immer stellt ein Verstoß gegen eine strafrechtliche Vorschrift auch ein unrechtmäßiges Verhalten dar. Erfüllt der Täter einen Straftatbestand, so muss allerdings regelmäßig ein besonderer Grund vorliegen, der dem Täter ein solches Verhalten gestattet. Diese speziellen „Erlaubnistatbestände“ nennt man Rechtfertigungsgründe. 19
Bsp.:Wenn Peter im gerade genannten Beispiel den Aschenbecher nur deswegen auf Josefs Kopf zertrümmert, weil Josef kurz zuvor ein Messer gezogen und dem Peter gedroht hat, ihn „abzustechen“, ändert dies nichts daran, dass Peter den Straftatbestand der gefährlichen Körperverletzung, §§ 223, 224 Abs. 1 Nr. 2 StGB erfüllt. Sein Verhalten ist jedoch durch den Rechtfertigungsgrund der Notwehr, § 32 StGB, gedeckt, da ihn Josef gerade rechtswidrig angegriffen hatte und der Schlag ein geeignetes, erforderliches und gebotenes Mittel war, diesen Angriff abzuwehren. 20Das Vorliegen dieses Rechtfertigungsgrundes schließt nun im Ergebnis die Strafbarkeit Peters wegen der begangenen Körperverletzung aus, ändert aber nichts daran, dass der Tatbestand der Körperverletzung erfüllt ist. Die Aufgabe in einem juristischen Gutachten ist es nun, nicht nur festzustellen, dass Peter sich nicht strafbar gemacht hat, sondern genau zu bestimmen, an welcher Voraussetzung eine Strafbarkeit scheitert.
62 d)Auch ein tatbestandsmäßiges und rechtswidriges Verhalten reicht für eine Strafbarkeit noch nicht aus, hinzukommen muss weiter, dass die Tat auch schuldhaftbegangen wurde. 21Dies ist dann zu bejahen, wenn eine Verhaltensweise nicht nur gegen die Rechtsordnung verstößt, sondern wenn man sie dem Täter auch persönlich zum Vorwurf machen kann, er also persönlich für das von ihm begangene Unrecht verantwortlich gemacht werden kann. 22
Bsp.:Zertrümmert Peter den Aschenbecher auf Josefs Kopf, ohne dass ihm ein Rechtfertigungsgrund zur Seite steht, scheidet eine Strafbarkeit dennoch aus, wenn er zum Zeitpunkt der Tat nicht schuldfähig war. Dies kann seine Ursache u. a. darin haben, dass Peter geistesgestört oder völlig betrunken war (vgl. § 20 StGB). Auch wenn es sich bei Peter um ein 13-jähriges Kind handelt, scheidet eine Bestrafung infolge Schuldunfähigkeit aus (vgl. § 19 StGB). Im Gegensatz zur fehlenden Rechtswidrigkeit kann ein lediglich schuldloses Verhalten jedoch eine Maßregel der Besserung und Sicherung nach sich ziehen, also z. B. die Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus oder einer Entziehungsanstalt, §§ 63, 64 StGB. 23
63 e)Liegen sämtliche dieser Elemente vor, dann spricht man vom Vorliegen einer Straftat.Der Täter kann aus der jeweiligen Strafvorschrift, die als Rechtsfolge in der Regel einen bestimmten Strafrahmen vorgibt, bestraft werden.
64In diesem Zusammenhang soll kurz noch darauf hingewiesen werden, was mit dem im StGB teilweise verwendeten Begriff der rechtswidrigen Tatgemeint ist.
 Gesetzestext
Gesetzestext
§ 11 Abs. 1 Nr. 5 StGB: Im Sinne dieses Gesetzes ist […] rechtswidrige Tat: nur eine solche, die den Tatbestand eines Strafgesetzes verwirklicht.
65Erforderlich sind also die Erfüllung eines Straftatbestandes und das Vorliegen der Rechtswidrigkeit. Auf die persönliche Schuld des Täters kommt es nicht an. In diesen Fällen spricht man auch vom Vorliegen von Unrecht. Wer eine rechtswidrige Tat begeht, begeht also Unrecht. Insoweit kann es durchaus Unrecht ohne Schuld geben. Zwar kann der Täter in diesen Fällen nicht bestraft werden, dennoch hat das Vorliegen einer „rechtswidrigen Tat“ einige wesentliche Konsequenzen:
So darf z. B. gegen eine Person, die eine rechtswidrige Tat begeht, im Wege der Notwehr vorgegangen werden. Ein schuldhaftes Verhalten des Angreifers ist nicht erforderlich. Auch kann man zu einer rechtswidrigen Tat anstiften oder Hilfe leisten (vgl. §§ 26, 27 StGB). Dass der Haupttäter schuldhaft handelt, ist auch hier nicht erforderlich. Schließlich kann sich an die Begehung von Unrecht die Verhängung einer Maßregel der Besserung und Sicherung knüpfen, §§ 63 ff. StGB.
66Die genannte Prüfungsreihenfolge (das Unrecht ist vor der Schuld zu prüfen) beruht auf dem Gedanken, dass das Unrecht der Schuld sachlogisch vorausgehen muss. Denn es kann zwar Unrecht ohne Schuld geben (z. B. wenn ein Geisteskranker einen Menschen tötet), das Vorliegen einer strafrechtlichen Schuld ohne Unrecht ist jedoch ausgeschlossen (wer kein Unrecht begeht, kann auch nicht „schuld sein“, man kann ihm das Verhalten jedenfalls strafrechtlich nicht vorwerfen).
67Lange Zeit umstritten war die Frage, an welcher Stelle des dreigliedrigen Verbrechensaufbaus (Tatbestandsmäßigkeit – Rechtswidrigkeit – Schuld)der Vorsatz zu prüfen ist. Dass ein solcher Vorsatz regelmäßig erforderlich ist, ergibt sich aus § 15 StGB.
 Gesetzestext
Gesetzestext
§ 15 StGB: Strafbar ist nur vorsätzliches Handeln, wenn nicht das Gesetz fahrlässiges Handeln ausdrücklich mit Strafe bedroht.
68Zwar kennt unser StGB eine Vielzahl auch fahrlässig zu begehender Delikte, wie z. B. die fahrlässige Tötung, § 222 StGB. Insbesondere bei den Delikten, die sich gegen fremdes Vermögen oder Eigentum richten, wie z. B. beim Diebstahl, § 242 StGB, oder bei der Sachbeschädigung, § 303 StGB, findet sich eine solche Fahrlässigkeitsstrafbarkeit jedoch nicht. Aus § 15 StGB ergibt sich nun, dass die Notwendigkeit vorsätzlichen Verhaltens in jedes einzelne Delikt des Besonderen Teils des StGB mit hineinzulesen ist, wenn in der entsprechenden Vorschrift nicht ausdrücklich eine Fahrlässigkeitsstrafbarkeit angeordnet wird. Dies hat zur Folge, dass z. B. § 212 StGB („Wer einen Menschen tötet […], wird […] bestraft“) i. V. m. § 15 StGB wie folgt zu lesen ist: „Wer vorsätzlicheinen Menschen tötet […], wird […] bestraft“.
69Begreift man den Vorsatz als Wissen und Wollen der Tatbestandsverwirklichung, 24so wird deutlich, dass es sich dabei jedenfalls um ein subjektives Elementhandeln muss. Der Täter muss einerseits die konkreten Umstände kennen, die dazu führen, dass sein Handeln einen gesetzlichen Tatbestand erfüllt, und er muss diese Tatbestandsverwirklichung auch wollen.
Bsp.:Wenn Anton den still in einer Ecke stehenden Bruno mit einer Pistole erschießt (nur dieser äußere Tathergang ist im Übrigen von einem außenstehenden Beobachter objektiverkennbar), liegt eine vorsätzliche Tötung nur dann vor, wenn Anton subjektivdie vorliegenden Umstände auch kennt. Er muss also wissen, dass er auf einen Menschen (und nicht z. B. auf eine Schaufensterpuppe) schießt, dass es sich bei der Pistole um eine scharfe Waffe (und nicht um eine Spielzeugpistole, mit der er nur drohen wollte) handelt und dass die Waffe auch geladen ist. Neben diesem Wissen um die einzelnen Umstände muss er den tödlichen Erfolg auch wollen, was z. B. dann ausscheidet, wenn er Bruno mit dem Schuss nur erschrecken, nicht aber treffen oder ihn nur verletzen, nicht aber töten wollte. – In der Praxis stellen sich für den Richter gerade in diesem Bereich große Nachweisprobleme, insbesondere wenn der Täter, wozu er ein Recht hat, in der gerichtlichen Hauptverhandlung schweigt. Die objektivvorliegenden Umstände kann man durch Zeugenaussagen aufklären, was der Täter aber subjektivwusste und wollte, bleibt nach außen stets unsichtbar.
Читать дальше
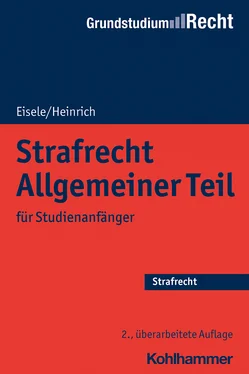
 Gesetzestext
Gesetzestext










