1. positive Tatbestandsmerkmale
a) objektiver Tatbestand
b) Vorsatz bzgl. des Vorliegens des objektiven Tatbestandes
2. negative Tatbestandsmerkmale
a) objektives Fehlen von Rechtfertigungsgründen
b) Vorsatz bzgl. der Rechtswidrigkeit
II. Schuld
 Klausurtipp
Klausurtipp
In Klausuren muss in aller Regel nicht begründet werden, warum welche Prüfungsreihenfolge gewählt wird. Dies betrifft insbesondere die genannten Modelle des Straftataufbaus. Man entscheidet sich für einen bestimmten Aufbau (zweckmäßigerweise für den herrschenden) und prüft diesen konsequent durch. Da die verschiedenen Lehren nur in wenigen Punkten zu unterschiedlichen Lösungen führen, muss lediglich dann, wenn ein solcher Punkt in einer Klausur einmal problematisch ist (in der Regel bei der Erörterung der entsprechenden Theorienstreitigkeiten), auf die verschiedenen Theorien bzw. auf den gewählten Aufbau eingegangen werden.
Literaturhinweise
Ambos , Ernst Belings Tatbestandslehre und unser heutiger „postfinalistischer“ Verbrechensbegriff, JA 2007, 1 (kurze Darstellung mit anschaulichen Schemata); Werle , Die allgemeine Straftatlehre – insbesondere: Der Deliktsaufbau beim vorsätzlichen Begehungsdelikt, JuS 2001, L 33, L 41, L 49, L 57 (umfassender Überblick anhand von anschaulichen Beispielen)
Teil 2:Der strafrechtliche Tatbestand
Kapitel 2:Der strafrechtliche Tatbestand – Überblick und Deliktsarten
I.Grundlagen
75Wird mit der modernen Lehre der dreigliedrige Straftataufbau (Tatbestandsmäßigkeit [objektiv; subjektiv] – Rechtswidrigkeit – Schuld) gewählt, muss man auf der ersten Stufe den Tatbestand in den Blick nehmen. Dabei muss stets ein gesetzlicher Straftatbestand(z. B. der Tatbestand des Diebstahls, § 242 StGB) als Anknüpfungspunkt für die strafrechtliche Prüfung dienen. Dies folgt bereits aus dem verfassungsrechtlichen Grundsatz „nulla poena sine lege“. 31In diesem Tatbestand müssen sämtliche Merkmale umschrieben sein, die ein bestimmtes strafrechtliches Verbot (oder Gebot) begründen. Der Einzelne soll dadurch erkennen können, was grundsätzlich von der Rechtsordnung als „verboten“ angesehen wird und wonach er sich demnach richten muss (man spricht daher auch von der „Appellfunktion des Tatbestandes“).
Bsp.:Der Tatbestand des Diebstahls wird in § 242 StGB wie folgt umschrieben: „Wer eine fremde bewegliche Sache einem anderen in der Absicht wegnimmt, die Sache sich oder einem Dritten rechtswidrig zuzueignen, wird […] bestraft.“
76Die für die juristische Ausbildung relevanten Tatbeständebefinden sich vorwiegend im Besonderen Teildes StGB. Im Normalfall ist ein solcher Tatbestand in sich abschließendund regelt die Voraussetzungen, unter denen ein bestimmtes Verhalten strafbar ist, vollständig. Dabei sind die vor die Klammer gezogenen Vorschriften des Allgemeinen Teilsdes StGB stets ergänzend heranzuziehen (z. B. das Erfordernis vorsätzlichen Verhaltens, § 15 StGB). Darüber hinaus ist zu beachten, dass manche Tatbestände (Qualifikationen, Privilegierungen) auf anderen Tatbeständen (den sog. „Grundtatbeständen“) aufbauen. 32Die Tatbestände (insbesondere im StGB) sind insoweit regelmäßig als sog. Volltatbeständekonstruiert, enthalten also selbst alle Voraussetzungen, die zur Ermittlung der Strafbarkeit erforderlich sind. Es gibt jedoch auch Tatbestände, die für sich genommen nicht abschließend sind, sondern ausdrücklich auf andere Tatbestände oder Vorschriften verweisen (sog. Blankett-Tatbestände).
Bsp.:So ist eine Luftverunreinigung, § 325 StGB, nur strafbar, wenn die Verschmutzung der Luft „unter Verletzung verwaltungsrechtlicher Pflichten“ erfolgt. Welche Pflichten das sind, ergibt sich erst unter Heranziehung von verwaltungsrechtlichen Vorschriften im Einzelfall. – Es gibt jedoch auch Tatbestände, die zwar keine ausdrückliche Verweisung auf andere Vorschriften vornehmen, für deren Auslegung man jedoch Normen aus anderen Rechtsgebieten braucht. So knüpft der Diebstahl, § 242 StGB, an die Wegnahme einer „fremden“ beweglichen Sache an. Wann eine Sache „fremd“ ist, lässt sich aber erst unter Heranziehung der Eigentumsordnung des BGB ermitteln.
II.Der Aufbau eines strafrechtlichen Tatbestandes
77Jeder Tatbestand besteht aus verschiedenen einzelnen Elementen, den sog. Tatbestandsmerkmalen. Hier werden regelmäßig das Tatsubjekt (z. B. „Amtsträger“), das Tatobjekt (z. B. „Mensch“, „Sache“) und die Tathandlung (z. B. „töten“, „wegnehmen“) umschrieben. Es können sich darüber hinaus aber durchaus auch andere Merkmale in den gesetzlichen Tatbeständen wiederfinden (z. B. besondere Begehungsweisen, Tatmittel oder Tatmodalitäten). Aufgabe des Rechtsanwenders, also des Richters (oder auch desjenigen, der eine juristische Klausur oder Hausarbeit zu verfassen hat), ist es, in einem ersten Schritt die einzelnen Tatbestandsmerkmale sauber voneinander zu trennen. In einem zweiten Schritt muss dann festgestellt werden, welchen Inhalt die jeweiligen Tatbestandsmerkmale haben, was also im konkreten Fall unter dem vom Tatbestand verwendeten Begriff zu verstehen ist („Definition“). Schließlich ist in einem dritten Schritt zu prüfen, ob das Verhalten des Täters von der jeweiligen Definition des entsprechenden Tatbestandsmerkmals erfasst wird („Subsumtion“). Das einzelne Tatbestandsmerkmal muss also zuerst benanntund dann definiertwerden. Danach hat eine Subsumtionunter den betreffenden Lebenssachverhalt zu erfolgen. Abschließend ist dann ein Ergebniszu formulieren.
Bsp.:Anton gibt dem Bruno eine kräftige Ohrfeige. Diese hinterlässt zwar keine Spuren, der Schlag tut dem Bruno jedoch ziemlich weh. In Betracht kommt hier der gesetzliche Tatbestand der Körperverletzung, § 223 StGB. In einem ersten Schritt sind die einzelnen Tatbestandsmerkmale zu benennen: „Wer“ (= Täter), „eine andere Person“ (= Opfer), „körperlich misshandelt“ oder „an der Gesundheit schädigt“ (= jeweils Tathandlungen). In einem zweiten Schritt sind diese Merkmale dann zu definieren: „Wer“ ist jede natürliche Person, „eine andere Person“ ist jede natürliche Person, die vom Handelnden verschieden ist, „körperliche Misshandlung“ ist „jede üble unangemessene Behandlung, die das körperliche Wohlbefinden mehr als nur unerheblich beeinträchtigt und unter einer „Gesundheitsschädigung“ wird das „Hervorrufen oder Steigern eines krankhaften Zustandes“ verstanden, wobei als „krankhaft“ der vom Normalzustand der körperlichen Funktionen nachteilig abweichende Zustand anzusehen ist. 33Nun folgt die Subsumtion: Anton ist eine natürliche Person, Bruno eine von Anton verschiedene andere natürliche Person, eine Ohrfeige ist kein üblicher sozialer Umgang, sondern eine unangemessene Behandlung, die infolge der Schmerzen auch das körperliche Wohlbefinden Brunos beeinträchtigt und nicht nur unerheblich ist. Da die Ohrfeige allerdings keine Spuren hinterlässt und daher kein krankhafter Zustand bei Bruno hervorgerufen wird, liegt darüber hinaus keine Gesundheitsschädigung vor. Da die Tathandlungen „körperliche Misshandlung“ und „Gesundheitsschädigung“ nicht kumulativ, sondern nur alternativ vorliegen müssen („oder“), reicht die Erfüllung eines dieser Merkmale aus. Als Ergebnisist daher zu formulieren: Anton hat den objektiven Tatbestand einer Körperverletzung, § 223 StGB, erfüllt.
Читать дальше
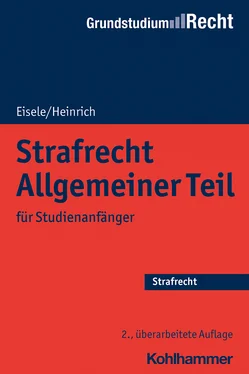
 Klausurtipp
Klausurtipp










