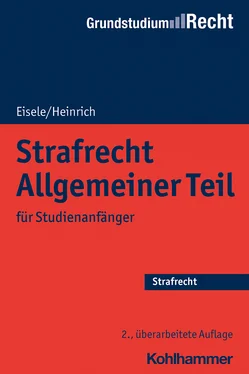1 ...7 8 9 11 12 13 ...35 46 c) Anknüpfungspunkt: Staatsangehörigkeit des Opfers.Nach dem passiven Personalitätsprinzipdarf ein Staat Handlungen, die gegen einen eigenen Staatsbürger begangen werden, auch dann in vollem Umfang seiner Strafgewalt unterwerfen, wenn die Tat im Ausland begangen wird. Dabei unterfallen nur deutsche Staatsbürger (vgl. Art. 116 GG), nicht hingegen (z. B. bei Vermögensstraftaten) juristische Personen mit Sitz in Deutschland, dieser Vorschrift. Auch hier gilt aber nach § 7 Abs. 1 StGB die Einschränkung, dass die Tat am Tatort strafbar sein muss oder der Tatort keiner Strafgewalt unterliegt.
47 d) Anknüpfungspunkt: Schutz besonderer inländischer Rechtsgüter.Nach dem in § 5 StGB geregelten Schutzprinzip wird die deutsche Strafgewalt auch auf Taten ausgedehnt, die zwar im Ausland begangen werden, jedoch besondere inländische Rechtsgüter gefährden. Hintergrund dieser Regelung ist, dass in den hier genannten Fällen regelmäßig besondere deutsche Interessen gefährdet werden (z. B. beim Hochverrat, §§ 81 ff. StGB). Die Regelung bekommt dann eine eigene Bedeutung, wenn entweder sämtliche Beteiligte ausländische Staatsangehörige sind oder aber die Tat am Tatort nicht mit Strafe bedroht ist (da in diesen Fällen § 7 StGB dann nicht greift). Dabei lassen sich innerhalb des § 5 StGB zwei Schutzrichtungen unterscheiden, nämlich einerseits Staatsschutzgesichtspunktebei der Verletzung von überindividuellen Rechtsgütern (so die genannten Hochverratsdelikte, §§ 81 ff. StGB), andererseits Individualschutzgesichtspunktebei der Verletzung von besonders bedeutsamen Individualrechtsgütern (wie z. B. bei der Kindesentziehung, § 235 StGB). Teilweise wird bei den zuletzt genannten Taten zwar auch darauf abgestellt, dass der Täter oder das Opfer Deutsche sind oder jedenfalls ihren Wohnsitz im Inland haben. Im Gegensatz zu § 7 StGB wird hier aber auf die Einschränkung, dass die Tat auch am Tatort mit Strafe bedroht sein muss, verzichtet.
48 e) Anknüpfungspunkt: Interessen von universaler Bedeutung.Das in § 6 StGB geregelte Weltrechtsprinzip(oder auch Universalitätsprinzip) ermächtigt zur Ahndung von reinen Auslandstaten, die sich gegen übernationale Kulturwerte und Rechtsgüter richten, an deren Schutz ein gemeinsames Interesse aller Staaten besteht (z. B. Menschenhandel, Geld- und Wertzeichenfälschung, unbefugter Vertrieb von Betäubungsmitteln). Ob ein Deutscher beteiligt ist oder nicht, spielt dabei keine Rolle. Zwar gerät die Durchführung eines Strafverfahrens in diesen Fällen an sich in Konflikt mit dem bereits genannten völkerrechtlichen Nichteinmischungsprinzip, eine Strafverfolgung ist hier aber deswegen gerechtfertigt, weil durch die Regelungen des § 6 StGB gerade internationale Verpflichtungen umgesetzt wurden, die Deutschland im Rahmen von völkerrechtlichen Verträgen mit anderen Staaten eingegangen ist. In diesen Verträgen wurde zumeist vereinbart, dass jeder Unterzeichnerstaat dafür Sorge zu tragen hat, dass eine entsprechende Strafvorschrift im nationalen Recht geschaffen wird. Dies hat zur Konsequenz, dass ein Täter, der z. B. unbefugt Betäubungsmittel vertreibt (vgl. § 6 Nr. 5 StGB), in nahezu jedem Staat der Welthierfür bestraft werden kann, selbst wenn er nur innerhalb eines Landes tätig wird und seine Produkte auch nur an Einheimische verkauft. Einschränkend wird jedoch teilweise verlangt, dass auch hier irgendein „legitimierender Anknüpfungspunkt“ für die Strafverfolgung im Inland besteht – und sei es nur, dass der Täter seinen Wohnsitz nach Deutschland verlegt.
49 f) Anknüpfungspunkt: Stellvertretende Strafrechtspflege.Nach dem in § 7 Abs. 2 Nr. 2 StGB geregelten Stellvertretungsprinzipunterliegt derjenige Ausländer der deutschen Strafgewalt, der im Ausland eine Tat begeht, im Inland angetroffen wird und aufgrund bestimmter Umstände nicht an den betreffenden Staat ausgeliefert werden kann. Der Sinn dieser Regelung besteht darin, dass auch flüchtige Täter bestraft werden können, die ansonsten straflos blieben, weil der betreffende Staat an einer Bestrafung entweder gehindert ist, kein Interesse hat oder sonstige Auslieferungshindernisse (z. B. eine im Ausland zu erwartende menschenunwürdige Behandlung, insbesondere Folter, oder auch eine drohende Todesstrafe) bestehen.
Literaturhinweise
Satzger , Das deutsche Strafanwendungsrecht (§§ 3 ff. StGB), JURA 2010, 108, 190 (umfassende Einführung anhand von anschaulichen Beispielsfällen)
Werle/Jeßberger , Grundfälle zum Strafanwendungsrecht, JuS 2001, 35, 141 (Aufarbeitung des gesamten Themenkomplexes anhand mehrerer kleinerer Beispielsfälle)
BGHSt 34, 334– Drogenhändler (zum Weltrechtsprinzip bei Drogendelikten); BGHSt 45, 64– Bosnische Serben I (zur Anwendung des § 6 Nr. 1 StGB); BGHSt 46, 212– Adelaide Institute (zum Tatort bei Internet-Straftaten); BGHSt 46, 292– Bosnische Serben II (zur Anwendung des § 6 Nr. 9 StGB)
3.Exkurs: Internationales und Europäisches Strafrecht
50Die im letzten Jahrhundert vermehrt auftretenden schwerwiegenden und systematischen Menschenrechtsverletzungen durch staatliche Machthaber führten zu einer rasanten Entwicklung eines eigenständigen Völkerstrafrechts. Dies hatte zur Folge, dass Verstöße gegen zentrale Normen des Völkerrechts heute zum Teil unmittelbar nach Völkerrecht, d. h. nicht mehr (nur) nach dem nationalen Recht eines Staates, abgeurteilt werden können. Zuständig ist der ständige internationale Strafgerichtshof (IStGH)mit Sitz in Den Haag (Niederlande). Die hier aufgenommenen (völkerrechtlichen) Strafvorschriften finden sich allerdings auch im nationalen deutschen Recht wieder. Sie wurden in §§ 6 ff. des deutschen Völkerstrafgesetzbuches (VStGB) aus dem Jahre 2002 den Regelungen des IStGH-Statuts nachgebildet. Es handelt sich hierbei um die Tatbestände des Völkermords (§ 6 VStGB), des Verbrechens gegen die Menschlichkeit, d. h. schwerwiegende Verletzungen von Menschenrechten z. B. aus rassistischen oder religiösen Gründen (§ 7 VStGB) und der Kriegsverbrechen, d. h. der schwerwiegenden Verletzungen des Kriegsvölkerrechts, z. B. durch die Misshandlung von Gefangenen oder Plünderungen (§§ 8 ff. VStGB). Bei der Ahndung dieser Verbrechen ist nach § 1 VStGB die deutsche Strafgewalt nach dem hier verankerten Universalitätsprinzip stets eröffnet, wobei ausdrücklich auf einen „legitimierenden Anknüpfungspunkt“ verzichtet wurde.
51Auf eine ausführliche Darstellung des sich erst noch entwickelnden „Europäischen Strafrechts “wird an dieser Stelle verzichtet, da die Europäische Union derzeit nur eine sehr begrenzte Kompetenz zum Erlass verbindlicher Strafrechtsnormen besitzt (vgl. Art. 33, 83, 325 Abs. 4 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union – AEUV). Dennoch wirkt das europäische Recht auch in das deutsche Strafrecht hinein. Durch europäische Rechtsakte wird der deutsche Gesetzgeber verpflichtet, entsprechende Strafvorschriften zu schaffen, die Rechtsanwender sind gehalten, deutsches Recht „unionskonform“ auszulegen und teilweise enthalten auch deutsche Strafnormen eine direkte Bezugnahme auf europäische Verordnungen oder Richtlinien. Besondere Bedeutung erlangt das Europäische Recht zudem bei der Strafverfolgung sowie bei der Rechtshilfe (Bsp.: Europäischer Haftbefehl).
52Wesentlich größere Bedeutung hat hingegen die – auf eine Initiative des Europarates (nicht der Europäischen Union!) zurückgehende – Europäische Menschenrechtskonvention (EMRK). Der deutsche Gesetzgeber hat die EMRK durch ein Gesetz in die deutsche Rechtsordnung überführt, sodass die Regelungen der EMRK nunmehr im Rang eines Bundesgesetzes – und daher auf derselben Ebene wie das StGB – gelten. Die EMRK enthält eine Vielzahl von Rechten des einzelnen Bürgers sowie eine Vielzahl rechtsstaatlicher Mindestgarantien im Strafverfahren, die sich in der Regel auch mit den Grundrechten der deutschen Verfassung decken. Für die Auslegung spielt – auch im Hinblick auf das deutsche Recht – die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofes für Menschenrechte (EGMR) eine entscheidende Rolle.
Читать дальше