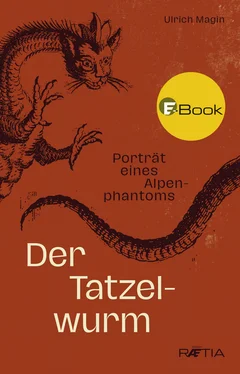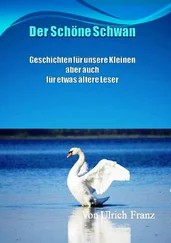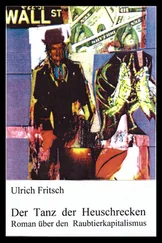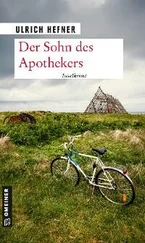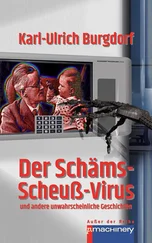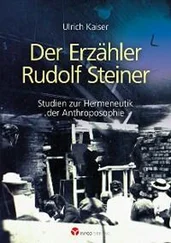„vff den xxj tag meyen ist beschechen
zu Lutzern, hat man ein seltsam ding gesehen,
ein wurm, sin hals ward geacht zwei klaffter lang,
sich vß dem sew durch die Rüßbrügk schwang.
sin houpt mit breiten oren, gestalt eins kalb,
vnd die grosse des libß allenthalb
ouch einem kalb ze glichen vnd ze schetzen,
daby hab ich die weit hören schwetzen,
des wurms lengy sy xj klaffter gewesen.“ 39
Das sind, bei einem Klafter zwischen 1,7 und 2,5 Meter, immerhin um die 20 Meter!
Renward Cysat kennt einen weiteren Pilatusdrachen. 1503 gingen junge Männer aus Luzern auf Hoch- und Niederwildjagd in den Wäldern gegen Malters. Einer der Hubertusjünger blieb zurück und stieß am Boden auf einen großen schlafenden Drachen:
„Zuerst meinte der junge Herr, es läge da ein alter, verfaulter Baum. Als aber das Tier einen bösen Geruch und Dampf von sich gab, merkte der Junker bald, was er vor sich hatte. Er erschrak zuerst ordentlich; als er aber einige seiner Gefährten nahen hörte, fasste er sich ein Herz und schlug dem Untier mit einer Axt auf den Kopf. Der Streich schadete dem Tier, das eine dicke gehörnte Haut besaß, nichts. Es erwachte aber davon, schwang sich in die Höhe und flog über den Wald davon.“ 40
Als er seine Jagdkumpane rief, fanden diese nur noch einen verbrannten Flecken vor. Cysat will diese Geschichte 60 Jahre später noch aus dem Munde eines der Beteiligten gehört haben.
Am 29. Juli 1509 erschien laut dem Schweizer Chronisten Diebold Schilling (vor 1460–vermutlich 1515) ein Monster im Zuger See,
„zur Zeit des Papstes Julius und des Kaisers Maximilian. Ein großer Fisch tauchte bei Arth auf, der seit uralten Zeiten anzeigte, wenn immer etwas Wichtiges wie ein Krieg, ein Tod oder Schaden fürs Leben bevorstand. Viele Leute verglichen seine Form mit der eines Karpfens, aber er hatte die Größe eines Bootes mit Eichenplanken. Er taucht nur vor wichtigen und vielsagenden Ereignissen auf.“ 41
Zwei Jahre darauf meldet der Drachenforscher Johann Jakob Scheuchzer (1672–1733) in seiner „Natur-Geschichte des Schweitzerlandes“ (1716) unter Berufung auf Lindauers Winterthurer Chronik: „In dem Jahr (1511.) sahe man zu Eglisau einen grossen Wurm den Rhein hinunter fahren.“ 42
1559 wurde – wiederum nach Scheuchzer – ein Drache bei Chur beobachtet, aber das war nicht der erste in dieser Region, denn bereits 30 Jahre zuvor hatte ein Einheimischer
„einen sehr grossen Wurm, welcher auf einem Felsen lag, geschossen, der so vergiftig war, daß auch die Luft, welche über ihn her wähete, den Mann des Gesichts beraubte, und seinen Leib so aufgeblasen, daß er keine Hoffnung des Lebens mehr hatte. Er konnte aber mit grosser Mühe noch nach Hause kommen, und nachdem er den seinigen den Ort, wo die Schlange gewesen, angezeiget, sey sie einige Tage hernach getödtet worden.“ 43
Die ersten Drachen außerhalb der Schweiz kommen aus Österreich und werden von vielen Gelehrten bezeugt, darunter dem Begründer der Zoologie, dem Schweizer Arzt und Naturforscher Conrad Gesner (1516–1565), und dessen Verleger Christoph Froschauer (1490–1564). Eine Herde vierfüßiger Schlangen, „ähnlich den Eidechsen“, soll 1543 am Himmel über der Steiermark gesehen worden sein. Gesner geht anlässlich dieser Meldung auf die Arzneimittel ein, die aus Drachen gewonnen werden, und erklärt, der Drache sei so giftig, dass eine Bisswunde nie mehr heile. 44Im zweiten Buch seiner „Geschichte der Tiere“ erwähnt Gesner, er habe gehört, dass in jener Region der Gallia Cisalpina, die man Piemonte nenne, in den Bergen ungeheure Eidechsen lebten, so groß wie Hundewelpen, deren Exkremente von den Bewohnern gesammelt würden, er habe dafür allerdings noch keinen zuverlässigen Zeugen. 45Diesen Berichten und Beobachtungen zufolge finden sich Alpendrachen nun in der Schweiz, in Österreich und Italien.
Der Chronologie der Drachenerwähnungen folgend suchte nach Renward Cysat 1566 ein Wasserdrache erneut die Reuss auf. „1566, nach einem Sommer mit nie zuvor erlebten großen Überschwemmungen, wurde wieder eine große Schlange in der Reuss bei Bremgarten gesehen. Nachts verließ sie den Fluss, betrat die Alpenhänge und riss Kälber in Stücke.“ 46Bremgarten liegt zwischen dem Vierwaldstätter See und der Mündung der Reuss in die Aare. Jacob Huber, der die Schlange sah, hielt sie zuerst – wie das Monster vom Zuger See – für einen riesigen Lachs und warf seinen Fischspeer nach ihr, ohne sie jedoch zu verletzen. Das verärgerte Ungeheuer stürzte sich auf ihn: Er sprang, nun selbst erschrocken, aus dem Boot und rannte nach Hause – und starb dort sechs Wochen später. Die Ursache wird wohl wieder das schlimme Gift gewesen sein, das der Drache ausdünstet und das auch den Drachentöter dahinrafft.
Graubünden ist der Schauplatz der letzten drei Drachenbegegnungen, die alle von dem Schweizer Geschichtsschreiber Ulrich Campbell (um 1510–1582) aufgeschrieben wurden. Er berichtet von „einem glaubwürdigen Mann, nun bereits verstorben“, der einem Lindwurm beim Lac du Saint-Moritz begegnete:
„Nicht weit von Cellerina im Oberengadin stürzt der den st. Moritzer see verlassende Inn über einen felsen in eine tiefe Schlucht und bildet einen wasserfall, der in bezug auf wassermenge zu den grössten und merkwürdigsten der Schweiz gehört. Bei diesem Wasserfalle soll nach alter volkssage einst ein drache oder lintwurm gehaust haben. Ein sonst glaubwürdiger, vor wenigen jahren gestorbener mann, Johann Mallet, soll denselben gesehen und vor schrecken erkrankt und gestorben sein.“ 47
Ähnlich erging es Martin Massol, Campbells Großvater mütterlicherseits. Er
„beobachtete eines Tages in der Steinwüste unterhalb des Berges Alpiglia nahe Süs [Susch] ein so großes schreckliches und schlangenartiges Tier, dass er sofort davon krank wurde, sein Haupthaar gänzlich verlor und sich die Haut an den Stellen seines Körpers ablöste, die dem Anblick des Untiers ausgesetzt und nicht von Kleidern bedeckt waren.“
Zudem gingen alle seine Pferde ein. 48
Den Drachen von Alpiglia wurden die Anrainer schließlich durch magische Mittel los.
„Joh. Branca von Guarda soll den kleinen see auf dem genannten berge Alpiglias bei Süs, wo ein drache wohnte, mit hülfe eines beschwörers mit blättern und zweigen überdeckt und dadurch den wurm genöthigt haben, mitten in einem gräulichen unwetter den ort zu verlassen, in folge dessen er den Inn abwärts bis Innsbruck geschwemmt und dort nicht ohne grosse gefahr getödtet wurde.“ 49
Der Tatzelwurm nimmt Gestalt an: das 17. und 18. Jahrhundert
Das 17. und 18. Jahrhundert stehen ganz unter dem Eindruck eines einzigartigen Gelehrten, des Schweizer Biologen und Geologen Johann Jakob Scheuchzer (1672–1733), der als Stadtarzt und Professor in Zürich tätig war, aber auch als Forscher, indem er als Erster und recht präzise die Gesteinsformationen und Bergketten seines Heimatlandes beschrieb. Als Erster erfasste er fossile Pflanzen (1709 im „Herbarium diluvianum“), er führte Buch über Bodenschätze 50und erlangte besondere Bekanntheit für seine Deutung eines versteinerten Riesensalamanders als Skelett eines in der Sintflut ertrunkenen Menschen, die er 1726 veröffentlichte. Man belächelt ihn deshalb in Büchern über die Geschichte der Zoologie und der Paläontologie, wer aber seine Werke zur Hand nimmt, merkt schnell, dass es sich um einen aufmerksamen und kritischen Geist handelte, der aber auch ein Kind seiner Zeit war.
In seiner „Natur-Geschichte des Schweitzerlandes“ (erstmals 1716 erschienen) widmete er, nach einem kurzen Exkurs über Funde von Riesen, ein ganzes Kapitel den Sichtungen von Drachen in seiner Heimat. Das Material umfasst Sagen, Meldungen aus Chroniken und zeitgenössische Augenzeugenberichte, teilweise stark gestützt auf Werke seiner Vorgänger, Johann Jacob Wagners „Historia naturalis Helvetiae curiosa“ von 1680 und „Mundus Subterraneus“ des jesuitischen Universalgelehrten Athanasius Kircher, erstmals erschienen 1665. „Allein ich komme nun […] auf die Betrachtung der Ungeheuern unter den Thieren, ich meyne die Drachen, an deren Würcklichkeit noch viele zweifeln.“ 51
Читать дальше