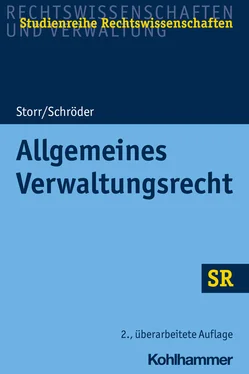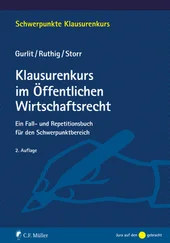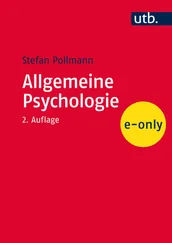Rechtsprechung:BVerfGE 63, 1 ff. – „ Schornsteinfeger “; BVerfGE 79, 127 ff. – „ Rastede “; BVerfGE 81, 310 ff. – „ Kalkar “; BVerfGE 83, 37 ff.– „ Ausländerwahlrecht “; BVerfGE 83, 60 ff.– „ Ausländerwahlrecht II “; BVerfGE 93, 37 ff. – „ Personalvertretungsgesetz “; BVerwGE 97, 117 ff. – „ Pensions-Sicherungs-Verein “; BVerfGE 97, 198 ff. – „ Bundesgrenzschutz “; BVerfGE 100, 249 ff. – „ Atomrechtliche Leitlinien “; BVerfGE 102, 370 ff. – „ Zeugen Jehovas “; BVerfGE 106, 1 ff. – „ Oberfinanzdirektionen “; BVerfGE 107, 59 ff. – Emschergenossenschaft “.
Literatur: Böckenförde, E.-W. , Die Organisationsgewalt im Bereich der Regierung, 1964; Burgi, M. , Funktionale Privatisierung und Verwaltungshilfe, 1999; Groß, T. , Die Verwaltungsorganisation als Teil organisierter Staatlichkeit, in: Hoffmann-Riem, W./Schmidt-Aßmann, E./Vosskuhle, A. , Grundlagen des Verwaltungsrechts, Band 1, 2012, S. 905 ff.; Hoffmann-Riem, W. , Organisationsrecht als Steuerungsressource, in: Schmidt-Aßmann, E./Hoffmann-Riem, W. , Verwaltungsorganisationsrecht als Steuerungsressource, 1997, S. 355 ff.; Huber, P. M. , Das Bund-Länder-Verhältnis de constitutione ferenda, in: Blanke, H.-J./Schwanenengel, W. , Zustand und Perspektiven des deutschen Bundesstaates, 2005, S. 21 ff.; Kahl, W. , Die Staatsaufsicht, 2000; Kluth, W. , Funktionale Selbstverwaltung, 1997; Koch, M. , Die Externalisierungspolitik der EU, 2004; Jestaedt, M. , Grundbegriffe des Verwaltungsorganisationsrechts, in: Hoffmann-Riem, W./Schmidt-Aßmann, E./Vosskuhle, A. , Grundlagen des Verwaltungsrechts, Band I, 2012, S. 953 ff.; Oebbecke, J. , Die Anstaltslast – Rechtspflicht oder politische Maxime? DVBl 1981, 960 ff.; Schmidt am Busch, B. , Die Beleihung: Ein Rechtsinstitut im Wandel, DÖV 2007, 533 ff.; Siekmann, H. , Die verwaltungsrechtliche Anstalt – eine Kapitalgesellschaft des öffentlichen Rechts? NWVBl 1993, 361 ff.; Schröder, R. , Stiftungsaufsicht im Spannungsfeld von Privatautonomie und Staatskontrolle – ein Beitrag zum Verhältnis von Staat und Stiftung, DVBl 2007, 207 ff.; Storr, S. , Das neue Kommunalunternehmen in Schleswig-Holstein, NordÖR 2005, 94 ff.; Schulte, M. , Der Staat als Stifter: Die Errichtung von Stiftungen durch die öffentliche Hand, in: Non Profit Law Year Book, 2001, 127 ff.; Stelkens, U. , Die Stellung des Beliehenen innerhalb der Verwaltungsorganisation – dargestellt am Beispiel der Beleihung nach § 44 Abs. 3 BHO/LHO, NVwZ 2004, 304 ff.; Sydow, G. , Vollzug des europäischen Unionsrechts im Wege der Kooperation nationaler und europäischer Behörden, DÖV 2006, 66 ff.
§ 3Verwaltungsrechtsverhältnis und subjektives öffentliches Recht
I.Das Verwaltungsrechtsverhältnis
1.Grundstruktur des Verwaltungsrechtsverhältnisses
69Häufig wird das Verwaltungsrecht von den Handlungsinstrumenten der öffentlichen Verwaltung her beurteilt. Zunehmend setzt sich jedoch die Erkenntnis durch, dass für die Verwaltungsrechtsdogmatik zudem das Verwaltungsrechtsverhältnis als Systematisierungsmodell fruchtbar zu machen ist. 1
Unter einem Rechtsverhältnisist eine von der Rechtsordnung geschaffene, besondere Beziehung zwischen mindestens zwei Rechtssubjekten zu verstehen, aus der sich Rechte und Pflichten gegenüber dem jeweils anderen ergeben; 2es handelt sich dabei also zunächst ganz allgemein um jedes von der Rechtsordnung spezifisch geregelte Lebensverhältnis. 3
Von einem Verwaltungsrechtsverhältnisist zu sprechen, wenn mindestens eines der Rechtssubjekte ein Verwaltungsträger ist. 4Da sich die öffentliche Hand auch privatrechtlicher Instrumente bedienen kann (z. B. Abschluss eines Kaufvertrages, § 433 BGB), ist das Verwaltungsrechtsverhältnis nicht darauf beschränkt, dass der Verwaltungsträger öffentlich-rechtliche Handlungsinstrumente gebraucht.
Dieser Offenheit des Verwaltungsrechtsverhältnisses ist entgegengebracht worden, dass es sich hierbei lediglich um eine umfassende analytische Kategorie handele, die kaum etwas ausgrenze und daher als dogmatisches Instrument zur genaueren rechtlichen Erfassung der Fülle der Verwaltungsrechtswirklichkeit nicht geeignet sei. 5In der Tat begründet das Verwaltungsrechtsverhältnis keine Rechte und Pflichten; sondern es ist nur die Summe der wechselseitigen Rechtsbeziehungen zwischen den betreffenden Rechtssubjekten.
2.Vorteile des Verwaltungsrechtsverhältnisses
70Gerade in dieser Ganzheitlichkeit liegt aber auch die Stärke eines Denkens in Verwaltungsrechtsverhältnissen: Es lässt die spezifischen Rechte und Pflichten in der Gesamtheit der Rechtsbeziehungen zwischen einzelnen Rechtssubjekten hervortreten 6und vermag den Blick für die Intersubjektivität des Verwaltungshandelns im Einzelfall zu schärfen.
Dabei werden, gerade weil das Verwaltungsrechtsverhältnis dadurch geprägt ist, dass mindestens eines der beteiligten Rechtssubjekte der öffentlichen Hand zuzurechnen ist, 7auch die besonderen Bindungen, denen diese unterliegt, nicht ausgeklammert. Deshalb sollte auch nicht übersehen werden, dass die „Rechte“ und „Pflichten“ des Staates in Verwaltungsrechtsverhältnissen regelmäßig „Aufgaben“, „Kompetenzen“ und „Bindungen“ sind, jedenfalls sofern es sich nicht um vertragliche Rechtsbeziehungen handelt.
71Auf der Grundlage dieses verwaltungsrechtsverhältnistheoretischen Ansatzes hat sich im Übrigen eine überzeugende Dogmatik vom verwaltungsrechtlichen Schuldverhältnisentwickelt (Rn. 397). Dieser liegt das Bestreben zugrunde, die aus dem Zivilrecht geläufigen Institute des Schuldrechts auf besondere Rechtsbeziehungen zwischen Bürger und Verwaltungsträgern bzw. verschiedenen Verwaltungsträgern untereinander zu übertragen. 8
Das Institut des verwaltungsrechtlichen Schuldverhältnisses kann z. B. eine Haftung entsprechend den Bestimmungen des zivilrechtlichen Schuldrechts begründen, etwa nach den Regeln der positiven Forderungsverletzung. Ein verwaltungsrechtliches Schuldverhältnis kann indes nur in besonderen Fällen angenommen werden. Der BGH verlangt, dass eine besonders „enge Beziehung des Einzelnen zum Staat“ besteht und dass das Handeln des Staates Ausfluss einer fürsorgerischen Tätigkeit gegenüber dem Einzelnen ist. Ferner muss ein „Bedürfnis“ für die Anwendung schuldrechtlicher Grundsätze gegeben sein (Rn. 398). 9
3.Das Entstehen von Verwaltungsrechtsverhältnissen
72Verwaltungsrechtsverhältnisse können entstehen:
– durch Rechtsnorm: z. B. durch eine gemeindliche Satzung, die den Anschluss- und Benutzungszwang an eine Fernwärmeleitung anordnet. In der Folge haben alle Grundstückseigentümer in dem betroffenen Gebiet ihr Heizungssystem an die Fernwärmeleitung anzuschließen und die Fernwärme zu nutzen. Ein anderes Beispiel ist etwa § 1 WPflG, der regelt, wer der allgemeinen Wehrpflicht unterliegt.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.