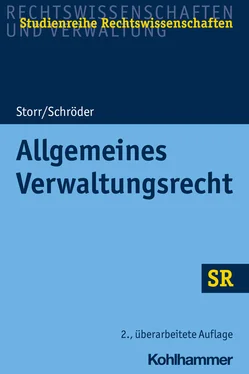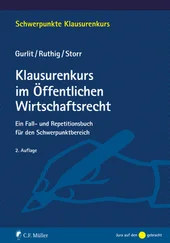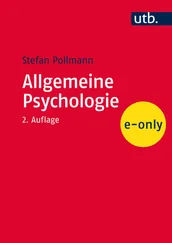66 bb) Die kommunale Selbstverwaltung.Gemeinden und Gemeindeverbänden (Landkreisen) ist durch Art. 28 Abs. 2 GG das Recht der Selbstverwaltung verfassungsrechtlich garantiert. Gemeinden haben das Recht, alle Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft im Rahmen der Gesetze in eigener Verantwortung zu regeln. Die kommunale Selbstverwaltung wurde in Preußen durch die Stein-Hardenbergschen Reformen im Jahre 1808 eingeführt und hatte den staatsintegrativen Zweck, die Bürger für das Gemeinwesen stärker zu interessieren und den Gemeingeist zu beleben. 55
Art. 28 Abs. 2 S. 1 GG gewährt die institutionelle Garantieder kommunalen Selbstverwaltung. Im Anschluss an K. Stern 56ist diese institutionelle Garantie in dreifacher Weise zu verstehen:
– als institutionelle Rechtssubjektsgarantieder Gemeinden und Gemeindeverbände, die sich in Verbindung mit Art. 28 Abs. 1 S. 2 und Abs. 3 GG zugleich als staatsorganisatorisches Aufbauprinzip erweist (Gewährung der Institutionen Gemeinde und Gemeindeverband);
– als objektive Rechtsinstitutionsgarantieder kommunalen Selbstverwaltung (Gewährleistung der Erledigung von kommunalen Aufgaben unter kommunaler Eigenverantwortung);
– als subjektive Rechtsstellungsgarantieder Gemeinden und Gemeindeverbände bei Angriffen auf Rechtssubjekts- und Rechtsinstitutionsgarantie (Rechtsschutz im Falle der Verletzung von gewährten Rechten).
Den Gemeinden steht das Recht zu, alle Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaftim Rahmen der Gesetze in eigener Verantwortung zu regeln. Der kommunalen Selbstverwaltungsgarantie kommt dabei nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts kein gegenständlich bestimmter oder nach feststehenden Merkmalen bestimmbarer Aufgabenkatalog zu. Diese Garantie umfasst aber die Befugnis, sich aller Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft, die nicht durch Gesetz bereits anderen Trägern öffentlicher Verwaltung übertragen sind, ohne besonderen Kompetenztitel anzunehmen. Hierzu gehören alle Bedürfnisse oder Interessen, die in der Gemeinde wurzeln oder auf sie einen spezifischen Bezug haben, die also den Gemeindeeinwohnern gerade als solchen gemeinsam sind, indem sie das Zusammenleben und -wohnen der Menschen in der Gemeinde betreffen; auf die Verwaltungskraft der Gemeinde kommt es hierfür nicht an. 57Ferner können der Gemeinde Staatsaufgaben zur eigenständigen Erfüllung übertragen sein.
67In den Ländern haben sich zwei Kommunalverwaltungsstrukturen herausgebildet. Einige Kommunalordnungen (z. B. Bayern, Thüringen) unterscheiden zwischen dem eigenen und dem übertragenen Wirkungskreis der Gemeinden und Gemeindeverbände ( dualistisches Modell). Im eigenen Wirkungskreis nehmen die Kommunen ihre (kommunalen) Aufgaben wahr, im übertragenen Wirkungskreis erfüllen sie Aufgaben für den Staat. Die staatliche Aufsicht über die Kommunen ist im Fall der eigenen Angelegenheiten regelmäßig auf eine Rechtsaufsicht beschränkt und erstreckt sich nur bei der Wahrnehmung übertragener (staatlicher) Aufgaben auf eine Fachaufsicht.
In den monistisch organisierten Kommunalordnungen(z. B. Nordrhein-Westfalen, Sachsen) gibt es – soweit Gesetze nicht ausdrücklich etwas anderes bestimmen – nur kommunale Aufgaben und deshalb nur einen Wirkungskreis der Kommunen; gleichwohl können die Kommunen bei einzelnen Aufgaben aus übergeordneten Gründen staatlichen Weisungen unterliegen (sog. Aufgaben zur Erfüllung nach Weisung). 58Diese werden durch eine Fachaufsicht durchgesetzt.
Zu beachten ist, dass die Landratsämterin dualistischen Systemen als Doppelbehörde organisiert sein können, weil sie – soweit sie rein staatliche Aufgaben wahrnehmen – untere staatliche Verwaltungsbehörde („Staatsbehörde“, vgl. etwa Art. 37 Abs. 1 S. 2 BayLKrO), im Übrigen aber Verwaltungsbehörde der Landkreise („Kreisbehörde“, vgl. etwa Art. 37 Abs. 1 S. 1 BayLKrO) sind. Im Gegensatz zu dieser dualistischen Kommunalverwaltungsorganisation ist in monistisch organisierten Staaten das Landratsamt zwar untere Verwaltungsbehörde, aber keine Staats- sondern stets Kreisbehörde (§ 2 Abs. 5 SächsLKrO).
Über das Recht zur eigenverantwortlichen Wahrnehmung örtlicher Aufgaben (die objektive Rechtsinstitutionsgarantie) werden verschiedene Schutzdimensionen aus Art. 28 Abs. 2 GG hergeleitet, insbesondere die Gebietshoheit(das Recht, hoheitliche Gewalt im Gemeindegebiet ausüben zu dürfen), die Personalhoheit(Dienstherrenfähigkeit), die Rechtsetzungshoheit(das Recht, eigene Normen, Satzungen, zu erlassen), die Organisationshoheit(Regelungen über die innere Organisation, die Bildung von Ämtern, Abteilungen, Referaten und gemeindlichen Betrieben und Unternehmen sowie Regelungen von Arbeitsabläufen zu erlassen), die Planungshoheitund die Finanzhoheit(vgl. Art. 28 Abs. 2 S. 3 GG).
Als institutionelle Garantiebedarf die Garantie der Einrichtung gemeindlicher Selbstverwaltung freilich auch insoweit der gesetzlichen Ausgestaltung. Mit Blick auf die Zulässigkeit gesetzlicher Beschränkungen ist dabei zwischen dem Kernbereichund der Vorfeldsicherungzu unterscheiden: Regelungen, die den Kernbereich aushöhlen, sind dem Gesetzgeber verwehrt. Zum Kernbereich gehört etwa die „Universalität“ des gemeindlichen Wirkungskreises. Im Bereich der Vorfeldsicherung sind gesetzliche Regelungen zulässig, wenn sie willkürfrei und verhältnismäßig sind. 59
Wie bereits mehrfach erwähnt, sind die Gemeinden schließlich Gebietskörperschaftendes öffentlichen Rechts. Ihre „Mitglieder“ sind die Gemeindeeinwohner. Das ist der durch seine Zugehörigkeit zum Staatsvolk definierte Teil der Gemeindeeinwohner. 60Eine Besonderheit regelt Art. 28 Abs. 1 S. 3 GG: Bei Wahlen in Kreisen und Gemeinden sind auch Personen, die die Staatsangehörigkeit eines Mitgliedstaats der Europäischen Union besitzen, wahlberechtigt und wählbar. 61
68 cc) Die funktionale Selbstverwaltung.Die funktionale Selbstverwaltung erfährt ihre Legitimation nicht vom Volk, sondern von den Mitgliedern der jeweiligen Körperschaften, die sich von Industrie- und Handelskammern über Wasser- und Bodenverbände bis hin zu Universitäten und Sozialversicherungsträgern erstrecken. 62So fassen berufsständische Kammern die einen jeweiligen Beruf ausübenden natürlichen oder juristischen Personen zur Wahrnehmung ihrer Interessen zusammen: Gegenüber dem Staat, aber auch intern, indem sie Aufgaben der Berufsaufnahme- oder -ausübungsüberwachung wahrnehmen. Dies kommt dem Staat zugute, weil er einen einheitlichen und fachkundigen Ansprechpartner des Berufszweigs hat und von Verwaltungsaufgaben entlastet wird. Die Kammern wurden so zu einem Bindeglied zwischen Staat und Gesellschaft.
Aus Art. 20 Abs. 2 S. 1 GG folgt, dass hoheitliche Gewalt stets auf das Staatsvolk zurückgeführt werden muss, weshalb das BVerfG für den Bereich der unmittelbaren Staatsverwaltung strenge Anforderungen an die Verwaltungsorganisation i. S. d. Hierarchieprinzips stellt. 63Doch steht diese Verfassungsbestimmung der Einrichtung funktionaler Selbstverwaltung noch nicht deshalb entgegen, weil die Legitimation für die Ausübung von Hoheitsgewalt von einer verbandlich organisierten Gruppe erfolgt, die nicht das Staatsvolk ist. Versteht man Art. 20 Abs. 2 S. 1 GG als ein grundlegendes Prinzip, so ergänzt und verstärkt funktionale Selbstverwaltung dieses demokratische Prinzip insofern, als ihr die Idee einer organisierten Beteiligung der sachnahen Betroffenen an den diese berührenden Entscheidungen zugrunde liegt und damit – auch vor dem Hintergrund des Art. 1 Abs. 1 GG – die Idee des sich selbst bestimmenden Menschen in einer freiheitlichen Ordnung. Deshalb – so das BVerfG – darf der Gesetzgeber für abgegrenzte Bereiche der Erledigung öffentlicher Aufgaben besondere Organisationsformen der Selbstverwaltung schaffen, den Betroffenen ein wirksames Mitspracherecht gewähren, verwaltungsexternen Sachverstand aktivieren, einen sachgerechten Interessenausgleich erleichtern und so insgesamt dazu beitragen, dass die von ihm beschlossenen Zwecke und Ziele effektiver erreicht werden. 64Und weiter heißt es: Gelingt es, die eigenverantwortliche Wahrnehmung einer öffentlichen Aufgabe mit privater Interessenwahrung zu verbinden, steigert dies die Wirksamkeit des parlamentarischen Gesetzes. Doch ist die partizipative Beteiligung von gesellschaftlichen Gruppen ein zweischneidiges Schwert. Eine Gefahr für die Demokratie ist zu befürchten, wenn die Wahrnehmung öffentlicher Aufgaben nicht mehr maßgeblich von (demokratisch legitimierten) Staatseinrichtungen gesteuert wird. Die Etablierung eines Verbände- oder Ständestaates wäre mit Art. 20 Abs. 2 S. 1 GG daher nicht zu vereinbaren.
Читать дальше