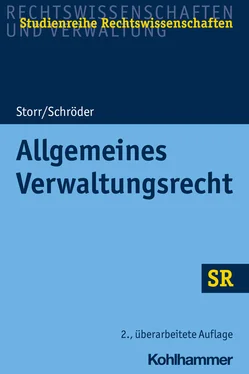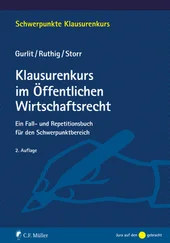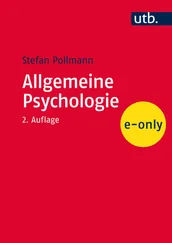– die Grundrechte als Leistungsrechte: Aus grundrechtlichen Schutzpflichten folgen Handlungsaufträge an die Verwaltung. 69Wegen ihrer Abhängigkeit von öffentlichen Mitteln binden sie Gesetzgeber und Verwaltung indes primär als objektives Recht und vermitteln insoweit keine individuellen Ansprüche. 70
– die Grundrechte als Teilhaberechte: Beim Zugang zu staatlichen Einrichtungen, wie den staatlichen Hochschulen, 71und bei bestimmten Verteilungsentscheidungen der Verwaltung, insbesondere in Knappheitssituationen, wie bei der öffentlichen Auftragsvergabe oder der Vergabe von Lizenzen 72, haben die Grundrechte die Funktion, eine gerechte Teilhabe der Bewerber am Auswahlverfahren zu garantieren und eine bedarfsgerechte Knappheitsverwaltung zu gewährleisten.
– die verfahrensrechtliche Dimensionder Grundrechte: Die Grundrechte schützen nicht nur materiell Eigentum, Beruf oder Forschung, sondern verlagern diesen Schutz auf das staatliche Verwaltungsverfahren und verstärken so die Wirkung der materiellen Grundrechtsgewährleistungen. 73Das Verwaltungsverfahren ist freiheitlich auszugestalten und die Verfahrensvorschriften sind im Lichte der Grundrechte zu interpretieren. 74Die verfahrensrechtliche Dimension der Grundrechte verschafft dem Bürger einen „status activus processualis“. 75
– die organisationsrechtliche Dimensionder Grundrechte: Die Grundrechte können auf die Organisation von Einrichtungen ausstrahlen, um Freiheitsgewährleistung zu optimieren. Die Rundfunkfreiheit als „dienende Freiheit“ (Art. 5 Abs. 1 S. 2 GG) verlangt eine Organisation des Rundfunks, die ein Mindestmaß an inhaltlicher Ausgewogenheit und Sachlichkeit gewährt, wie sie z. B. durch eine binnenplurale Zusammensetzung der Gremien öffentlich-rechtlicher Rundfunkanstalten möglich ist; 76der objektive Schutzgehalt der Wissenschaftsfreiheit (Art. 5 Abs. 3 GG) eine Hochschulverfassung, die die Gewähr für freie wissenschaftliche Betätigung gibt. 77
– die grundrechtliche Garantie auf Rechtsschutz: Gegen Maßnahmen der öffentlichen Gewalt, die jemanden in seinen Rechten verletzen, lässt Art. 19 Abs. 4 GG gerichtlichen Rechtsschutz zu. Es ist umstritten, ob sich der Schutzbereich dieser Rechtsschutzgarantie nur auf öffentlich-rechtliches Handeln des Staates erstreckt oder ob sein privatrechtliches Handeln einbezogen ist. 78Dieser Streit hat aber keine praktischen Auswirkungen, weil der allgemeine Justizgewährungsanspruch Rechtsschutz gegenüber den nicht von Art. 19 Abs. 4 GG erfassten Fällen gewährt. Dieser ist aus dem in Art. 20 Abs. 3 GG festgelegten Rechtsstaatsprinzip in Verbindung mit den Grundrechten, insbesondere Art. 2 Abs. 1 GG, herzuleiten. 79
5.Verwaltungsgrundsätze mit Verfassungsrang
35Aus der Verfassung wird eine ganze Reihe weiterer Grundsätze hergeleitet, die für die Verwaltung bindend sind, wie z. B. der Vertrauensschutz, die Begründungspflicht, der Grundsatz des rechtlichen Gehörs, der Grundsatz von Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit (vgl. Art. 114 Abs. 2 GG) 80, der Grundsatz des zweckmäßigen Ermessensgebrauchs, der Grundsatz der Bestimmtheit, und – allerdings nicht unumstritten – der Grundsatz der Öffentlichkeit. 81
6.Verwaltungsorganisation und Verfassung
36Die Verfassung enthält ferner Vorschriften für das Organisationsrechtder öffentlichen Verwaltung. Zum einen ist im Grundgesetz die Kompetenzverteilung der Verwaltung von Bund und Ländern (Art. 30, 83 f. GG) geregelt, zum anderen enthalten das Grundgesetz und die Landesverfassungen Vorschriften für den Behördenaufbau. Zudem hat der institutionelle Gesetzesvorbehalt Verfassungsrang (Rn. 58).
V.Verwaltungsrecht und Europarecht
37Was das Verwaltungsrecht unter europäischem Blickwinkel betrifft, sind grundlegend zwei verschiedene Vollzugssysteme zu unterscheiden. Mit direktem Verwaltungsvollzugist die eigene Verwaltungstätigkeit der Unionsorgane gemeint. Diese wird v. a. von der Kommission, von Agenturen und von unabhängigen Ämtern durchgeführt. Anders als im Recht der Mitgliedstaaten gibt es noch kein übergreifendes europäisches Verwaltungsverfahrensgesetz. Das europäische Verwaltungshandeln wird durch primärrechtliche Verwaltungsprinzipien und bereichsspezifische Verwaltungsverfahrensgesetze (z. B. „Beihilfeverfahrensverordnung“ 2015/1589 82) gelenkt.
Die überwiegende Verwaltungstätigkeit mit unionsrechtlichem Bezug erfolgt aber durch die Mitgliedstaaten nach den Regeln ihres nationalen Verwaltungsrechts ( indirekter Verwaltungsvollzug). Diese institutionelle und verfahrensmäßige Autonomie der Mitgliedstaaten findet freilich – so der EuGH grundlegend in der Entscheidung „Deutsche Milchkontor“ – im Unionsrecht einschließlich der allgemeinen unionsrechtlichen Grundsätze ihre Grenzen. 83
38Dabei kommt dem Unionsrecht – wie der EuGH grundlegend in „Costa/ENEL“ 84(1964) entschieden hat – gegenüber dem nationalen Recht Anwendungsvorrangzu. Damit ist die nationale staatliche Gewalt grundsätzlich an das primäre und sekundäre Unionsrecht gebunden. 85Das BVerfG spricht plakativ von der „normativen Verklammerung des Unionsrechts mit den Verfassungen der Mitgliedstaaten“. 86Anwendungsvorrang und Anwendungsgebot des Europarechts haben zur „Europäisierung des Verwaltungsrechts“ geführt.
Zu weit geht es indes, in Anlehnung an Fritz Werner (Rn. 29) vom deutschen Verwaltungsrecht als „konkretisiertem Unionsrecht“ zu sprechen. 87Denn für das Verwaltungsrecht hat die EU nur bereichsspezifisch Kompetenzen. Häufig handelt es sich um allein innerstaatliche Sachverhalte ohne grenzüberschreitenden Bezug, für die das Unionsrecht keine spezifischen Regelungen bereithält.
Beispiel:ein deutscher Staatsbürger beantragt einen Reisepass bei seiner Gemeinde; ein deutscher Bauunternehmer mit Sitz in einer deutschen Gemeinde beantragt eine Baugenehmigung etc. Die maßgeblichen Impulse erfährt das deutsche Verwaltungsrecht – immer noch – durch das deutsche Verfassungsrecht.
VI.Aktuelle Herausforderungen an die Verwaltungsrechtswissenschaft
39Gegenwärtig befindet sich das Verwaltungsrecht in einer Neuorientierung. 88Die drei wichtigsten Gründe hierfür dürften sein:
Die Integration Deutschlands in die EU: Das Unionsrecht wird weitgehend von den Mitgliedstaaten vollzogen, bedarf aber eines europaweit einheitlichen Vollzuges. Zunehmend haben sich verwaltungsrechtliche Strukturen auf europäischer Ebene herausgebildet, Verwaltungsgesetze und eine eigene Verwaltungsdogmatik, die von den mitgliedstaatlichen Rechtsordnungen gespeist wird und auf diese zurückwirkt. 89Der Aufbruch in ein Ius Publicum Europaeum 90ist gemacht, aber es sind erst anfängliche Schritte einer noch langen Wegstrecke, auf der sich verschiedenste Hindernisse (Sprachenfrage, unterschiedliche Verwaltungsrechtskulturen) befinden. In Zeiten solcher Umwälzungen ist es wichtig, sich auf die grundlegenden Strukturen eines Rechts zu besinnen, sie zu hinterfragen, wo nötig zu modifizieren, wo möglich zu erhalten.
40Die zweite große Anforderung an das Verwaltungsrecht hat ihre Wurzeln in dem Erfordernis, der Verwaltung angesichts der zunehmend mannigfaltigeren Anforderungen und dem vielfachen Bedürfnis, maßgeschneiderte Lösungen für komplexe Fragenzu finden, flexible Handlungsinstrumente in die Hand zu geben. Noch jung in ihrer dogmatischen Ausbildung sind das Regulierungsrecht und das Kooperationsrecht als Fundament für eine stärkere Einbindung Privater in die Erfüllung öffentlicher Aufgaben. Hieran geht das von O. Mayer formulierte Vertragsverbot für die Verwaltung vorbei, die dieser aus dem „das öffentliche Recht beherrschenden Grundsatze der allgemeinen einseitig bindenden Kraft des Staatswillens“ abgeleitet hat. 91Mit der Anerkennung der Formenwahlfreiheit der Verwaltung (Rn. 285 ff.) wurde dieser die Möglichkeit zugestanden, sich privatrechtlicher Handlungsformen zu bedienen. Mit §§ 54 ff. VwVfG wurde der öffentlich-rechtliche Vertrag eingeführt. Gegenwärtig geht es darum, die vielfältigen Einbindungen Privater in die öffentliche Aufgabenwahrnehmung mit einer zu entwickelnden Dogmatik des „Kooperationsvertrags“ gerecht zu werden und diesen ggf. als Rechtsinstitut in das Verwaltungsverfahrensgesetz zu etablieren. 92Das Verwaltungsrecht muss hier seiner Aufgabe einer Bereitstellung von Recht 93genüge tun.
Читать дальше