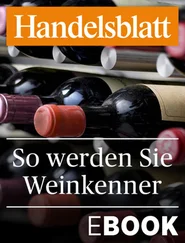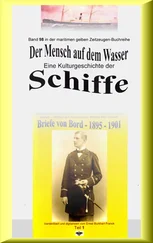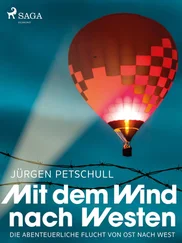1 ...6 7 8 10 11 12 ...20 Der Freitagsprediger setzte zu seiner Grundsatzrede an. Er erklärte, warum der einzige Weg zum Frieden in der Welt und zum persönlichen Glück das Leben nach den wahrhaftigen Regeln des Koran sei. Er sagte: »Eine kapitalistische Gesellschaftsordnung, deren oberstes Gebot die Profitmaximierung ist, steht zum Islam im grundsätzlichen Widerspruch – ebenso wie die Entmündigung des einzelnen durch die kommunistische Planwirtschaft. Der Imperialismus, der Kommunismus und der Zionismus sind unsere Feinde. Die Mächte, die diesen Ideologien anhängen, unterjochen die Völker des Libanon, Palästinas und Afghanistans – so wie sie früher den Iran unterjocht haben.« Die Stimme des Imams klang schrill, als er diesen Teil seiner Predigt beendete.
»Deshalb muß unser Ziel heißen: Nieder mit dem Imperialismus! Nieder mit dem Zionismus!«
Es war eine sehr gemischte Gemeinde, die dem Geistlichen lauschte. Außer ihrem Glauben hatten die Menschen in der Moschee wenig gemeinsam. Im Gebetsraum hockten Iraner, Iraker, Pakistani und Syrer, Türken, Tunesier, Marokkaner, Afghaner und Libanesen; auch dunkelhäutige Afrikaner und hellblonde Deutsche. Studenten in Jeans, Arbeiter in verschlissener Kleidung, Herren in Nadelstreifenanzügen und eine Handvoll junger Männer im Alter zwischen 20 und 40 Jahren, die sich mit den Statussymbolen der westlichen Gesellschaft geschmückt hatten: mit teuren Armbanduhren, Seidenkrawatten und Anzügen italienischer Modeschöpfer.
»Manch einer unserer Brüder in diesem Raum betet die vergoldeten, hohlen Götzen der dekadenten westlichen Konsumgesellschaft an«, fuhr der Imam fort, »statt auch hier in der Fremde nach den Regeln Allahs zu leben, der zu Bescheidenheit und Selbstbesinnung aufruft.« Dies sei um so verwerflicher in einer Zeit, in der gleichaltrige junge Gläubige im Iran, im Libanon und in Palästina im Kampf für die einzige, wahre, gerechte Sache des Islam als Märtyrer ihr Leben hingeben: »So wie es ein sinnloses Leben gibt, so gibt es auch einen sinnlosen Tod – aber das Sterben dieser Märtyrer ist der höchste Sinn irdischen Daseins!«
Bei diesen Worten spürte Hussein Ali Bakir die großen Augen hinter der blinkenden Brille auf sich gerichtet. Es mochte ein Zufall gewesen sein, aber später erinnerte er sich wieder daran.
Hussein Ali Bakir war gerade 26 Jahre alt geworden. Als Student war er Anfang 1978 nach Hamburg gekommen. Ein Semester lang studierte er, wie es sein Vater Hasan gewünscht hatte, an der Hamburger Universität Betriebswirtschaft – vielmehr versuchte er zu studieren, doch seine Sprachkenntnisse und seine Schulbildung reichten nicht aus. Er mußte das Studium abbrechen.
Er schämte sich, seinem strengen Vater sein Versagen einzugestehen. Noch ein Jahr lang schrieb er ihm Briefe nach Beirut, in denen er über angebliche Fortschritte seines Studiums berichtete.
Statt Betriebswirt mit Diplom wurde Hussein Teppichhändler; zunächst in der Hamburger Firma seines Onkels Yussuf. Die »Persepolis Carpets Im- und Export« unterhielt ihr Büro und Lager in einem der alten Backsteinhäuser in der Speicherstadt des Hamburger Freihafens. Hussein, so stellte sich bald heraus, hatte ein ungewöhnliches Talent zum Handeln, wie viele seiner libanesischen Landsleute.
Nach einem Jahr war er der beste Verkäufer der Firma »Persepolis«. Sein Onkel zahlte ihm ein Gehalt von 2000 Mark plus mietfreiem möblierten Zimmer. Das war dem ehrgeizigen jungen Mann zu wenig. Hussein begann erste einträgliche Nebengeschäfte zu machen – ohne Wissen und auf Kosten seines Arbeitgebers: Kunden seines Onkels sagte er vertraulich, er könne ihnen wertvolle Teppiche zu Großhandelspreisen bei Orientteppich-Importeuren im Hamburger Hafen beschaffen; einen mittelgroßen »Isfahan«, der rund 10 000 Mark kostete, verkaufte Hussein für 7000 Mark – und verdiente selber noch 2000 Mark daran.
Der Onkel des jungen Libanesen wunderte sich über die nachlassenden offiziellen Verkaufserfolge seines Neffen – bis er durch einen anderen Angestellten von Husseins privaten Nebengeschäften erfuhr. Wütend warf er den treulosen Zögling aus der Firma und aus seiner Wohnung. Im Zorn diktierte er einen Brief an Husseins Vater, an Hasan Ali Bakir, nach Beirut. Er nannte Hussein einen undankbaren Menschen, einen hinterhältigen Betrüger, und er berichtete jetzt auch, daß Hussein schon vor längerer Zeit sein Studium abgebrochen und seinen Vater belogen habe.
Der alte Mann schrieb daraufhin verzweifelt und zornig, daß er keinen Sohn mehr habe: »Ich will Dich nie wiedersehen!«
Das war im Herbst 1979 gewesen.
Hussein besorgte sich eine Pistole, eine 7,65 Walther PPK. Er betrank sich, fuhr nachts zu den menschenleeren St. Pauli-Landungsbrücken, kletterte über das Geländer, starrte in das gurgelnde Elbwasser und setzte den Pistolenlauf in seinen Mund. Er wollte sich so erschießen, daß sein Kopf zerschmettert würde und sein Körper in die zur Nordsee fließende Strömung stürzen mußte. Seine Leiche sollte nie gefunden werden oder wenigstens nicht mehr identifiziert werden können.
Später wußte er nicht mehr, wie lange er da gestanden hatte. Erst als es hell wurde und die ersten Werftarbeiter kamen, gab er sein Vorhaben auf.
Er war dann ziellos durch die Stadt gelaufen. Und als er sich bewußt wurde, daß er irgendwie weiterleben würde, da war er zum ersten Mal in die Hamburger Moschee gegangen und hatte gebetet.
Jetzt, beim Freitagsgebet, mußte er nach langer Zeit wieder daran denken, als der Imam über sinnloses und sinnvolles Sterben sprach: sein Selbstmord wäre damals ein vergeudeter Tod gewesen.
Damals hatte er haltloser und skrupelloser weitergelebt als zuvor. Immer häufiger kamen seine Kunden aus der Hamburger Halbwelt: Söhne aus reichen Familien, Nichtstuer, Playboys, auch Zuhälter und Luxushuren. Es sprach sich in diesen Kreisen schnell herum, daß da ein junger Libanese war, der Orientteppiche erster Qualität sehr billig liefern konnte.
Hussein Ali Bakir trug das leicht verdiente Geld nicht auf die Bank, sondern in das Spielcasino im Hamburger »Intercontinental-Hotel«. Oft verlor er am Roulettetisch in wenigen Stunden fünfstellige Summen. Als er eines Nachts aus dem Casino kam, wartete in der Tiefgarage die Polizei auf ihn. Sein blauer Porsche, den er mit Bargeld und mit Teppichen bei einem zwielichtigen Gebrauchtwagenhändler bezahlt hatte, war in München als gestohlen gemeldet worden. Er wurde als Autodieb verdächtigt und erkennungsdienstlich behandelt. Im Hamburger Polizeipräsidium legten sie eine Akte mit seinen Porträtfotos und Fingerabdrücken an.
Der Staatsanwalt verzichtete später zwar auf eine Anklage, aber die Ausländerbehörde kündigte an, seine Aufenthaltserlaubnis für die Bundesrepublik werde wahrscheinlich nicht noch einmal verlängert werden.
Das war im Frühjahr 1980. Kurz danach hatte er Miriam kennengelernt.
Miriam.
Er drehte sich um. Sie saß in der Gebetsnische bei den Frauen ganz vorn. Sie hockte während der Predigt entspannt im Schneidersitz am Boden, die schlanken Hände auf die Oberschenkel gelegt, den Kopf in den Nacken geworfen. Ihre Gesichtszüge waren entspannt, ihre Augen geschlossen. Er liebte ihre Augen.
Ihre Augen waren ihm zuerst aufgefallen, noch bevor er ihr ovales, sandfarbenes Gesicht, ihre langen braunen Haare und ihren geschmeidigen Körper wahrgenommen hatte. Es waren klassisch schöne, orientalische Augen, groß und mandelförmig, von dunklem Grün.
Sie war die Tochter eines persischen Architekten, der zu Regierungszeiten des Schahs in der Nähe von Teheran ganze Trabantenstädte entworfen hatte, bevor er sich mit seinen Auftraggebern überworfen hatte und nach Deutschland ausgewandert war. Ihre Mutter war eine Hamburger Modeschöpferin. Miriam besaß die deutsche Staatsbürgerschaft.
Im Juni 1980 heirateten Hussein und Miriam. Der junge Ehemann schickte seinem Vater einen Brief mit einem Hochzeitsfoto nach Beirut. Er schrieb auch, daß er die Tochter eines iranischen Schiiten geheiratet habe. Er glaubte, das würde seinen Vater freuen. Aber er bekam keine Antwort.
Читать дальше