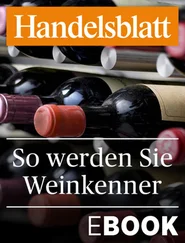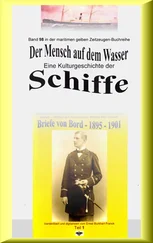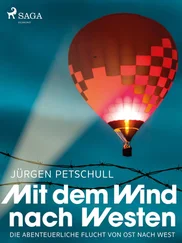Hamburg/Beirut, März–April 1984
Die Worte klangen in dem leeren Gebetsraum der Moschee nach. Hussein Ali Bakir stand regungslos da, mit einem seltsam eingefrorenen Gesichtsausdruck: sein Mund hatte sich halb geöffnet, aber es kam kein Laut hervor; seine Augen waren weit aufgerissen, aber sie wirkten leblos; seine Ohren schienen gehört zu haben, was der Imam gesagt hatte, aber eine Art Schutzmechanismus blockierte noch den Weg der Worte zu seinem Verstand.
In die Stille hinein sagte Mojtaba, der Mann aus Beirut, stokkend:
»Sie sind in Süd-Beirut umgekommen, in der Nähe von Bir el Abed. Die Amerikaner haben von See her geschossen ... zwei Granaten sind auf einem Marktplatz eingeschlagen ... es hat viele Tote gegeben. Die meisten waren Frauen und Kinder ...«
Unschlüssig hielt er ein kleines, silberfarbenes Notizbuch in den Händen, in das Miriam Bakir die Adressen von Freunden und Bekannten notiert hatte. Auf der ersten Seite stand unter der Rubrik »Bei einem Unfall bitte sofort benachrichtigen« der Name und die Hamburger Telefonnummer ihres Mannes.
Hussein stand noch immer wie erstarrt. Dann löste sich der Schock ganz plötzlich. Sein Gesicht zitterte. Die Augen flakkerten, der Körper wurde durchgeschüttelt. Die Beine gaben nach. Er sank auf die Knie, und sein Oberkörper klappte nach vorn, bis die Stirn wie zum Gebet den Boden berührte, aber seine Arme schlangen sich um seinen Kopf, als wenn er sich vor Schlägen schützen wolle. Erst war ein Wimmern zu hören, das schließlich in ein haltloses Schluchzen überging.
Später wußte er nicht mehr, ob er minuten- oder stundenlang so dagehockt hatte. Er spürte Hände an seinen Schultern, die ihn sanft aufrichteten. Es war der Mann aus Beirut. Neben ihm stand jetzt der Sekretär aus dem Büro des islamischen Zentrums. Der hielt ein Glas mit einer wässrig-milchigen Flüssigkeit in der Hand, in der Diazepam-Tabletten aufgelöst waren, ein starkes valiumähnliches Schlafmittel.
Hussein trank in langen, hastigen Zügen. Sie betteten ihn in einer Ecke der Moschee auf Strohmatten und Kisten. Bevor er in einen ohnmachtsähnlichen Schlaf fiel, sah er den Imam Mohammed Musa Ghobal aufrecht mit erhobenen Händen vor der Mirhab stehen. Der Imam zitierte aus dem Koran den 169. Vers der al Imram-Sure.
»Du darfst nicht glauben, daß diejenigen, die um Allahs Willen getötet worden sind, wirklich tot sind. Nein, sie sind im Jenseits lebendig und der Herr versorgt sie ...« Und er fügte den 42. Vers der al Fadschr-Sure hinzu: »Allah nimmt die Seelen zu sich zur Zeit ihres Todes und diejenigen, die noch nicht gestorben sind, während des Schlafens.«
Der Imam schlug den Koran zu und sagte: »Du, mein Bruder, wirst deine Frau und dein Kind am Tag des Jüngsten Gerichts im Jenseits wiedersehen – wenn du tust, was deine Aufgabe ist. Das verspreche ich, im Namen Allahs des Allmächtigen und Barmherzigen.«
Als Hussein nach einigen Stunden wieder zu sich kam, saß Mojtaba neben ihm und ließ die 33 Perlen des Tasbih, der rosenkranzähnlichen Gebetskette, unablässig durch seine Finger gleiten.
»Es ist besser, wenn du jetzt nicht allein bist«, sagte er nach einer Weile bestimmt. »Ich werde dich in deine Wohnung fahren und bei dir bleiben.«
Husseins Augen waren verklebt, seine Gelenke und Muskeln noch weich von der Wirkung der Tabletten.
Mojtaba stützte ihn, als sie den Gebetsraum verließen. Im Vorraum erkannte er einen Mann, der offenbar auf ihn gewartet hatte: der Reporter Jörg Peters.
Der blätterte abwesend in den ausgelegten Zeitschriften und Broschüren. Er hatte gerade in der Bibliothek sein Gespräch mit dem Imam, dem Vertrauten des Ayatollah Chomeini, beendet. Der Imam hatte ihm dabei auch von dem Schicksal des Mannes erzählt, den die Reporter noch vor wenigen Tagen mit seiner Frau und seinem Kind vor der Moschee fotografiert hatten – als Beispiel für die Unmenschlichkeit der »imperialistischen, kolonialistischen amerikanischen Kanonenbootpolitik«, wie er sagte.
Jörg Peters witterte eine Geschichte für sein Blatt, eine vom Schicksal dieses Mannes ausgehende Reportage. Der Reporter hatte es immer gehaßt, nach Verbrechen, Katastrophen, Aufständen und Militäraktionen mit den Hinterbliebenen der Opfer reden zu müssen. Er kam sich dann vor wie einer, der sein Geld mit dem Leid anderer verdiente. Aber es gehörte zu seinem Beruf, und andererseits – so redete er sich ein – konnten solche Reportagen mehr bewirken als Analysen und Leitartikel.
Er mußte den Mann jetzt ansprechen, bevor er vielleicht nicht mehr für ihn zu erreichen war.
Jörg Peters ging auf Hussein Ali Bakir und dessen Begleiter zu und sagte etwas hilflos: »Es tut mir leid.« Und dann: »Wenn ich Ihnen irgendwie helfen kann ...«
Hussein sah durch ihn hindurch und ging weiter, ohne ihn zu beachten. Erst als er den Ausgang der Moschee erreicht hatte und Mojtaba ihm die Tür aufhielt, drehte er sich um.
»Bitte geben Sie mir die Fotos«, sagte er, »es sind die letzten Bilder von meiner Frau und meiner Tochter.«
Jörg Peters versprach es und fragte schnell nach Husseins Adresse und Telefonnummer.
»Der Imam kann sie Ihnen geben.«
»Werden Sie nach Beirut fliegen?«
»Ja.«
»Kann ich Sie begleiten?«
»Nein«, sagte Hussein und ging, immer noch von dem anderen Araber geführt, nach draußen.
Es war dunkel geworden. Mojtaba steuerte Husseins Wagen nach dessen Wegbeschreibung durch den Hamburger Verkehr zum Isemarkt. Hussein war jetzt merkwürdig ruhig. Er wunderte sich selber darüber. Erst in seiner Wohnung wurde er wieder von einem Weinkrampf geschüttelt – als er im Flur die Mäntel seiner Frau hängen sah, im Badezimmer ihr Parfüm roch, als er im Kinderzimmer Plüschtiere und andere Spielsachen seiner Tochter in die Hand nahm. Alles war so, als würden sie gleich wieder zur Tür hereinkommen.
Er öffnete den Kühlschrank und goß sich ein Glas halb voll Wodka.
»Keinen Alkohol mehr!« sagte Mojtaba, nahm ihm das Glas weg und schüttete den Wodka in den Ausguß.
»Wir Moslems trinken keinen Alkohol!«
Hussein gehorchte.
»Gestern haben sie aus Beirut berichtet«, sagte er nach längerem Schweigen und schaltete kurz vor acht das Fernsehgerät im Wohnzimmer ein. Diesmal sendete die »Tagesschau« einen kurzen Filmbericht, den amerikanische und französische Kamerateams gedreht hatten. Erst Luftaufnahmen des amerikanischen Schlachtschiffes »New Jersey« vor der libanesischen Küste; dann Bilder von Bord: die Nahaufnahme von der Hand eines jungen Soldaten, der im Gefechtsraum einen Messinghebel umlegte; die großen Geschützrohre, aus denen die raketenartigen Granaten mit zweifacher Schallgeschwindigkeit in Richtung Libanon jagten; die Einschläge aus der Ferne gesehen und zerborstene Gebäude und Bombenkrater in Beirut aus der Nähe.
Schließlich schwenkte die Kamera über die zwischen den Trümmern nebeneinander aufgereihten verstümmelten Leichen. Viele Frauen waren darunter. Das Bild zitterte, als die toten Kinder zu sehen waren – eine Großaufnahme zeigte einen kleinen roten Spielzeugkoffer. Der Deckel war aufgeklappt, in dem Köfferchen lag eine Puppe.
»O Gott«, schrie Hussein. »Das ist ihr Koffer!«
Mojtaba sprang aus seinem Sessel hoch und riß die Leitungsschnur aus der Steckdose, in dem Moment, in dem der Moderator sagte, ein Sprecher des amerikanischen Verteidigungsministeriums in Washington habe inzwischen bedauert, daß bei der Beschießung von Artilleriestellungen in den Schuf-Bergen durch die »New Jersey« einige Geschosse ihr Ziel verfehlt hätten und dadurch auch Zivilisten getötet worden seien.
Hussein hörte es nicht mehr.
»O Gott«, schrie er noch einmal und trommelte mit den Fäusten auf seine Knie. »Warum haben sie das getan?«
»Weil sie uns hassen«, sagte Mojtaba, »weil sie anders sind als wir, weil wir nicht ihren Glauben haben, weil sie uns unterdrücken wollen, weil sie uns ihre Macht und ihre militärische Überlegenheit spüren lassen wollen. Weil sie die Israelis und die Christen unterstützen.« Nach einer Pause fügte er hinzu: »Du tust so, als wenn du das nicht weißt!?«
Читать дальше