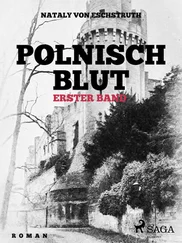Er sprang auf und wühlte mit den zehn Fingern durch sein Haar, um die hässliche Erinnerung los zu werden. Dann zündete er ein Licht an und ging in sein Schlafzimmer hinüber, um sich der Stiefeln und des engen Rockes zu entledigen. Weiche rote Saffianpantoffeln an den Füssen, mit einer künstlerhaften Sammetjoppe angethan, betrat er sodann das Kinderzimmer. Er löschte das Licht, denn eine rote Ampel verbreitete hinreichende Helle in dem schmucklosen, aber netten Raume. Er beugte sich über das Bett seiner Aeltesten, eines Mädchens von sechs Jahren. Er setzte seinen Zwicker auf die Nase und betrachtete lange und aufmerksam die weichen Züge des schlafenden Kindes. Das dichte braune Lockengewirr breitete sich weit über das Kopfkissen aus. Die vollen roten Lippen waren leicht geöffnet, weisse Zähnchen schimmerten feucht dahinter. Da lachte das Kind im Schlafe auf, patschte mit der Linken laut auf das Deckbett und wandte sich auf die andere Seite.
„Du lachende kleine Meduse!“ murmelte Renard vor sich hin, indem er das Kind leise auf den dunklen Scheitel küsste! Dann trat er an das gegenüberstehende Bettchen seines vierjährigen Knaben. Der hatte sich blossgestrampelt und mit der Gelenkigkeit eines kleinen Clowns sein strammes Beinchen wie einen lieben Kameraden mit den Armen umschlungen. Das rosige Licht liess das kecke, etwas schmollende Gesicht des Bürschchens frischer erscheinen, als es in Wirklichkeit war, und mit den Wangen wetteiferten an straffer gesunder Fülle die wohlgerundeten Hinterbäckchen. Ein väterlicher, neckender Klapps auf diesen naiven Körperteil liess den kleinen Kerl zusammenfahren. Er riss die runden Augen gross auf, starrte seinen Vater mit offenem Munde an, und dann sagte er ganz klar und gemütlich: „Na, Papa, bist du auch mal da?“ und dann wälzte er sich auf den Bauch, bedeckte die Augen mit den kleinen Fäusten — und war in zwei Minuten wieder fest eingeschlafen. Sein Vater zog das Deckbett herauf und glättete es über seinem Rücken.
Die Thür zum Nebenzimmer war nur leicht angelehnt — ein leises Husten klang von dorther. Renard horchte auf, lächelte, schüttelte den Kopf und ging wieder in sein Studierzimmer zurück.
Mit dem Licht in der Hand stellte er sich vor den Spiegel und betrachtete aufmerksam sein Ebenbild: „Hm! Nun ja,“ murmelte er vor sich hin, „die Kinder haben etwas von mir! Ich will einmal eitel sein. Aber wie lange wird es dauern, da ist es aus mit dem rafaelischen Cherubtum und meine süssen Kinder sind dem Stamme Abrahams, Isaaks und Jakobs rettungslos verfallen! Es sollte mich gar nicht wundern, wenn meine eigene christliche Nase nicht auch schon einen Stich ins Prophetische bekommen hätte.“
Er betrachtete diese gefährdete Nase von allen Seiten, ohne dass er doch vorläufig etwas Beunruhigendes daran wahrgenommen hätte. Dann stellte er das Licht auf die Spiegelkonsole, zündete sich eine Cigarette an und begann einen nachdenklichen Spaziergang um das Zimmer herum. Er legte die hohe Stirn in Falten, nagte die Unterlippe, blieb stehen, paffte eine dicke Wolke durch die Zähne, fuchtelte mit den Händen herum, stiess abgebrochene Worte, halbe Sätze hervor; kurzum — er dichtete!
Jetzt schien er eine Strophe beisammen zu haben. Er nahm das Licht und begab sich damit nach dem Schreibtisch, um die Studierlampe anzuzünden. So, das war gethan! Von einem grünen seidenen Schleier bedeckt, warf sie ihr mildes Licht auf das glatte weisse Löschpapier der Schreibunterlage.
Da lag ja ein Brief mittendrauf! Renard wollte den Störenfried nach einem flüchtigen Blick auf die Adresse beiseite schieben. Das Ding konnte auch bis morgen warten. Jetzt galt es, die Muse zu schmieden, solange sie warm war — wie sein Freund Wippchen gesagt haben würde. Aber diese Handschrift? — Er nahm den Brief wieder zur Hand, setzte den Kneifer auf und betrachtete aufmerksam die Aufschrift. Poststempel Bremen.
„Himmel! Der verdammte Junge wird doch nicht etwa zurückgekommen sein!?“ knirschte der Doktor zwischen den geschlossenen Zähnen hervor. Dann riss er hastig den Umschlag ab und entfaltete den Brief.
Wahrhaftig, da stand’s:
„Lieber Bruder!
Ja staune nur! Da bin ich wieder im alten Lande. Ich konnte mir nicht helfen — es hilft Dir also wohl auch nichts! Sehr vergnügt wirst Du natürlich nicht sein, dass Du mich nun wieder hast. Aber am Ende bin ich doch gar nicht so schlimm; dumme Streiche muss jeder machen, der es einmal zu etwas bringen will. Darüber mache Dir weiter keine Sorgen! Uebrigens bist Du ja auch ein verfluchter Kerl! Wenn wir zwei uns einmal hinsetzen und uns alles ordentlich überlegen, dann werden wir schon sehen, was mit mir anzufangen ist. Also alles Nähere mündlich!
Nur noch eins: ich bin als Schiffskoch frei herübergekommen. Natürlich habe ich jetzt keinen Ueberfluss an Kleingeld. Der Wirt pumpt höchstens noch vierundzwanzig Stunden, — das sehe ich dem fetten Schufte an — mein Koffer schien ihm gleich keinen sonderlich vertrauenerweckenden Eindruck als Pfandstück zu machen. Also sei so gut und weise mir per Draht eine bescheidene und N.B. anständige Summe an. Hotel Ottmer.
Dank und Gruss zuvor von
Deinem treuen Bruder
Henri.
P. S. Deine Frau lässt Dich schönstens grüssen. Ich habe sie in San Francisco zufällig getroffen. Du übrigens — na, wir sehen uns ja bald ...!“
Renard liess sich matt auf seinem stilvollen Schreibsessel mit dem gepressten Lederbezug zurücksinken. „Nanu kann’s hübsch werden!“ stöhnte er und schleuderte dabei das brüderliche Schreiben unsanft auf den Schreibtisch zurück.
Er sann ein Weilchen nach, dann entnahm er einem Fache des Aufsatzes auf dem Schreibtisch das Fahrplanbuch und blätterte mit leicht zitternden Fingern darin herum, bis er die Strecke nach Bremen gefunden hatte. Er beschloss, am andern Morgen selbst hinüberzufahren, um mit dem Strolch, dem Henri, ein ernstes Wort zu reden. Er durfte ihm um keinen Preis nach Berlin kommen — um keinen Preis!
Zweites Kapitel.
Richtige Berliner.
Das fischzugberühmte Stralau läuft mit seinen letzten Häusern, meist Bierwirtschaften und Bootsbauereien, auf einer Landzunge aus, welche die Reichshauptstadt der hierorts gar breitspurigen Mutter Spree sozusagen in kindlichem Uebermute weit herausstreckt. Und der Spitze dieser Landzunge gegenüber liegt ein kleines Eiland, welches der Berliner Witz in einer Anwandlung grausamster Galgenlaune die „Liebesinsel“ getauft hat. Dem Spreeathener schmeckt seine kühle Blonde in der Gartenwirtschaft dieses nüchternsten, reiz- und poesielosesten aller Eilande ebensogut, als würde sie ihm in einem cyprischen Myrthenhaine kredenzt, während die alten, echten Athener den Frechen, der es gewagt hätte, solch ein Stück Kartoffelland, von missfarbigem Wasser umflossen, mit der Schaumgeborenen in geistige Verbindung zu setzen, sicherlich wegen Gotteslästerung gesteinigt hätten.
Und dennoch waren es zwei Künstler, leibhaftige Musensöhne, welche an einem der letzten sonnigen Oktobertage mit ihrem Segelboot hier gelandet waren, um auf dieser trostlosen Insel bei einer Weissen den nahe bevorstehenden Sonnenuntergang zu geniessen.
„Was sinnst du, Fernando, so trüb’ und bleich?“ spottete der eine von ihnen, ein untersetzter, breitschulteriger Mann mit modisch gestutztem, dunkelblondem Vollbart, indem er dem neben ihm sitzenden jungen Menschen mit der auffallend hohen Stirn und den dunkel umränderten blauen Augen scherzend auf den Oberschenkel schlug. „Sie sind zwar nicht Landschafter, aber im Anblick so jrossartiger Naturschönheiten muss es doch sojar enem sauern Hering vor Verjnügen schwummerig werden, dächte ich! Immer ’raus aus de Trauerkutsche, junger Mann — wofor sind wir denn sonst nach de ‚Liebesinsel‘ jejondelt?“
„Ja, Sie haben gut lachen,“ entgegnete der andere bitter, „Sie betreiben Ihre Kunst als einen Sport, so gut wie das Segeln, die Jagd und das Radfahren — Sie Hausbesitzer Sie!“
Читать дальше